SGGP
Während Asien auf Hightech-Produktion umsteigt, drängen Ökonomen Afrika, die Lücke im Bereich der kostengünstigen Fertigung zu schließen, die Asien hinterlassen hat. Um den Übergang kostengünstiger zu gestalten, muss Afrika jedoch von den asiatischen Tigern lernen.
 |
| Textilarbeiterinnen in Äthiopien. Foto: Afrikanische Entwicklungsbank |
Seit den 2000er Jahren verzeichnen viele der führenden Volkswirtschaften Afrikas dank der Ausbeutung natürlicher Ressourcen für den Export wie Öl, Erdgas und Kohle hohe Wachstumsraten. Dieses auf natürlichen Ressourcen basierende Wachstum ist jedoch anfällig für globale Preisschwankungen. Ökonomen warnen zudem vor weiteren Einschränkungen wie schwachen Verbindungen zur Binnenwirtschaft, geringer Beschäftigungsentwicklung, negativen Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften und dem Klimawandel.
Ökonomen hingegen betrachten Wachstum, das von kostengünstiger Produktion, also der Herstellung von Gütern für den Export, angetrieben wird, als entwicklungsfördernder, da es global wettbewerbsfähig ist und viele Niedriglohnjobs schaffen kann. Dieser Weg führte Singapur, Südkorea, Taiwan und Hongkong zu Wohlstand und brachte ihnen den Spitznamen „Asiatische Tiger“ ein. Diese Volkswirtschaften waren teilweise auf diesen Weg angewiesen, um Wohlstand zu erreichen, und verzeichneten zwischen den 1950er und 1990er Jahren hohe Wachstumsraten von mindestens 7 %.
Tatsächlich sind viele afrikanische Länder stark von der Textil-, Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion abhängig geworden. Zwischen 2005 und 2014 hat sich die Produktionsleistung des Kontinents mehr als verdoppelt – von 73 Milliarden auf 157 Milliarden Dollar. Das ist schneller als der globale Durchschnitt. Kenia, das in Exportverarbeitungszonen Textilien für den Export in die USA und nach Südafrika produziert, Botswana, das versucht, seine Wirtschaft weg vom Mineralienabbau zu diversifizieren, und Mauritius, wo Dienstleistungsexporte Fuß gefasst haben, sind ein wichtiger Wachstumstreiber.
Sollte sich die Entwicklung jedoch fortsetzen, droht Afrika zunehmende Diskriminierung, wachsende Ungleichheit und eine Krise des Familienlebens. Afrikas am schnellsten wachsende Volkswirtschaften sollten sich diese Lehren von den asiatischen Tigerstaaten abschauen, die stark auf die Arbeitskraft von Frauen als günstiges, produktives und leicht kontrollierbares Kapital angewiesen waren. Ältere Zahlen aus den 1980er Jahren zeigen, dass Frauen in Asien sehr niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, häufige Entlassungen und einen Mangel an Gewerkschaftsrechten und -schutz genießen. Neben den Risiken unsicherer Einkommen, fehlender Krankenversicherung und sozialer Absicherung tragen Frauen auch die Doppelbelastung durch Arbeit und Betreuungspflichten.
Viele Faktoren haben in Asien zu einer Krise der sozialen Reproduktion geführt. In afrikanischen Ländern mangelt es oft an staatlicher Unterstützung für die Familien- und Gemeinschaftsfürsorge. Steigende Ungleichheit ist in vielen afrikanischen Ländern bereits ein Thema. Ohne staatliche Maßnahmen zur Regulierung der Löhne dürften sich diese Ungleichheiten verschärfen. Um die Auswirkungen zu begrenzen, sollten afrikanische Analysten und Politiker faire und fortschrittliche Löhne und Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer fördern, höhere öffentliche Investitionen in Infrastruktur und soziale Dienste tätigen und Maßnahmen ergreifen, die die Umverteilung von Arbeitskräften unterstützen.
Wie die Erfahrungen Asiens gezeigt haben, wird ein Mangel an politischen Maßnahmen die bestehende Ungleichheit und Geschlechterdiskriminierung in Afrika verschärfen und letztlich die wesentliche soziale Grundlage des Wirtschaftswachstums untergraben, so die Asia Times.
[Anzeige_2]
Quelle






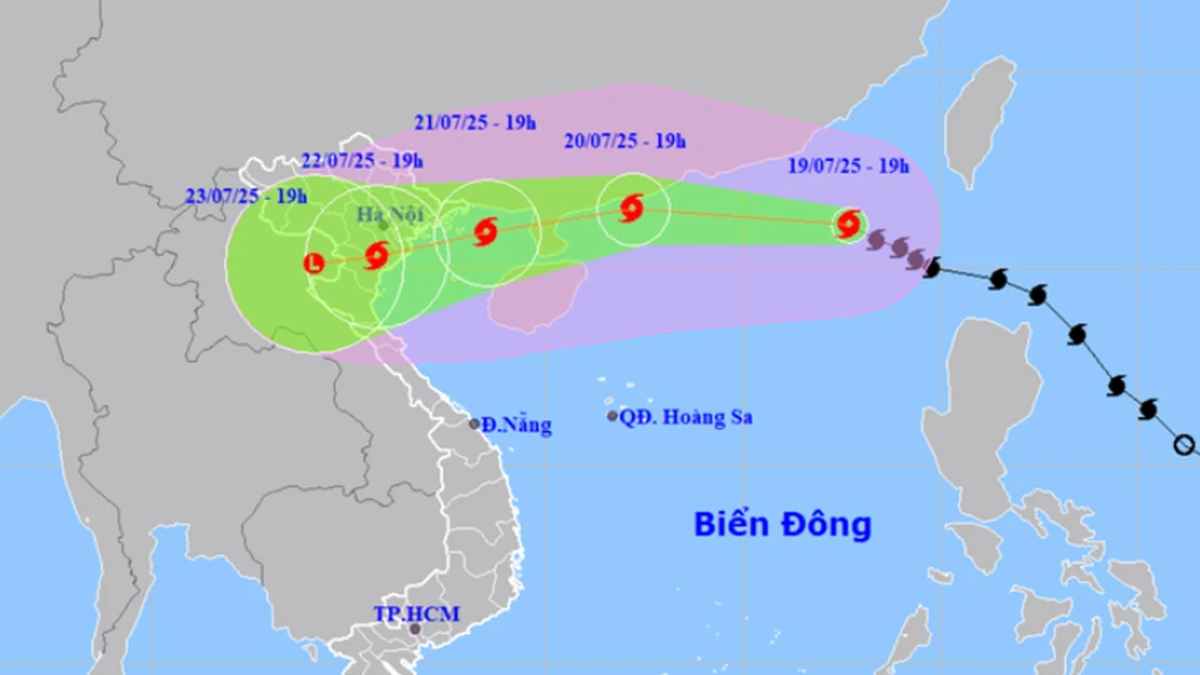











































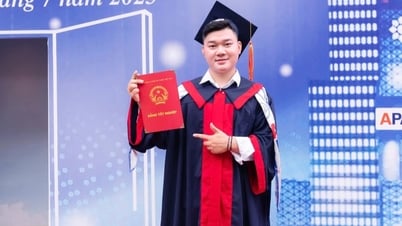



















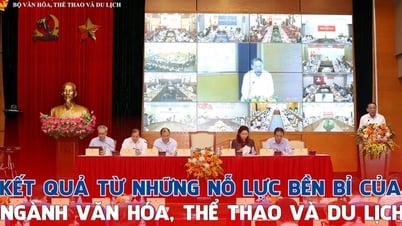

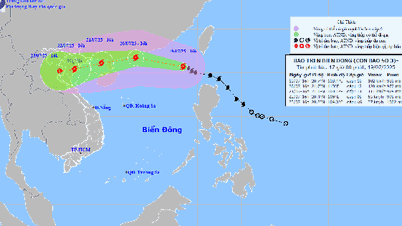
























Kommentar (0)