
Über einen halben Monat lang lag Sang allein im Krankenhaus. Niemand brachte ihm Essen, und kein einziger Freund besuchte ihn, obwohl er bei seinen Trinkgelagen stets viele Freunde einlud. Sang war immer stolz darauf gewesen, ein „fairer Spieler“ zu sein, wie seine Trinkkumpanen ihn lobten. Egal, wie viel er arbeitete, ließ er seine Freunde gewähren. Oftmals spielte er den Helden, um seine Freunde in Notlagen zu retten. Einmal wartete er bis zur Nacht, um die Kuh, die seine Mutter aufgezogen hatte, im Nachbarviertel zu verkaufen und so Geld für einen verschuldeten Freund zu verdienen. Während der Regenzeit regnete es so stark ins Haus, dass sogar das Bett auf einem Becken stehen musste. Trotzdem war Sang bereit, zwei Tage lang auf dem Dach seines Freundes zu klettern, um seinem Vater beim Reparieren der Wellblechdächer zu helfen. Das veranlasste Sangs Mutter, draußen zu stehen und ihren Sohn beim Klettern zu beobachten. Sie war verwirrt und fragte sich, ob Sang, wenn sie wiederbelebt würde, das Kind einer anderen Frau mit nach Hause bringen würde oder nicht...
Immer wenn Sangs Freunde in Schwierigkeiten waren, kamen sie zu ihm. Oftmals wurden Sangs Eltern nachts vom lauten Klopfen seiner „lieben Freunde“ an der Tür aufgeschreckt, und der „verdammte“ Sohn sprang auf, zog sich an und rannte davon. Selbst wenn der Himmel tobte, kümmerte ihn das nicht, geschweige denn der Rat seiner Eltern. Doch das „Aber“ im Leben ist allgegenwärtig: Als Sang krank war und in Not geriet, meldete sich kein Freund auch nur mit einem „Hallo“. Fragte man ihn, war der eine nicht zu Hause, der andere in ein Gespräch vertieft, und die engen Freunde, die früher die Kuh seiner Mutter verkauft hatten, um Schulden zu begleichen, oder ihm bei Regen das Dach repariert hatten, waren aus allen möglichen Gründen verschwunden.
Draußen klang das Plätschern des Flusswassers wie die Schritte von Sangs Vater, der das Boot am Pfahl festmachte. An einem Tag war der Himmel so düster wie heute, und sein Vater kam in einem weiten Regenmantel vom Flusskai zurück und warf einen Strang Fische, die sich noch zappelnd neben den Wasserkrug legten, hin. Er forderte Sang auf, das Feuer für den Brei anzuzünden, während er eilig den Fisch vorbereitete. Als Vater und Sohn ihr Abendessen schlürften, war es bereits dunkel. Der Schatten von Sangs Vater fiel an die Wand; sein Rücken war wie der einer Garnele gekrümmt, was Sangs Augen brannte. Der dampfende Topf mit dem Fischbrei stieß ein paar Rauchschwaden aus, woraufhin Sang sich verstohlen die feuchten Augen rieb.
Heute Abend, als er in dem Haus lag, in dem Termiten an ihm nagten, vermisste Sang seinen Vater plötzlich so sehr, dass ihm die Stimme versagte. Er vermisste den Topf mit dem dampfenden Fischbrei, den sein Vater mit etwas Pfeffer und ein paar Korianderstängeln aus dem Wasserkrug verfeinert hatte. Dort oben am sternenklaren Himmel, auf der Veranda sitzend und auf die dornenbewachsene Straße blickend, die Füße auf dem rauen Ziegelboden, dem Wind des Flusses lauschend, hörte Sang seinen Vater rauchen und murmeln, er solle nach dem Spielen früh nach Hause kommen und nicht mit seinen Freunden in die Stadt fahren und sein Leben vergeuden. Die Stirn seines Vaters war in Falten gelegt, aber seine Augen und sein Lächeln waren so sanft wie die Erde.
Die Schwelle, auf der Sangs Vater früher eine Matte zum Reiskochen ausbreitete, ist jetzt von Termiten befallen. Als Mutter noch lebte, sah Sang sie jedes Mal, wenn sie abends nach Hause kam, wie sie hastig Reis zubereitete. Der Topf mit Reis und Mais quoll bis zum Deckel. Mutter saß da und schaufelte jedes Maiskorn einzeln in ihre Schüssel, die sie wie Watte zu ihrem großen Sohn schob, der sich jedes Mal bücken musste, wenn er durch die Tür ging. Zu jeder Mahlzeit gab es ein paar gekochte Süßkartoffelsprossen in Fischsauce und einen großen Haufen Fisch, geschmort mit Kurkumablättern, den Sangs Vater zerkleinern musste. Mutter saß daneben, hatte keine Zeit zum Schaufeln, schwitzte stark, lächelte aber glücklich, als ob die ganze Familie ein Festmahl feierte. Vater erzählte, Mutter habe nach ihrer Hochzeit so fleißig gespart, dass sie ihm vier Jahre später etwas Geld für den Hausbau geben konnte. Doch nun drohten die Termiten das Haus zu zerstören, und so wünschte er sich nur noch ein wenig Geld für ein stabileres Haus. Erstens, damit Sang seine Braut bei ihrer Hochzeit gebührend empfangen konnte, und zweitens, damit die Ahnen, die dort oben saßen, stolz auf ihn herabschauen konnten. Doch bis zu seinem Lebensende blieb dieser Wunsch ein ferner Traum.
Der Vollmond warf seinen Schatten durch das Fenster, hinter dem Sang zusammengerollt lag. Sein Licht ergoss sich über den Boden und überzog jeden Zweig und jeden Grashalm mit einem silbrig-weißen Schleier. Nacht und Wind umgaben ihn, als wollten sie ihn von der kargen Erde emporheben. Die Schatten seiner Eltern hallten in seinen Gedanken wider und ließen seine Augen trüb werden. Die Hähne krähten. Draußen glichen Himmel und Erde dem Nebel, der Wind vom Fluss fegte herüber und jagte sich über die Felder und in den Garten. Hinter dem Sommer flatterten ein paar zerfetzte Bananenblätter. Plötzlich fror Sang. Die Kälte hielt an.
Sang erinnert sich, dass sein Vater mit zunehmendem Alter immer einsamer wird. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, sieht er ihn langsam mit seinem Stock zum Kai gehen. Langsam und nachdenklich betrachtet, blickt sein Vater auf die Boote am Flussufer. Sehnsüchtig schaut er auf den Fluss, wie ein junger Mann, der seiner Geliebten in die Augen sieht. Der Fluss fließt stromabwärts, vorbei an unzähligen Stromschnellen. Der Schatten seines Vaters ist flüchtig, einsam in der Weite, die formlose Einsamkeit endlos im Fluss versinkend. Sein Vater steht still und schaut nur. Dann wendet er sich leise ab. Während seiner Krankheit liegt er nur still da, sagt nichts, sein verhärmtes Gesicht verrät nichts mehr. Die Hängematte schaukelt noch sanft, sein Vater blickt leer durch das kleine Fenster in den Himmel, in seinem Blick die Sorge um Sangs ungewisse Zukunft.
Die Nacht wich allmählich dem Morgen. Die Sterne drängten sich dicht aneinander und strahlten ein schwaches blaues Licht am dunklen Himmel aus. Sang sah, als ob hunderttausend Augen auf ihn gerichtet wären. Doch nur ein einziges Auge war zu sehen, woraufhin Sang, noch in seinem Mantel, aufsprang. Er ging zum Fluss. Das Boot seines Vaters lag noch immer an einem Pfahl vertäut, der schräg am Ufer des Flusses stand, der sich endlos dem Meer, dem endlosen Leben, entgegenzog. Das braune Hemd mit den drei Pfosten hing noch immer an dem Pfahl. Sang tastete sich hinaus. Der Wind pfiff durch sein Hemd und erzeugte ein eisiges Geräusch. Nie zuvor war ein so kalter Winter über diesen Landstrich gezogen. Sang zog den Kragen seines Hemdes über seinen Hals, der von einem trockenen Hustenanfall geplagt wurde. Mehr denn je verstand Sang, dass ihn jetzt nur noch der Holzofen seiner Mutter wärmen konnte, der Ofen, in den seine Eltern Tag und Nacht regelmäßig Holz nachlegten.
Sang stand noch immer da, den Blick auf das Boot gerichtet, das auf dem Wasser schaukelte, als würde es spielen. Hinter dem Nebel sah er den Schatten eines Mannes, der eifrig an einem Pfahl arbeitete und das Ankerseil in der Hand hielt. Seine Augen suchten nach einer flachen Stelle, damit das Boot nicht auf Grund lief. „Papa!“, rief Sang leise. Der Mann blickte auf, seine Stirn noch immer in Falten gelegt, sein Lächeln warm und freundlich. Die Wellen schlugen laut ans Ufer. Der Nebel zog vom anderen Ufer herüber und fegte rasch über dieses Ufer hinweg, breitete einen dünnen, leichten Schleier über die Wasseroberfläche. Sang ging ans Ufer. Seine Füße berührten das kalte Wasser, das ihn taub machte, doch er ging weiter. Das Wasser reichte ihm bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien. Sangs Hand berührte das Boot. Das Bild seines Vaters verschwand plötzlich wie Nebel. Sang blieb stehen und sah dem Schatten des Mondes nach, wie er langsam zurücktrieb und zwischen den Wasserhyazinthen verschwand. Sang traten die Tränen in die Augen.
„Geh nach Hause, mein Junge! Schlaf gut! Nachts ist es hier draußen kalt!“, flüsterte Papas Stimme, als käme sie von weit her.
Hoch oben funkelten Tausende kleiner Sterne im Flussbett, das in Millionen Stücke zerbrach. Sang glaubte, die Augen seines Vaters lächeln zu sehen. Hinter ihm watete seine Mutter ebenfalls durch das Wasser und ging rückwärts, während sie tief im Sand vergrabene Muscheln ausgrub. Plötzlich tauchte vor Sangs Augen der Holzofen mit ein paar glühenden Kohlen auf, der Reistopf auf der Matte auf der Veranda. Er hörte irgendwo den Duft von kochendem Reis, den Duft von in Kurkuma geschmortem Fisch, der auf dem Holzofen köchelte. Sang schloss die Augen und atmete tief ein. Wieder roch er den Duft von Stroh, von Holzrauch und von Gras nach dem Regen. Sang stockte der Atem und er rieb sein Gesicht an dem alten Hemd, das sein Vater auf dem Korb zurückgelassen hatte. Das Hemd war kalt und feucht vom Nachttau, aber er konnte immer noch den Schweiß seines Vaters riechen, einen Geruch, den er vielleicht selbst nach Jahrzehnten nicht vergessen konnte. Der Duft von Liebe, von Entbehrung …
Sang wischte sich die Tränen ab und fasste einen stillen Entschluss. Sang würde bleiben! Er würde neu anfangen! Als seine Eltern geheiratet hatten, besaßen sie nichts. Sang hatte nun ein Haus, ein kleines, aber für viele dennoch ein Traumhaus. Und dort drüben waren die Fischernetze noch immer jede Nacht voller Fische und Garnelen. Sang würde hierher zurückkehren, um den Duft der Felder und die Brise vom Fluss einzuatmen. Sang würde hart arbeiten wie sein Vater, wie die starken Männer im Dorf. Früher oder später würde Sang eine liebevolle Familie haben, wie seine Eltern sie gehabt hatten, Kinder, die ihre Eltern lieben würden, die ihren Geburtsort lieben würden … Sang würde ganz bestimmt neu anfangen!
Der Hahn krähte am Morgen. Zum ersten Mal seit dem Weggang meiner Eltern konnte ich ruhig schlafen…
Kurzgeschichte von VU NGOC GIAO
Quelle: https://baocantho.com.vn/giac-mo-ve-sang-a195072.html
























































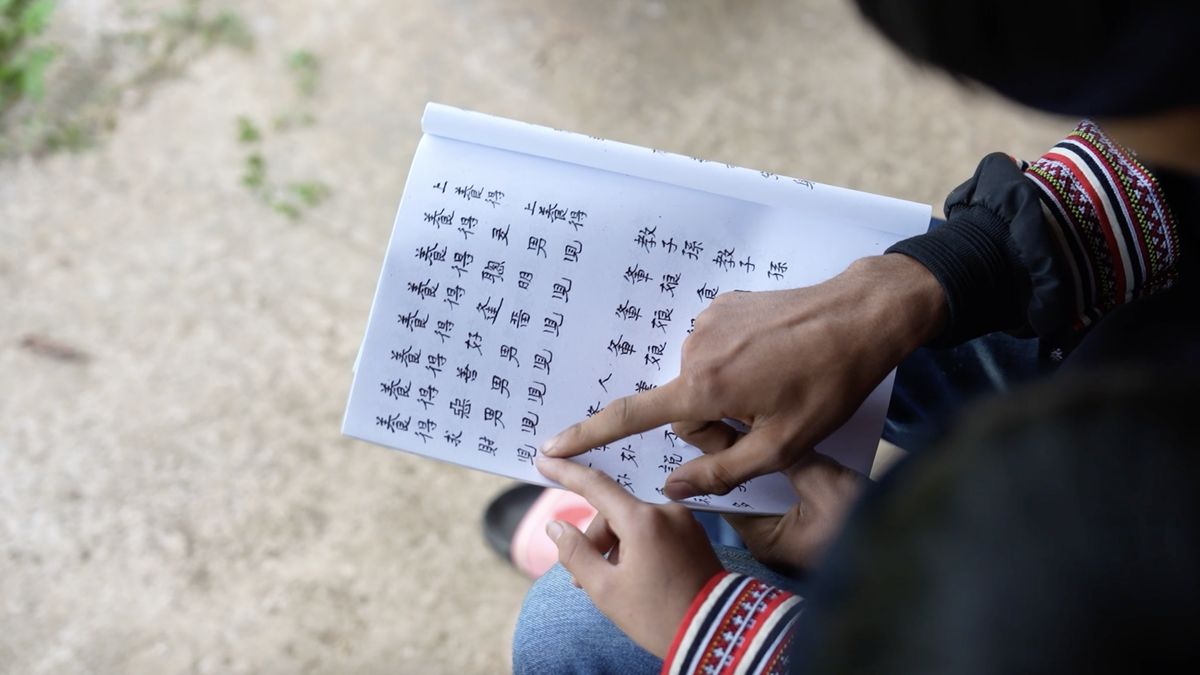















































Kommentar (0)