
Jede Brücke, jede U-Bahn-Linie, jedes Stromnetz und jede nationale Datenbasis ist ein Maßstab für institutionelle Disziplin, Koordinierungsfähigkeit und soziales Vertrauen.
Der Inhalt der im Entwurf des politischen Berichts, der dem 14. Kongress vorgelegt wurde, vorgeschlagenen Infrastrukturdurchbrüche lautet: „Den Aufbau der sozioökonomischen Infrastruktur, insbesondere der multimodalen Verkehrsinfrastruktur, der technologischen Infrastruktur zur Unterstützung von Management, Regierungsführung und Entwicklungsprozessen sowie der Infrastruktur zur Unterstützung der digitalen Transformation, der grünen Transformation, der Energiewende und der Anpassung an den Klimawandel, weiterhin synchron abschließen und bedeutende Durchbrüche erzielen.“
Dieser Durchbruch muss systemisch verstanden werden – nicht nur als Ausweitung der Bauinvestitionen, sondern auch als Verbesserung der Betriebsfähigkeit der gesamten nationalen Infrastruktur. Der Artikel schlägt einen neuen Ansatz für Infrastruktur-Durchbrüche vor, der eine wissenschaftliche Methode zur Prioritätensetzung, fünf strategische Investitionssäulen und einen modernen Umsetzungsmechanismus nach dem Vorbild des Nationalen Projektmanagementbüros (NPMO) umfasst.
Infrastruktur – die materielle Grundlage institutioneller Entwicklung
Nach fast vier Jahrzehnten der Umsetzung des Doi-Moi-Prozesses hat Vietnam große Erfolge in Wirtschaft, Gesellschaft und internationaler Integration erzielt. Um jedoch in die neue Ära einzutreten, Im neuen Entwicklungszeitalter – dem Zeitalter der Innovation, der Begrünung und der Nachhaltigkeit – benötigt unser Land einen starken Schub für die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur.
Infrastruktur umfasst nicht nur physische Strukturen, sondern auch die operative Leistungsfähigkeit eines Landes – die Fähigkeit, Menschen, Unternehmen, Regionen und Wertschöpfungsketten zu verbinden. Moderne Infrastruktur senkt Transaktionskosten, steigert die Produktivität und eröffnet neue Entwicklungsräume. Umgekehrt stellt eine mangelhafte Infrastruktur ein erhebliches Hemmnis für den Entwicklungsprozess dar.
Mit Blick auf die vergangenen Jahre, insbesondere den Zeitraum 2021–2025, lässt sich feststellen, dass in viele große Infrastrukturprojekte investiert wurde. Dennoch ist es weiterhin notwendig, strategische Infrastrukturprojekte zu priorisieren und dabei insbesondere Synchronisierung, Vernetzung und positive Nebeneffekte zu gewährleisten. Jetzt gilt es, vom Denken in einzelnen Projekten zum Denken in Systemen überzugehen und Infrastruktur als institutionelle Komponente nationaler Kapazitäten zu begreifen.
Die Natur des „Infrastrukturdurchbruchs“ in der neuen Phase
„Durchbruch“ bedeutet nicht nur, Investitionen zu beschleunigen, sondern die operative Leistungsfähigkeit des gesamten Systems zu steigern – gemessen an Zeit, Kosten und Zuverlässigkeit von Waren-, Personen-, Energie- und Datenflüssen.
Eine Straße ist erst dann wirklich sinnvoll, wenn sie an Wirtschaftskorridore anknüpft, Transportzeiten verkürzt und Logistikkosten senkt. Ein Stromnetz entfaltet sein volles Potenzial erst, wenn es intelligent gesteuert werden kann, erneuerbare Energiequellen einbindet und die nationale Energiesicherheit gewährleistet. Eine digitale Infrastruktur ist erst dann wirklich nützlich, wenn sie zum Rückgrat der öffentlichen Verwaltung und Innovation wird.
Daher müssen Infrastrukturprojekte neu ausgerichtet werden: von „Expansionsinvestitionen“ hin zu „Betriebsplanung“, von „einzelnen Sektoren“ hin zu „Systemverknüpfungen“, von „Investitionskosten“ hin zu „Lebenszykluseffizienz“. Dieser Ansatz zeugt von institutioneller Weitsicht und moderner Governance-Kompetenz.

Priorität sollte Investitionen in (i) Energieinfrastruktur – Stromnetz – Speicherung und intelligente Einsatzplanung eingeräumt werden.
Priorisierung – die wissenschaftliche Grundlage für eine langfristige Vision
Infrastrukturinvestitionen erfordern stets enorme Ressourcen und einen langen Umsetzungszeitraum. Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel und einer strengen Verschuldung sowie begrenzter Möglichkeiten zur Mobilisierung von Sozialkapital ist die Festlegung der richtigen Prioritäten und die Fokussierung auf Schlüsselinvestitionen unerlässlich, um unkoordinierte, doppelte und ineffektive Investitionen zu vermeiden. Diese Ausrichtung verfolgt die Regierung im Zeitraum 2021–2025 konsequent.
Zunächst müssen drei grundlegende Prinzipien bei der Festlegung von Prioritäten für Infrastrukturinvestitionen vereinheitlicht werden:
1. Engpass zuerst: Konzentration auf Engpässe, die die Kapazität des gesamten Systems einschränken, wie z. B. die Stromübertragungsinfrastruktur, interregionale Logistikkorridore oder Routen, die Seehäfen, Industrieparks und Grenzübergänge verbinden;
2. Ergebnisse vor Projekte stellen (Ergebnis vor Vermögen): Nicht die Anzahl der Projekte als Maßstab für den Erfolg verwenden, sondern anhand konkreter Ergebnisse bewerten - Reisezeit, Logistikkosten, Stauvermeidung und Effizienz bei der Bedienung von Personen und Unternehmen;
3. Erst erhalten, dann erweitern: Investitionen in die Instandhaltung, Modernisierung und Optimierung des Betriebs bestehender Anlagen müssen als eine Form von Investitionen mit hoher Rendite betrachtet werden, die dazu beitragen, Budgets zu sparen und die Lebensdauer öffentlicher Anlagen zu verlängern.
Um Objektivität zu gewährleisten, ist die Anwendung eines multikriteriellen Bewertungssystems (MCDA) bei der Projektauswahl erforderlich. Jedes Infrastrukturprojekt sollte anhand klar definierter Kriterien bewertet werden, darunter: 1. Systemische Auswirkungen und sozioökonomische Effizienz; 2. Fähigkeit zur Vernetzung von Wertschöpfungsketten, Wirtschaftskorridoren und dynamischen Regionen; 3. Auswirkungen auf Klimaanpassung und Emissionsreduzierung; 4. Fähigkeit zur Mobilisierung von außerbudgetären Mitteln, insbesondere durch öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), grüne Anleihen und CO₂-Zertifikate; 5. Umsetzungsbereitschaft (Landfreigabe, Planungsunterlagen, Kapazität der Auftragnehmer); 6. Fähigkeit zur Generierung von Einnahmen und zur Sicherstellung nachhaltiger Betriebs- und Instandhaltungskosten.
Darüber hinaus sollten vier abschließende Filterprüfungen auf wichtige nationale Projekte angewendet werden: 1. Engpassprüfung: Befindet sich das Projekt tatsächlich an einem kritischen Knotenpunkt im Netzwerk? 2. Zuverlässigkeitsprüfung: Trägt das Projekt zur Erhöhung der Stabilität der Lieferkette bei und reduziert es Durchlaufzeiten und -kosten? 3. Finanzprüfung: Gewährleistet das Projekt eine ausgewogene Kapitalnutzung, begrenzt es den Kapitalzuwachs und hält es die Instandhaltungskosten stabil? 4. Erweiterungsprüfung: Schafft das Projekt neue Entwicklungsmöglichkeiten und ebnet den Weg für zukünftige Technologieanwendungen und Folgeinvestitionen?
Die Anwendung dieser Prinzipien und Prüfverfahren schafft nicht nur Transparenz und Konsistenz bei der Investitionsauswahl, sondern trägt auch dazu bei, den Fokus der staatlichen Verwaltung von der „Projektgenehmigung“ hin zum „Portfolio-Performance-Management“ zu verlagern – also hin zu einem evidenz- und ergebnisorientierten Managementmechanismus. So schafft jedes in Infrastruktur investierte Kapital nicht nur ein konkretes Produkt, ein konkretes Projekt, sondern stärkt auch die Entwicklungskapazität der Volkswirtschaft.
Fünf strategische Prioritätssäulen für den Zeitraum 2026–2035
(1) Energieinfrastruktur – Netz – Speicherung und intelligentes Lastmanagement. Energiesicherheit gewährleisten und grüne Transformation fördern. Fokus auf Investitionen in überregionale Übertragung, Großspeicher, intelligentes Lastmanagement und einen vollständig wettbewerbsfähigen Strommarkt.
Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften im Übertragungsnetz und verfügbarkeitsbasierten Verträgen zur Mobilisierung von privatem Kapital.
(2) Multimodale Logistikkorridore und interregionale Logistikzentren. Entwicklung von Nord-Süd- und Ost-West-Korridoren zur Verbindung von Seehäfen, Grenzübergängen und Industrieparks. Aufbau von drei regionalen Logistikzentren (Nord, Mitte und Süd) als Kern der Lieferkettenkoordination.
Ziel bis 2030: Senkung der Logistikkosten pro BIP auf unter 10%.
(3) Städtischer öffentlicher Nahverkehr und verkehrsorientierte Stadtentwicklung (TOD). Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt müssen U-Bahn-Netzen, BRT-Systemen und Ringstraßen Priorität einräumen und dabei die TOD-Planung – die Stadtentwicklung rund um die Bahnhöfe – nutzen, um Infrastruktur und sozialen Wohnungsbau zu finanzieren.
(4) Digitale Infrastruktur und offene Daten. Digitale Infrastruktur ist die „Infrastruktur der Infrastruktur“. Investitionen in nationale Rechenzentren, Government Cloud Computing (GovCloud) und den Nationalen Digitalen Zwilling sind notwendig, um integrierte Daten zu Verkehr, Energie, Wasser und städtischen Gebieten zu verwalten. Alle Schlüsselprojekte müssen Building Information Modeling (BIM) anwenden. (BIM) für das Investitionslebenszyklusmanagement.
(5) Infrastruktur zur Hochwasservorsorge und zur Anpassung an den Klimawandel.
Priorität haben Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi, das Mekong-Delta und die Zentralküste. Resilienzstandards anwenden, Bau- und Naturschutzlösungen kombinieren und CO2-Zertifikate als ergänzendes Finanzierungsinstrument nutzen.
Umsetzungsmechanismus – Von der Entschlossenheit zur Handlungsfähigkeit
Eine Infrastrukturstrategie wird erst dann Realität, wenn ein ausreichend starker Umsetzungsmechanismus vorhanden ist.
Dementsprechend ist es möglich, ein nationales Schlüsselprojektportfoliomanagementbüro (Nationales PMO) einzurichten, ein öffentliches Dashboard-System zu betreiben und jedes Projekt nach dem „Ampelmodell“ (rot - gelb - grün) zu überwachen.
Die Optimierung des Kapitalmobilisierungsmechanismus hin zu modernen öffentlich-privaten Partnerschaften, einschließlich des Mechanismus der Wiederverwendung öffentlicher Vermögenswerte zur Reinvestition in neue Infrastruktur (Vermögensrecycling), des Mechanismus der Kombination von öffentlichem Kapital, ODA-Kapital und privatem Kapital (Blended Finance) sowie Formen von PPP und grünen Anleihen, um den finanziellen Spielraum für eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung zu erweitern.
Infrastruktur – ein Maß für die Regierungsführungsfähigkeit
Durchbrüche in der Infrastrukturentwicklung sind ein Test für die Organisations- und Managementkapazität eines Landes. Ein entwickeltes Land zeichnet sich nicht nur durch seine Wirtschaftskraft aus, sondern auch durch die Fähigkeit, Großprojekte termingerecht, in der erforderlichen Qualität und mit langfristiger Effizienz und Nutzen umzusetzen. Jede Brücke, jede U-Bahn-Linie, jedes Stromnetz und jede nationale Kennzahl zeugt von institutioneller Disziplin, Koordinationsfähigkeit und gesellschaftlichem Vertrauen.
Daher sind neben bahnbrechenden Infrastrukturprojekten auch institutionelle Durchbrüche (um rechtliche Beschränkungen zu beseitigen und flexible Investitionsmöglichkeiten zu schaffen) und Durchbrüche im Bereich der Humanressourcen (um ein Team von Ingenieuren, Experten und professionellen Projektmanagern zu haben) erforderlich.
Infrastrukturdurchbruch der Vision 2045
Wenn die Reform von 1986 eine Revolution der Wirtschaftsinstitutionen war, dann muss der 14. Kongress eine Revolution der Infrastrukturinstitutionen einleiten – eine Revolution des systemischen Denkens, der nachhaltigen Standards und der Umsetzungsfähigkeit.
Jeder Dollar an Infrastrukturinvestitionen muss hinsichtlich Systemeffizienz, nationaler Produktivität und des Wohlergehens der Bevölkerung bewertet werden. Wenn die Infrastruktur zur Lebensader des Landes wird, wird Vietnam bis 2045 über genügend Energie, Vernetzung und Widerstandsfähigkeit verfügen, um in eine Ära starker, moderner und nachhaltiger Entwicklung einzutreten.
In diesem Sinne möchte ich vorschlagen, den Absatz über Durchbrüche bei der Infrastrukturentwicklung im Entwurf des politischen Berichts des 14. Nationalkongresses anzupassen:
(3) Einen wesentlichen Durchbruch in der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur erzielen und dabei Synchronisierung, Modernität, Vernetzung und Nachhaltigkeit gewährleisten. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines multimodalen Verkehrsinfrastruktursystems nach dem Prinzip Korridore – Knotenpunkte – regionale Verbindungen, verbunden mit einer integrierten Planung von Land, Verkehr, Energie, Digitalisierung und Umwelt.
Priorisieren Sie Investitionen in (i) Energieinfrastruktur – Stromnetz – Speicherung und intelligente Steuerung; (ii) strategische Logistikkorridore und interregionale Logistikzentren; (iii) große städtische Infrastruktur mit öffentlichem Nahverkehr und verkehrsorientierten Entwicklungsmodellen (TOD); (iv) digitale Infrastruktur als Grundlage für Management, Governance und Innovation; (v) Infrastruktur zur Anpassung an den Klimawandel und zur Hochwasservorsorge in gefährdeten Gebieten.
Die Institutionen zur Kapitalmobilisierung sollen durch standardisierte öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), grüne Anleihen und CO2-Zertifikate optimiert werden, wobei Effizienz, Transparenz und nachhaltige Instandhaltungskapazitäten gewährleistet werden.
Ein nationales Projektportfoliomanagementbüro (Nationales PMO) soll eingerichtet werden, um den Investitionsfortschritt und die Qualität zu überwachen. Bis 2035 sollen konkrete Leistungsziele festgelegt werden, wie beispielsweise die Senkung der Logistikkosten auf das Niveau der ASEAN-4-Staaten, die Erhöhung des Anteils umweltfreundlicher Verkehrsmittel, die Sicherstellung einer stabilen Stromversorgung und einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur in städtischen Gebieten, um schrittweise ein grünes, digital resilientes Infrastrukturnetz als Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen.
Nguyen Si Dung
Quelle: https://baochinhphu.vn/gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-xiv-cua-dang-bai-2-dot-pha-phat-trien-ha-tang-khong-chi-tang-toc-dau-tu-ma-con-can-don-bay-the-che-102251031232724314.htm



![[Foto] Lam Dong: Bilder der Schäden nach einem mutmaßlichen Seeausbruch in Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)



![[Foto] Präsident Luong Cuong empfängt US-Kriegsminister Pete Hegseth](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)















































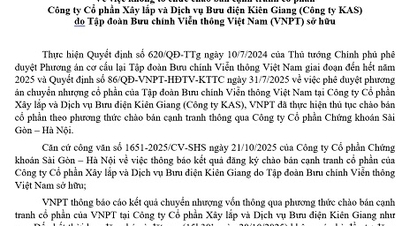







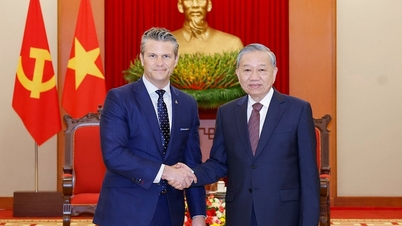
























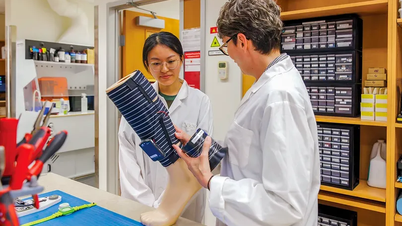















Kommentar (0)