SGGP
Höhere Temperaturen in der Arktis lassen den Permafrost auftauen und könnten Viren „erwecken“, die Zehntausende von Jahren im Ruhezustand lagen.
 |
| Ein uraltes Virus, isoliert aus einer Permafrostprobe |
Virus infiziert nach 30.000 Jahren
Beim Schmelzen des Eises könnten auch chemische und radioaktive Abfälle aus der Zeit des Kalten Krieges freigesetzt werden, die die Tierwelt bedrohen und Ökosysteme zerstören könnten. „Im Permafrost passieren viele Dinge, die Anlass zur Sorge geben, und das zeigt, warum wir so viel wie möglich davon erhalten müssen“, sagte Kimberley Miner, eine NASA- Klimawissenschaftlerin , die am California Institute of Technology Düsentriebwerke erforscht.
Permafrost bedeckt ein Fünftel der nördlichen Hemisphäre und bildet seit Jahrtausenden die Grundlage für die arktische Tundra und die borealen Wälder Alaskas, Kanadas und Russlands. Permafrost ist ein gutes Speichermedium, nicht nur weil er kalt ist, sondern auch, weil er eine sauerstofffreie Umgebung bietet, in die kein Licht eindringen kann. Doch die Temperaturen in der Arktis steigen mittlerweile viermal schneller als im Rest der Erde, was die oberste Permafrostschicht der Region schwächt.
Um das Risiko gefrorener Viren besser zu verstehen, untersuchte Jean-Michel Claverie, emeritierter Professor für Medizin und Genetik an der Universität Aix-Marseille im französischen Marseille, Bodenproben aus dem Permafrostboden Sibiriens in Russland, um festzustellen, ob diese Viren enthielten, die noch übertragbar sein könnten. Der Wissenschaftler sagte, er habe nach „Zombieviren“ gesucht und mehrere gefunden. Claverie untersuchte einen bestimmten Virentyp, die sogenannten Riesenviren, die er 2003 erstmals entdeckt hatte. Sie sind viel größer als normale Viren und können unter einem Lichtmikroskop statt unter einem stärkeren Elektronenmikroskop gesehen werden. 2014 belebte Claverie ein 30.000 Jahre altes Virus wieder, das er und seine Kollegen aus dem Permafrostboden isoliert hatten, und machte es durch Injektion in Zellkulturen infektiös. Sicherheitshalber untersuchte er ein Virus, das nur einzellige Amöben, nicht aber Tiere oder Menschen infizieren konnte.
Claverie wiederholte diesen Erfolg 2015, als er ein weiteres Virus isolierte, das ausschließlich Amöben infiziert. In der neuesten Studie, die am 18. Februar in der Fachzeitschrift Viruses veröffentlicht wurde, isolierten Claverie und seine Kollegen mehrere uralte Viren aus Permafrostproben von sieben verschiedenen Orten Sibiriens und zeigten, dass sie kultivierte Amöbenzellen infizieren konnten. Die neuesten Stämme repräsentieren fünf neue Virenfamilien, zusätzlich zu den beiden zuvor wiederbelebten. Die älteste Probe war, basierend auf der Radiokarbondatierung des Bodens, fast 48.500 Jahre alt.
Potentielle Bedrohung
Claverie sagte, das Virus, das Amöben nach einer langen „Winterruhe“ infiziert, sei ein Zeichen für ein größeres zugrunde liegendes Problem. Er befürchtete, dass seine Forschung als wissenschaftliche Kuriosität betrachtet und die Aussicht auf ein Wiederaufleben alter Viren nicht als ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit erkannt werden könnte. Birgitta Evengard, emeritierte Professorin für klinische Mikrobiologie an der Universität Umea in Schweden, sagte, eine bessere Überwachung des Risikos durch potenzielle Krankheitserreger im tauenden Permafrost sei notwendig, es dürfe jedoch keine Panik geben. Trotz ihrer 3,6 Millionen Einwohner ist die Arktis noch immer dünn besiedelt, sodass das Risiko einer menschlichen Exposition gegenüber alten Viren sehr gering ist. Mit der globalen Erwärmung werde das Risiko jedoch steigen.
Im Jahr 2022 veröffentlichte ein Wissenschaftlerteam eine Studie über Boden- und Seesedimentproben aus dem Lake Hazen, einem Süßwassersee in der kanadischen Arktis. Sie sequenzierten das genetische Material im Sediment, um Spuren des Virus und die Genome potenzieller Wirte in den Pflanzen und Tieren der Region zu identifizieren. Mithilfe eines Computermodells kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass das Risiko einer Ausbreitung des Virus auf neue Wirte in der Nähe von Orten, an denen große Mengen Gletscherschmelzwasser in den See fließen, höher ist – ein Szenario, das in einem wärmeren Klima wahrscheinlicher ist.
Das Wiederauftauchen uralter Mikroben könne die Bodenzusammensetzung und das Pflanzenwachstum verändern und so die Auswirkungen des Klimawandels beschleunigen, so Miner. Der beste Weg, so Miner, sei daher, das Tauwetter und die Klimakrise aufzuhalten und diese Gefahren für immer im Permafrost zu begraben.
Die Wissenschaftlerin Kimberley Miner hält es für unwahrscheinlich, dass sich Menschen direkt mit uralten Krankheitserregern aus dem Permafrost infizieren. Miner macht sich jedoch Sorgen um die sogenannten Methusalems, benannt nach der biblischen Figur mit der längsten Lebenserwartung. Sie könnten uralte Ökosystemdynamiken (die ständigen Veränderungen der Umwelt und ihrer biologischen Komponenten) in die heutige Arktis einschleppen – mit unvorhergesehenen Folgen.
[Anzeige_2]
Quelle



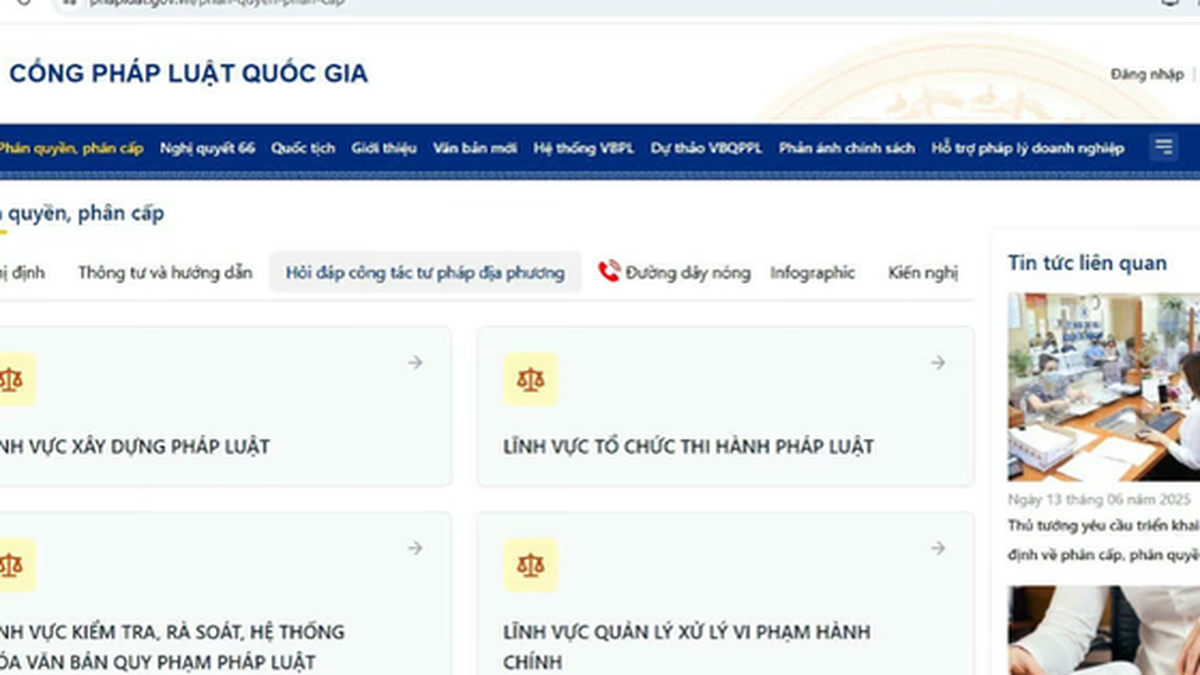

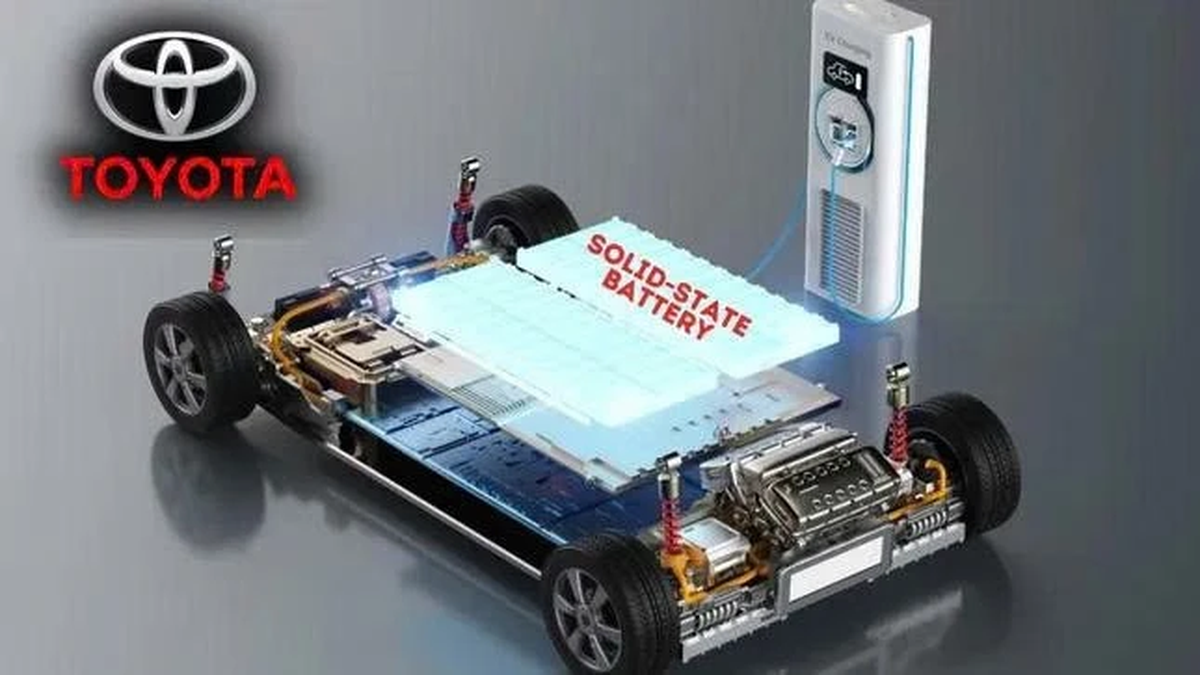



















![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, besucht die vietnamesische Heldin Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)







































































Kommentar (0)