(Zeitung Quang Ngai ) – Das Licht des Vollmonds strömte durchs Fenster und erhellte sanft den verwilderten Feldweg vor dem Haus. Die Frau rieb sich die Augen und blickte hinaus. Draußen glitzerte der Mond wie Honig auf dem Longan-Hain, der voller Früchte hing. Im Vogelkäfig hinter dem Haus gurrten und zwitscherten zwei Tauben zärtlich miteinander, wie frisch Verliebte.
Die Frau wandte sich ab, unterdrückte einen Seufzer und bückte sich, um den zerrissenen Saum ihres Kleides zu nähen. Immer wieder hielt sie inne und blickte zum Flussufer hinaus. Der Mond war blass, das Ufer still, als schliefe es. Ein markerschütterndes Heulen hallte von den Feldern darüber wider. Sie sah sich in dem kalten Zimmer um; das fünf Jahre alte Bett sah noch wie neu aus, nur ihr Kissen war abgenutzt und tief eingedrückt. Das Knarren von Termiten und Spinnweben nagte an der Tür, ein Geräusch, das sie so lange nicht weggefegt hatte. Nacht für Nacht schien das Knarren an ihrem Fleisch zu nagen und es zu zerfressen. Jede Nacht, unter dem gelben Licht der Lampe, spann die Spinne ihr Netz, klammerte sich an den dünnen Faden, schwankte hin und her, bevor sie plötzlich herabstieß und ihre Schulter berührte… Jedes Mal zuckte sie zusammen und wich zurück. Schließlich begriff sie, dass sie keine Angst vor der harmlosen Spinne hatte; Sie fürchtete die Leere, die jede Nacht an ihrem Körper nagte.
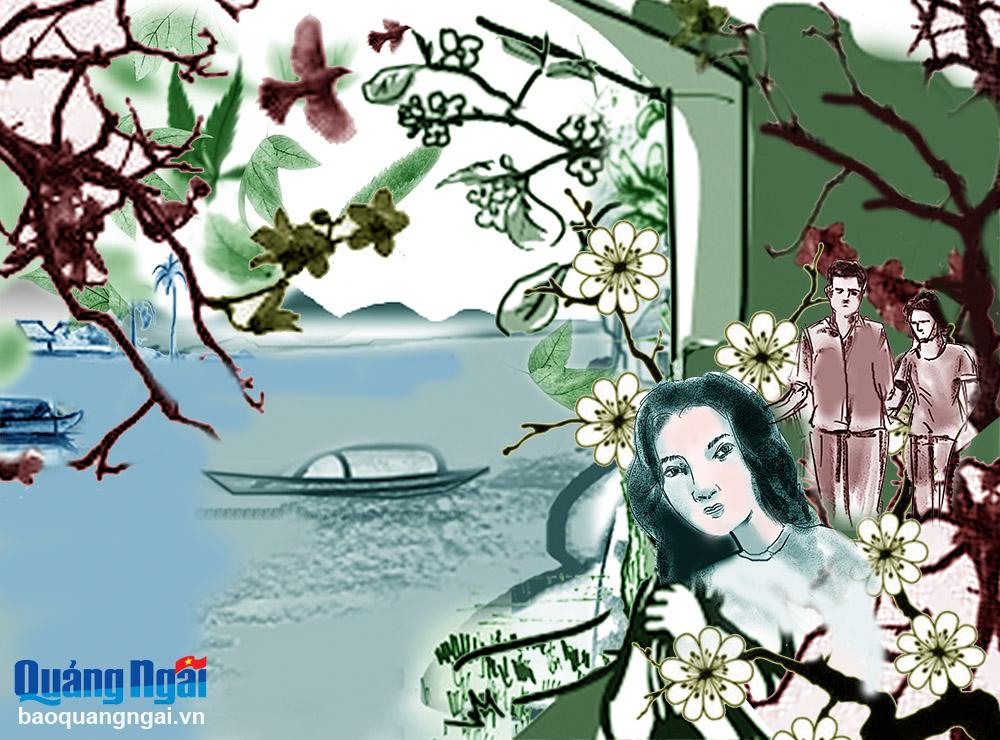 |
| MH: VO VAN |
Heute Abend erklingt wieder der Klang der Flöte am Flussufer. Seit über fünf Jahren schmerzt sie noch immer, wenn sie diesen eindringlichen Flötenklang hört, als hätte jemand mit einem Messer einen scharfen Schnitt gemacht. Nach den langen Reisen ihres Mannes warf er ihr stets einen abweisenden Blick zu, suchte nach einer Ausrede, aß schnell etwas, schnappte sich seine Flöte und ging zum Fluss…
An jenem Tag überquerten sie und ihr Mann den Fluss zur Gedenkfeier. Am Ende des Pfades, der am Kanal entlangführte, stand das Haus, in dem die Gestalt jenes Mädchens stand, das die Seele ihres Mannes über den Fluss getragen hatte. Am Ende des Pfades verlangsamte sie bewusst ihre Schritte und warf ihm einen verstohlenen Blick zu. Sein Gesicht war noch immer so ausdruckslos wie damals, als sie seine Frau geworden war, sein Blick stets in die Ferne gerichtet. Sanft zupfte sie an seinem Ärmel, ihre Stimme trocken und distanziert, wie damals, als sie auf der Veranda saß und Mücken verscheuchte: „Lass uns May und ihren Mann besuchen!“ Stille. Sie hörte ein Grunzen, und er ging wütend als Erster davon. Plötzlich überkam sie Wut auf sich selbst; wie konnte sie das wissen und trotzdem sprechen, den Schmerz kennend und doch daran festhaltend? Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sie seine Frau geworden war, an den Tag, an dem sie mit seiner Mutter zum Markt gegangen war, an die Frauen, die sie mit neugierigen, mitfühlenden Blicken angesehen hatten, und sie hatte vage die Worte „May“ gehört. May war seine verwaiste jüngere Schwester, die seine Mutter mit nach Hause gebracht hatte, als May erst ein Jahr alt war. Zwanzig Jahre lang war May seine Schwester gewesen; worüber sollte sie sich also Sorgen machen?
Er war oft fort, und sie blieb zu Hause, kümmerte sich um die Reisfelder und die Enten im Teich. Fünf Jahre Ehe, fünf Jahre des Wartens auf ihren Mann. Jedes Mal, wenn er zurückkehrte, ging er zum Fluss, seine Flöte stets an seiner Seite, und spielte bis zum Einbruch der Dunkelheit. Eines Nachts schlich sie sich unbemerkt an ihn heran. Leise rief sie: „Komm heim, mein Liebster!“, ihre Stimme so ergreifend, dass selbst der Wind ihn zu streicheln schien. Er drehte sich um, sein Gesicht noch immer mürrisch und ausdruckslos, und sah sie verwundert an. Wütend stand er auf und ging fort, und sie trottete ihm hinterher.
Viele Nächte lang, wenn sie seinen Schatten im späten Mondlicht betrachtete, wünschte sie sich, sein Herz wäre wie ein Stück Stoff, bereit, mit Nadel und Faden überall dort geflickt zu werden, wo es zerrissen war. Die Dorfbewohner erzählten, dass May, wenn sie ihrem Mann über den Fluss folgte, auf die Felder ging, um zwei Morgen Land zu hacken, und nachts seine Flöte zum Fluss trug. Die Intuition der Frauen ist wahrlich erstaunlich.
Vom Tag ihrer Ankunft im Haus ihres Mannes an sah sie in jeder seiner Mahlzeiten und jedem Schlaf das Bild einer anderen Frau. Selbst seine Schritte vor ihr schienen einen fernen, benommenen Ausdruck zu haben, als wäre er nach vielen Jahren der Trennung endlich wieder mit ihr vereint. Man sagt, Frauen seien seltsame Wesen; je mehr Schmerz sie empfinden, desto rücksichtsloser werden sie. Mittags saß er auf der Veranda und putzte sorgfältig seine Flöte, während sie im Zimmer stand und sich die Haare kämmte. Plötzlich rannte sie hinaus, kippte den Wasserkrug um, verschüttete den Inhalt und rollte ihn zum Bananenhain, wobei sie rief: „Stell den Krug beiseite, damit Platz ist! Wir haben einen Regenwassertank, warum ist der so vollgestellt?“ Bevor sie den Krug erreichen konnte, hörte sie ihn brüllen: „Lass ihn da für mich stehen!“
Sie erstarrte beim Anblick der roten Blutgefäße in seinen Augen und zuckte plötzlich zurück, als hätte sie jemand getreten. Ihre Mutter, die vom Markt zurückgeeilt war, hörte das Geschehene und flüsterte: „Lass es einfach liegen, Liebes. Mays alter Wasserkrug zu Hause sammelte früher Regenwasser zum Haarewaschen.“
Die Nacht war so schwer wie eine Hängematte. Sie war allein in dem eiskalten Zimmer, sein Hemd hing am Haken, das sie absichtlich nicht gewaschen hatte, doch selbst es konnte seinen Duft nicht mehr bewahren. Sie drückte das Kissen an ihre Brust und streichelte es sanft. Fünf Jahre waren vergangen, und sie war so dünn wie ein ausgetrockneter Fisch. Jeden Monat blickte sie auf ihren flachen Bauch und unterdrückte einen leisen Seufzer. Viele Nächte kam ihre Mutter ins Zimmer, ihre knochige Hand strich ihr über den dünnen Rücken, zitternd: „Warum ist es so lange her, mein Kind?“ Bevor sie die Frage beenden konnte, zog ihre Mutter ihr Hemd hoch und wischte sich die geröteten Augen: „Es ist meine Schuld, dass du jetzt leidest.“ Das genügte, um sie schluchzend in die Arme ihrer Mutter sinken zu lassen. Nur ihre Mutter wusste, dass sie in ihrer Hochzeitsnacht allein in dem eiskalten Zimmer gewesen war, während ihr Mann, betrunken, bis zum Morgengrauen durch die Docks geirrt war, sein Gesicht verstört, als hätte er gerade das Wertvollste in seinem Leben verloren.
Sein Blick ruhte noch immer auf dem Flussufer, und ihr Herz war noch immer voller banger Erwartung. Er war nach Hause zurückgekehrt, und schon am zweiten Tag hatte er seine Koffer gepackt und sich zur Abreise bereit gemacht. In dieser Nacht ging er nicht zum Fluss, und ihr Herz flatterte vor Hoffnung. Sie eilte in ihr Zimmer, um sich umzuziehen – oder besser gesagt, um ein neues Kleid, obwohl sie es vor drei Jahren gekauft und nie getragen hatte. Was nützte es, schöne Kleider zu tragen, wenn ihr Mann so lange fort war? Sie blickte in den zerbrochenen Spiegel an der Tür; die Schönheit einer Frau in ihren Dreißigern war noch da, wenngleich sie von einer verborgenen Traurigkeit gezeichnet war.
Das Glück einer Frau ist so gering; alles, was sie braucht, ist jemand, um den sie sich kümmern kann, jemand, den sie wertschätzen kann, jemand, auf den sie sich freuen kann, jemand, um den sie sich Sorgen machen kann, wenn er zu spät zum Abendessen kommt. Sie öffnete ihr langes, seidiges Haar, trat sanft näher und verscheuchte eine Mücke, die um sein Bein summte. Selbst nachdem die Mücke weggeflogen war, streichelte ihre Hand sie noch sanft. Er zuckte leicht zusammen und sah sie eindringlich an. Sie errötete, als ob sie eine heimliche Affäre hätte, als ob ihre Hände und Füße nicht füreinander bestimmt wären. Sie schüttelte ihr Haar, um ihr steifes Gesicht zu verbergen, und zwang sich zu einem Lächeln, das eher einer Grimasse glich. Er fragte kalt: „Warum bist du so lange wach? Arbeitest du heute Nacht auf den Reisfeldern?“ Sie unterdrückte einen bitteren Kloß im Hals, als hätte sie gerade eine Tasse Medizin getrunken, und verstand bitter, dass sein Herz noch immer bei der Arbeit am Fluss war.
Sie saß allein in dem feuchten, kalten Zimmer, die Katzen auf dem Dach miauten wie weinende Kinder. Das schwache gelbe Licht an der Wand flackerte. In ihrem Herzen war sein Bild verschwommen wie die Dämmerung. Seine Reisen wurden immer länger. Er ging fort, um allein zu sein. Und sie, in der Nacht, noch immer von Gefühlen überwältigt, zählte die Monate und Tage, sogar die gefallenen Blätter draußen vor dem Fenster.
Das zarte kleine Mädchen May, das ihre Mutter vor Jahren mit nach Hause gebracht hatte, wuchs an seiner Seite auf. Er erlebte Mays Verwandlung zur jungen Frau mit, von ihren anmutig geschwungenen Lippen bis zu ihren melancholischen Augen. Auch May erkannte in ihm, dem Mann, der stets mürrisch und wortkarg wirkte, eine tiefe, unerschütterliche Liebe. Mit drei Jahren wusste May bereits, dass sie am Tor auf die Rückkehr ihres älteren Bruders warten musste. Und mit zwanzig Jahren wartete May immer noch auf ihn, genau wie mit drei.
Ihr mütterlicher Instinkt sagte ihr, dass sie May jedes Mal mitnehmen würde, wenn sie ans Flussufer ging, und dass sie, wann immer sie einem freundlichen jungen Mann begegnete, versuchen würde, eine Ehe für die beiden zu arrangieren. In ihrem Herzen waren May und ihr Bruder wie Geschwister. Nachdem May fortgegangen war, war ihre Mutter traurig, aber auch erleichtert, als wäre eine schwere Last von ihr genommen worden. Am Tag der Hochzeit ihres Bruders atmete sie erleichtert auf, ohne sich die Folgen vorzustellen. Ihr Sohn war monatelang fort, und ihre Schwiegertochter verbrachte ihre Abende damit, auf den Fluss hinauszublicken, während ihr Herz verkümmerte. Die Mutter fühlte sich schuldig. Der eine Sohn, der den Fluss überquert hatte, verweilte und blickte zurück; der andere, der geblieben war, suchte Trost in unermüdlichen Reisen, kehrte nur nach Hause zurück, um nachts wieder an den Fluss zu gehen und sich vom Klang seiner Flöte auf die andere Seite tragen zu lassen; und ihre sanfte Schwiegertochter, die an ihrem Hochzeitstag so glücklich gelächelt hatte, war nun wie ein verwelktes Blatt…
Das Mondlicht verschwand hinter dem Fenster und warf ein fahles Licht in den kalten Raum. Hinter der Tür hörte man das Klicken des Geckos. Zitternd näherte sie sich der Truhe und faltete vorsichtig ein paar Kleidungsstücke in einen abgenutzten Beutel. Fünf Jahre – genug Zeit, damit jemand aufhört zu warten. Sie ging. Vielleicht würde er sich eines Tages befreien, wenn er erwachte und erkannte, dass ihn schmerzhafte Liebe seines Zuhauses beraubt hatte. Und sie würde die Scherben ihres Lebens zusammenfügen und sie mit duftenden Flicken flicken. Sie blickte in den zerbrochenen Spiegel; die Frau in ihren Dreißigern war immer noch sanft und anmutig, ihre Augen, obwohl traurig, leuchteten nun mit einem Schimmer Hoffnung…
Sie rannte über das Feld, ihre Füße flogen förmlich, und als sie aufblickte, sah sie plötzlich eine Mondsichel, die zu lächeln schien. Irgendwo erhob sich das melodische Zwitschern eines einsamen Nachtvogels, als hätte er nach langen Nächten endlich das Licht gefunden …
VU NGOC GIAO
VERWANDTE NACHRICHTEN UND ARTIKEL:
Quelle: https://baoquangngai.vn/van-hoa/van-hoc/202411/truyen-ngan-tieng-chim-le-dan-fa41f82/






































![[Foto] Zahlreiche Menschen bringen Weihrauch dar und besuchen die Ho-Chi-Minh-Gedächtniskirche.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/02/21/1771668099014_ndo_br_12-resize-7721-jpg.webp)










































































Kommentar (0)