Trotz der Kontroverse war die vor Hunderten von Jahren entwickelte türkische Schachmaschine auf der ganzen Welt berühmt.

Die Turk-Schachmaschine besteht aus einer Schaufensterpuppe und der darunterliegenden Maschinerie. Foto: Amusing Planet
Im späten 18. Jahrhundert schenkte der ungarische Erfinder Wolfgang von Kempelen der österreichischen Kaiserin Maria Theresia einen ungewöhnlichen Roboter. Anders als alle anderen automatisierten Maschinen der damaligen Zeit, die komplexe Aufgaben wie das Spielen eines Musikinstruments oder das Schreiben mit Feder und Tinte auf Papier ausführen konnten, besaß Kempelens Maschine eine menschenähnliche Intelligenz und war in der Lage, mit jedem menschlichen Gegner Schach zu spielen und ihn zu besiegen. Diese magische Maschine faszinierte über ein Jahrhundert lang Zuschauer in Europa und Amerika und spielte laut Amusing Planet gegen berühmte Persönlichkeiten wie Napoleon Bonaparte und Benjamin Franklin und besiegte sie.
Die Maschine, „Mechanical Turk“ genannt, bestand aus einem großen Schrank mit einer Reihe komplexer Maschinen, auf dem sich ein Schachbrett befand. Hinter dem Schrank saß eine hölzerne Schaufensterpuppe in osmanischem Gewand und mit Turban. Kempelen begann die Vorführung, indem er die Schranktür öffnete und das gesamte System aus Rädern, Zahnrädern, Hebeln und Uhrwerk enthüllte. Sobald das Publikum überzeugt war, dass nichts darin verborgen war, schloss Kempelen die Tür, drehte die Maschine mit einem Schlüssel und bat einen Freiwilligen, die Rolle des Gegenspielers des Türken zu übernehmen.
Ein Spiel beginnt damit, dass der Türke den ersten Zug macht. Er nimmt die Spielsteine mit der linken Hand auf, zieht sie auf ein anderes Feld und setzt sie dann wieder ab. Macht ein Gegner einen regelwidrigen Zug, schüttelt der Türke den Kopf und stellt die regelwidrige Figur auf ihr ursprüngliches Feld zurück. Versucht ein Spieler zu betrügen, wie Napoleon es 1809 gegen die Maschine tat, reagiert der Türke, indem er die Figur vom Brett nimmt und seinen nächsten Zug macht. Versucht der Spieler ein drittes Mal, die Regeln zu brechen, schwingt der Roboter seinen Arm über das Brett, wirft alle Spielsteine um und beendet das Spiel.
Spieler fanden Turks außergewöhnlich gutes Schachspiel und gewann regelmäßig Partien gegen erfahrene Spieler. Während einer Frankreichreise im Jahr 1783 spielte Turk gegen François-André Danican Philidor, den besten Schachspieler seiner Zeit. Obwohl Turk verlor, beschrieb Philidor es als „das anstrengendste Spiel, das er je gespielt hatte“.
Als der Schachroboter immer beliebter wurde, begannen Diskussionen über seine Funktionsweise. Manche glaubten, Kempelens Erfindung könne tatsächlich selbstständig Schach verstehen und spielen. Die meisten bezweifelten jedoch, dass es sich bei der Maschine um eine ausgeklügelte Fälschung handelte und die Bewegungen des Holzmanns von Kempelen selbst per Fernsteuerung mithilfe von Magneten oder Drähten oder zumindest von einem in einem Schrank versteckten menschlichen Bediener gesteuert wurden. Einer der lautstärksten Skeptiker war der britische Schriftsteller Philip Thicknesse, der eine Abhandlung zu diesem Thema mit dem Titel „Sprechende Menschen und autonome Schachroboter: Entdeckt und entlarvt“ verfasste. Thicknesse lieferte jedoch keine überzeugenden Beweise.
Kempelen starb 1804, und sein Sohn verkaufte den Türken und seine Geheimnisse an den bayerischen Musiker Johann Nepomuk Malzel. Malzel tourte mit dem Türken durch Europa und Amerika. Der berühmte Schriftsteller Edgar Allan Poe sah ihn in Aktion und verfasste eine ausführliche Analyse, in der er über die Funktionsweise des Automaten spekulierte. Er argumentierte, ein echter Automat müsse alle seine Spiele gewinnen und ein charakteristisches Spielmuster aufweisen, beispielsweise Züge innerhalb einer festgelegten Zeitspanne ausführen, was dem Türken nicht gelang. Poe schloss daraus, dass der Türke von einem Menschen bedient worden sein musste.
Nach Mazels Tod im Jahr 1838 wurde der Schachroboter von John Kearsley Mitchell, dem Leibarzt von Edgar Allan Poe und Bewunderer des Türken, gekauft. Er schenkte die Maschine dem Charles Willson Peale Museum in Philadelphia, wo sie völlig vergessen in einer Ecke stand, bis sie 1854 durch einen Brand zerstört wurde.
Der Schachroboter blieb über 50 Jahre lang ein Rätsel, bis Silas Mitchell, Sohn von John Kearsley Mitchell, in einer Artikelserie in The Chess Weekly die Funktionsweise des Türken enthüllte. Da der Türke bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, gab es laut Mitchell „keinen Grund, die Antwort auf dieses uralte Rätsel vor Amateurschachspielern zu verbergen“. Mitchell sagte, der Türke sei ein Trick eines geschickten Zauberers. In dem geräumigen Holzschrank bediente eine Person verschiedene Hebel, die die Puppe oben bewegten und Schach spielen ließen.
Der Maschinenführer kann den Bediener verbergen, da sich die Tür nur auf einer Seite zum Publikum hin öffnet, sodass er sich schnell hineinschleichen kann. An den Sockeln der Spielsteine sind kleine, aber starke Magnete angebracht, die einen entsprechenden Magneten in den Drähten unter dem Spielbrett und im Inneren der Box anziehen. So kann der Bediener in der Maschine verfolgen, welche Spielsteine sich wohin auf dem Spielbrett bewegen.
Kempelen und der spätere Besitzer des Türken, Johann Malzel, wählten geschickte Spieler aus, die die Maschine zu verschiedenen Zeiten heimlich bedienten. Als Malzel die Maschine 1809 Napoleon im Schloss Schönbrunn zeigte, bediente ein in Österreich geborener Deutscher namens Johann Baptist Allgaier den Türkenroboter von innen.
Im Jahr 1818 übernahm Hyacinthe Henri Boncourt, der französische Spitzenspieler, kurzzeitig die Rolle des Türken. Einmal, als Boncourt im Inneren des Automaten versteckt war, nieste er, und das Publikum hörte das Geräusch. Malzel war verwirrt und versuchte sofort, das Publikum abzulenken. Danach stattete Malzel den Türken mit mehreren Geräuschgeräten aus, um alle Geräusche zu unterdrücken, die vom Türken kommen könnten.
Als Malzel Turk zu einer Vorführung nach Amerika mitnahm, engagierte er den europäischen Schachmeister William Schlumberger als Bediener der Maschine. Einen Tag nach der Vorstellung sahen zwei Jungen, die sich heimlich auf dem Dach versteckt hatten, wie Schlumberger aus der Maschine kam. Am nächsten Tag erschien ein Artikel in der Baltimore Gazette, der den Vorfall aufdeckte. Sogar Edgar Allan Poe bemerkte, dass Schlumberger bei den Aufführungen stets fehlte, aber oft gesehen wurde, wenn Turk nicht spielte.
Trotz dieser Enthüllungen ließ die Faszination für den Schachroboter Turk in der breiten Öffentlichkeit nicht nach. Mehrere Wissenschaftler untersuchten und schrieben im 19. Jahrhundert über den Turk, und im späten 20. Jahrhundert erschienen zahlreiche weitere Bücher über den Turk. Der Turk inspirierte auch zahlreiche Erfindungen und Nachahmungen, wie zum Beispiel Ajeeb, einen Turk-Klon, den der amerikanische Tischler Charles Hooper 1868 schuf. Zu Ajeebs Gegnern zählten Harry Houdini, Theodore Roosevelt und O. Henry.
Als Edmund Cartwright den Türken 1784 in London sah, war er fasziniert und fragte sich, ob es „nicht schwieriger wäre, eine Maschine zu bauen, die Stoff weben kann, als eine, die alle notwendigen Züge dieses komplizierten Spiels ausführen kann?“ Innerhalb eines Jahres hatte Cartwright den Prototyp eines motorbetriebenen Webstuhls patentieren lassen.
Im Jahr 1912 baute Leonardo Torres y Quevedo aus Madrid den ersten echten Schachautomaten namens El Ajedrecista, der eine komplette Partie mit drei Figuren ohne menschliches Zutun spielen konnte. Es dauerte weitere 80 Jahre, bis Computer eine komplette Schachpartie spielen und die besten Spieler der Welt schlagen konnten.
An Khang (laut Amusing Planet )
[Anzeige_2]
Quellenlink








![[Foto] Schneckennudelgericht macht die Stadt Liuzhou in China berühmt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/56e738ed891c40cda33e4b85524e30d3)







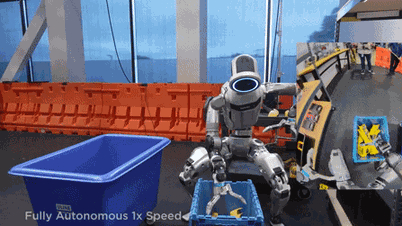













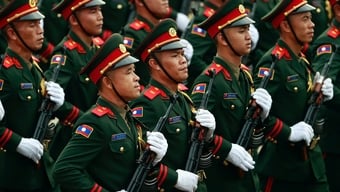

























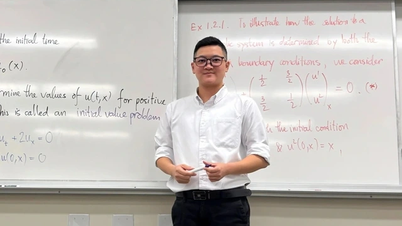













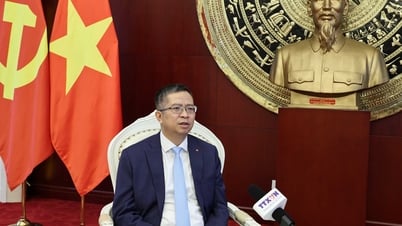































Kommentar (0)