 |
| Elektroautos des chinesischen Automobilherstellers XPENG werden auf einer Ausstellung in Stockholm, Schweden, ausgestellt. (Quelle: Xinhua) |
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die EU-Abgeordneten alarmiert, dass billige chinesische Elektroautos den Weltmarkt überschwemmen. Die europäische Autoindustrie habe Schwierigkeiten, wettbewerbsfähig zu bleiben, da Peking „enorme staatliche Subventionen“ anbiete, um die Preise für in Europa produzierte Elektrofahrzeuge zu senken.
Während sich der globale Preiskampf um Elektrofahrzeuge verschärft, könnte das Schicksal der deutschen Solarindustrie ein Beispiel dafür sein, was passieren könnte, wenn die EU die chinesische Herausforderung unterschätzt.
Laut DW wird die Solartechnologie vor allem in Europa – insbesondere in Deutschland – entwickelt. Die Solarindustrie in der „Lokomotive“ Europas wird staatlich gefördert. China habe dieses Modell jedoch schneller und günstiger übernommen.
Am 13. September gab die EU offiziell bekannt, dass sie eine Untersuchung über die Auswirkungen der Subventionspolitik Pekings auf die Dominanz der Hersteller von Elektrofahrzeugen auf dem europäischen Markt einleiten werde.
Anfang Mai hatte der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt, die 27 Mitgliedsstaaten dürften Peking „auf dem Markt für Elektrofahrzeuge – ebenso wie auf dem Markt für Solarmodule – keine freie Hand lassen“.
Elektroautos erhalten zu viele Subventionen
Kürzlich haben chinesische Hersteller von Elektroautos eine große Verkaufsoffensive für europäische Elektroautos angekündigt.
Laut Reuters verkauften die chinesischen Elektrofahrzeughersteller BYD, Nio und Xpeng in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 820.000 Fahrzeuge in Europa, was einem Anstieg von etwa 55 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Der Marktanteil chinesischer Elektrofahrzeughersteller in Europa stieg von 6 % im Jahr 2021 auf 13 % im Jahr 2023.
Die Europäische Kommission geht davon aus, dass der Anteil chinesischer Elektrofahrzeuge in Europa bis 2025 15 Prozent erreichen könnte, wenn das derzeitige Tempo beibehalten wird.
Bei vollelektrischen Fahrzeugen wird der Marktanteil chinesischer Hersteller in Europa laut dem französischen Automobilberatungsunternehmen Inovev im Jahr 2021 bei rund 4 %, im Jahr 2022 bei 6 % und ab Anfang 2023 bei 8 % liegen. Das Unternehmen prognostiziert zudem einen Anstieg dieses Anteils auf rund 12,5 bis 20 % bis 2030. Der jährliche Absatz dürfte zwischen 725.000 und 1,16 Millionen Fahrzeugen liegen.
„Der chinesische BYD Seal ist 15 Prozent günstiger als Teslas in Shanghai produziertes Model 3 und rund 35 Prozent günstiger als der in Deutschland produzierte VW ID.3. Diese Kosten sind nicht unbedingt auf chinesische Staatssubventionen zurückzuführen. Produktionseffizienz und die Versorgung mit Kernkomponenten könnten zum Kostenvorteil dieser Autos beitragen“, sagte Paul Gong, Autoanalyst bei UBS.
Herr Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), ist jedoch anderer Meinung.
Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte er, es gebe zahlreiche Beweise dafür, dass Peking die Automobilindustrie „auf eine Weise subventioniere, die mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) unvereinbar sei“.
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unterstütze die Automobilproduktion nicht nur durch direkte Subventionen, sondern auch „indirekte Subventionen durch die Förderung der Batterieindustrie und seltener Erden in verschiedenen Formen“, sagte Felbermayr.
Zwar ist es unstrittig, dass die chinesische Automobilindustrie in den Genuss hoher Subventionen kommt, doch das Gesamtbild ist komplizierter.
„Internationale Autohersteller wie BMW und Tesla produzieren in China Autos für den heimischen und den Weltmarkt. Diese Unternehmen erhalten von chinesischen Banken Vorzugskredite – etwas, das sie sonst nirgendwo bekommen“, erklärt Gregor Sebastian vom Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin.
Das chinesische Handelsministerium reagierte auf die Kommentare der EU und erklärte, die chinesischen Automobilhersteller hätten sich durch harte Arbeit und kontinuierliche technologische Innovation eine solide Position erarbeitet. Es forderte Brüssel auf, mit Peking zusammenzuarbeiten, um ein faires, diskriminierungsfreies und berechenbares Umfeld zu schaffen.
 |
| Die EU hat offiziell angekündigt, die Auswirkungen der Subventionspolitik Pekings auf Hersteller von Elektrofahrzeugen zu untersuchen. (Quelle: Reuters) |
Der Ursprung des Zollkriegs
Die französische Regierung hat versucht, die Situation zu entschärfen, indem sie vorschlug, eine Untersuchung einzuleiten und voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden.
Nach Angaben der in Peking ansässigen Anwaltskanzlei Zhong Lun beträgt die maximale Untersuchungsdauer eines EU-Antisubventionsverfahrens 13 Monate oder weniger. Daher müssen chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen ihre Lieferkettenanpassungen beschleunigen, wenn sie dem enormen Druck durch Antisubventionszölle entgehen wollen.
Derzeit betragen die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge in Europa 10 % und in den USA 27,5 %.
Die DW kommentierte, dass VW und BMW beim Export in die EU höhere Steuern zahlen müssten, wenn die EU Zölle auf Elektroautos aus China erhebe, was ihre Autos in Europa noch teurer machen würde.
Darüber hinaus unterstützen europäische Unternehmen auch ihre eigenen Autobauer. „Im ersten Quartal dieses Jahres flossen 40 Prozent der französischen Staatssubventionen für die Automobilindustrie in Autos aus chinesischer Produktion“, sagte MERICS-Analyst Sebastian.
Mit Blick auf die Zukunft befürchtet Gabriel Felbermayr vom WIFO, dass China, sollten die Antisubventionszölle der EU tatsächlich eingeführt werden, „sicherlich Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und der EU ähnliche Praktiken vorwerfen wird. Dies wird sich ähnlich auswirken wie im Airbus-Boeing-Streit, wo beide Seiten behaupten, im Recht zu sein.“
Der Bloomberg Opinion- Journalist Chris Bryant sagte , die europäischen Autohersteller sollten sich um die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bemühen, anstatt Vergeltungsmaßnahmen aus China „herauszufordern“.
Auf der Wirtschaftsseite forderte Stellantis-Chef Carlos Tavares, Brüssel solle die Unterstützung für einheimische Hersteller verstärken. Unternehmen, die stark vom Absatz in China abhängig sind – vor allem Volkswagen, BMW und Mercedes –, könnten weitere Verluste erleiden, wenn sich die Handelsbeziehungen zwischen China und der EU verschlechtern.
[Anzeige_2]
Quelle




























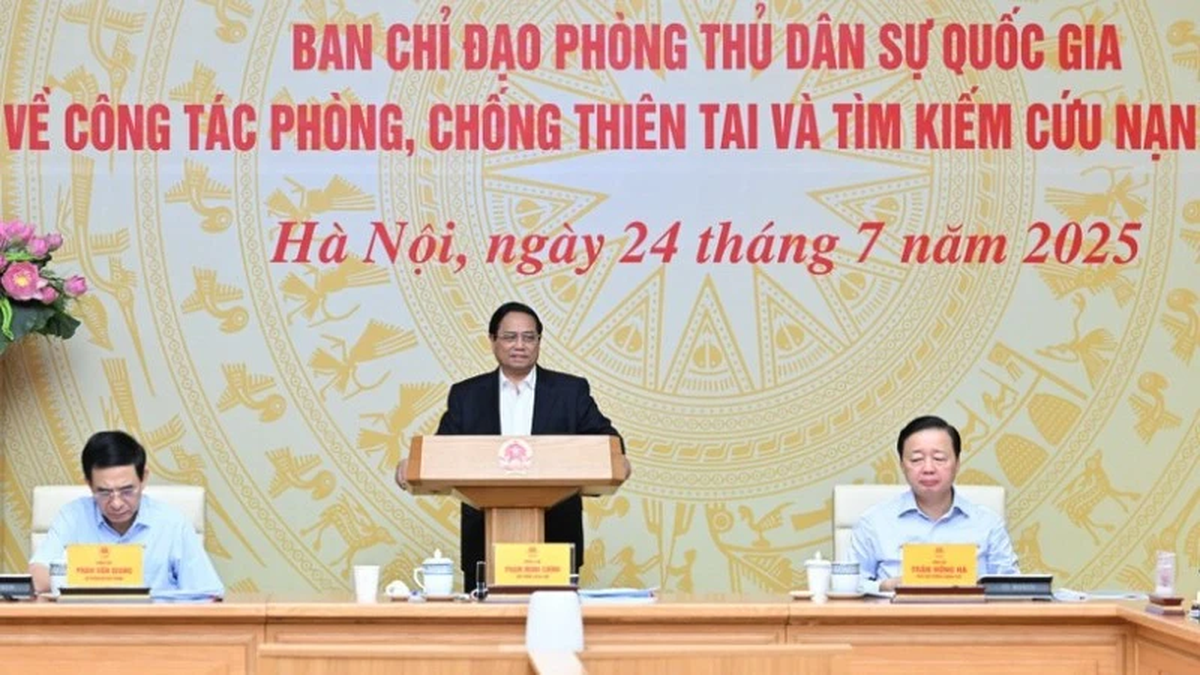
































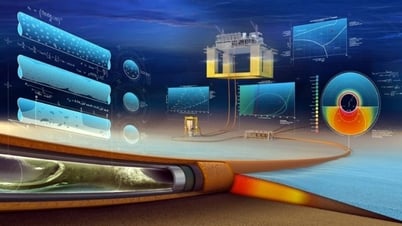




![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, empfängt den Vorsitzenden der marokkanisch-vietnamesischen Freundschaftsvereinigung](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/26/b5fb486562044db9a5e95efb6dc6a263)
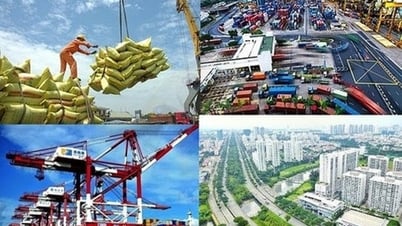





























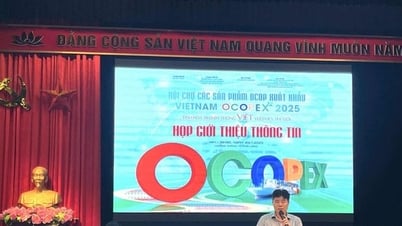






Kommentar (0)