
Der Wundheilungsprozess bei Menschen und Säugetieren verläuft zwar immer noch in den gleichen Schritten, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit – Illustration: KI
Das Verständnis der langsamen Heilung menschlicher Wunden könnte wichtige Anwendungsmöglichkeiten in der regenerativen Medizin, der Behandlung chronischer Wunden (wie diabetischen Geschwüren, Druckgeschwüren bei älteren Menschen) und sogar in der kosmetischen Medizin haben.
Menschliche Wunden heilen dreimal langsamer als Schimpansen
In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences veröffentlicht wurde, sagte ein internationales Wissenschaftlerteam , sie hätten die Wundheilungsraten bei verschiedenen Säugetieren verglichen, darunter Mäuse, Ratten, Anubispaviane, Sykes-Meerkatzen, Grüne Meerkatzen und Schimpansen.
Während die Wundheilungsraten dieser Arten relativ ähnlich sind, waren die Ergebnisse beim Menschen überraschend: Unsere Wunden heilen etwa dreimal langsamer als die von Primaten.
Um die Genesungsraten zu messen, fügten Wissenschaftler am Kenya Primate Research Institute mehreren betäubten Affen vier Zentimeter lange Wunden in den Körper.
Bei Schimpansen analysierten sie Fotos von natürlichen Wunden bei fünf Affen aus dem Kumamoto-Naturschutzgebiet in Japan. Bei Menschen überwachten sie den Wundheilungsprozess bei 24 Patienten, die sich am Universitätskrankenhaus Ryūkyū in Japan einer Operation zur Entfernung von Hauttumoren unterzogen hatten.
Die Ergebnisse zeigten, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Wundheilungsrate zwischen Primaten oder zwischen Primaten und Mäusen bzw. Ratten gab. Menschliche Wunden heilten jedoch deutlich langsamer, fast so, als handele es sich um ein evolutionäres Merkmal, das nur dem Menschen eigen ist.
Trotz der unterschiedlichen Geschwindigkeit verläuft die Wundheilung bei Menschen und Säugetieren in ähnlichen Schritten: Ein Blutgerinnsel bildet sich, um die Blutung zu stoppen, gefolgt von der Ankunft von Immunzellen wie Neutrophilen und Makrophagen, um Bakterien zu zerstören und nekrotisches Gewebe zu beseitigen.
Anschließend produzieren Fibroblasten Kollagen, den Hauptbestandteil des Bindegewebes, das zur Restrukturierung der Schäden beiträgt, während sich neue Kapillaren bilden, um die geschädigte Hautpartie mit Nährstoffen zu versorgen.
Einige Arten, wie Mäuse und Katzen, verfügen außerdem über einen Wundkontraktionsmechanismus, der die Wundränder wie eine Naht zusammenzieht und so die Heilung beschleunigt.
Entwickeln Sie sich dahingehend, dass Wunden langsamer heilen?
Aus evolutionsbiologischer Sicht ist die langsame Wundheilung paradox. Die Geschwindigkeit, mit der Wunden heilen, wirkt sich direkt auf die Überlebensfähigkeit eines Organismus aus, insbesondere in der freien Natur, wo ständig das Risiko einer Infektion oder eines Raubtiers besteht.
Das Team vermutet jedoch, dass sich beim Menschen nach der Abspaltung von seinem gemeinsamen Vorfahren mit Schimpansen vor etwa 6 Millionen Jahren möglicherweise eine langsame Wundheilung entwickelt hat.
Eine Hypothese geht von einer veränderten Struktur der menschlichen Haut aus: Eine höhere Schweißdrüsendichte führte zu einer Abnahme der Haardichte, wodurch die Haut stärker der Umwelt ausgesetzt und anfälliger wurde. Um dies auszugleichen, entwickelte sich eine dickere Haut, die zwar besser geschützt war, aber auch den Heilungsprozess verlangsamte.
Darüber hinaus ermöglichten das komplexe Sozialleben und die Fähigkeit, Heilkräuter, Verbände und Wundpflege anzuwenden, unseren Vorfahren möglicherweise das Überleben und die Fortpflanzung, selbst als die Wundheilung langsamer verlief.
Die Forscher betonten jedoch, dass weitere Forschung nötig sei, um die genetischen, zellulären, morphologischen und fossilen Datenfaktoren, die an der Entwicklung der Wundheilungsraten beim Menschen beteiligt sind, besser zu verstehen.
Quelle: https://tuoitre.vn/tai-sao-vet-thuong-cua-con-nguoi-lai-lau-lanh-hon-dong-vat-20250502085153813.htm

















































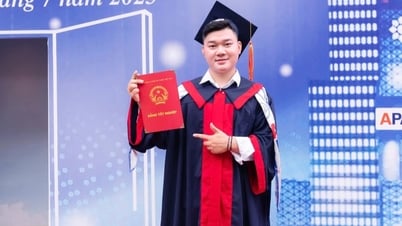



















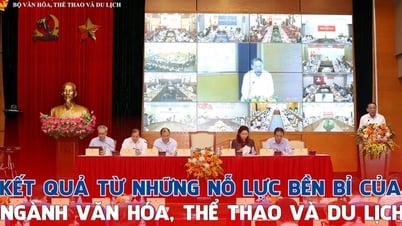

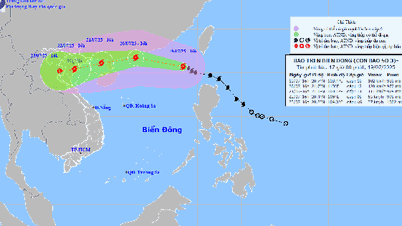

























Kommentar (0)