Europa „sitzt auf dem Feuer“
Die Verhandlungen zwischen den USA und Russland könnten dazu führen, dass Europa seine Position in der Ukraine-Frage verliert und damit seine eigene Sicherheit gefährdet. Während sich Europa zuvor als unverzichtbare Konfliktpartei positionierte, wächst nun die Gefahr, dass es außen vor bleibt. Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Frage – von den Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine über einen 30-tägigen Waffenstillstand bis hin zum Telefonat zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Präsidenten, in dem ein 30-tägiger Waffenstillstand für die ukrainische Energieinfrastruktur vereinbart wurde – tragen deutlich die Handschrift der US-amerikanischen Pendeldiplomatie .
Europa hat in den letzten Tagen aufgrund einer Reihe geschäftiger diplomatischer Ereignisse unter Spannung gestanden. Am 20. März trafen sich europäische Staats- und Regierungschefs sowie Militärs aus der Region getrennt, um einen langfristigen Plan zur Befriedung der Ukraine zu besprechen. Rund 30 Militärführer aus Ländern, die an der Überwachung eines dauerhaften Waffenstillstands in der Ukraine interessiert sind, trafen sich nördlich von London. Gleichzeitig trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) in Brüssel, um Sicherheitsfragen, insbesondere die Fortsetzung der Hilfe für die Ukraine, zu erörtern und die jüngsten Entwicklungen sowie den US-Waffenstillstandsvorschlag zu bewerten.
In einem weiteren Schritt wählte der neue kanadische Premierminister Mark Carney unmittelbar nach seinem Amtsantritt Frankreich und Großbritannien als seine ersten Auslandsziele und ignorierte damit sein Nachbarland. Am 17. März bekräftigte Carney in Paris gegenüber dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sein Land werde „immer und in jeder Hinsicht die Sicherheit Europas gewährleisten“. Die Staatschefs beider Länder versprachen, dass Kanada und Frankreich die Ukraine als „Friedenstruppe“ unterstützen werden.
Bei ihrem zweiten Besuch in Großbritannien bekräftigten der kanadische Premierminister Mark Carney und sein gastgebender Amtskollege Keir Starmer ihr Engagement für engere und effektivere Beziehungen zwischen Kanada und Großbritannien. Bei Gesprächen in der Downing Street 10 betonte Premierminister Keir Starmer, dass Großbritannien und Kanada Verbündete und engste und beständigste Partner seien. Beide Staatschefs waren sich einig, dass die Partnerschaft zwischen Kanada und Großbritannien auf der Geschichte, gemeinsamen Werten und dem Commonwealth basiert; beide Länder wünschen sich eine Stärkung dieser Beziehungen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer fördern derzeit aktiv die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. Sie erklärten sogar, die westlichen Verbündeten seien nicht verpflichtet, Russland um Zustimmung zu einer solchen Mission zu bitten, da die endgültige Entscheidung „bei der souveränen Ukraine“ liege. Laut dem französischen Präsidenten könnte dies beispielsweise die „Entsendung Tausender Soldaten aus beiden Ländern an wichtige Ausbildungsorte“ und die „Demonstration der langfristigen Unterstützung des Westens“ für die Ukraine beinhalten.
Es ist noch zu früh, über die Bildung eines neuen transatlantischen Bündnisses zu sprechen, doch angesichts der Spannungen zwischen den USA und ihren NATO-Partnern beginnen sich kleine Blöcke und Interessenclubs zu bilden. Es gibt bereits französisch-britische und anglo-polnische Militärbündnisse, und weitere bilaterale Mechanismen wie das französisch-kanadische und das anglo-kanadische Bündnis dürften entstehen.
Solche Entwicklungen liegen im Interesse der neuen US-Regierung. Präsident Donald Trump hat keinen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, die Last der eigenen Verteidigung auf die Europäer abzuwälzen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat seinen Wunsch geäußert, über einen gemeinsamen europäischen Rahmen für die nukleare Verteidigung zu diskutieren. Dies gilt als eines der wichtigsten Zeichen für einen historischen Wandel in der europäischen Sicherheitsvision. Die Europäer haben sich entschieden, eigene Vorschläge zu unterbreiten, anstatt ihrem wichtigsten Verbündeten, den USA, zu folgen.
Ist Europa verloren?
Die Frage ist jedoch: Streben die europäischen Länder strategische Autonomie an oder setzen sie sich aufgrund ihrer Meinungsverschiedenheiten mit den USA einer möglichen Entfremdung aus? Erstens ist die Entstehung eines stärkeren und strategisch unabhängigeren Europas durchaus möglich, doch muss man sich darüber im Klaren sein, dass dies mehr Ressourcen, Anstrengungen und Zeit erfordern wird. Gleichzeitig steht Europa vor einer Reihe von Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass die Zollpolitik der Trump-Regierung das europäische Wirtschaftswachstum negativ beeinflusst. Das BIP der EU dürfte bis 2026 um 0,3 % sinken, wenn die 10-20-prozentigen Zölle eingeführt werden. Darüber hinaus könnte der neue Zollkrieg zwischen den USA und China auch exportabhängige Volkswirtschaften wie Deutschland ernsthaft treffen. Analysten zufolge betrachtet die US-Regierung die Zölle als Verhandlungsmasse, während die Möglichkeit ähnlicher Vergeltungsmaßnahmen unwahrscheinlich ist. Dies würde zu einem deflationären Schock führen, einer globalen Fragmentierung, die dem handelsabhängigen Europa langfristig schaden würde.
Steigende Gaspreise werden auch 2025 eine der größten Herausforderungen für Europa bleiben. Für Deutschland, dessen Wirtschaft im wichtigsten verarbeitenden Gewerbe mit einem anhaltenden Abschwung konfrontiert ist, prognostizieren Ökonomen ein Wachstum von lediglich 0,4 Prozent im Jahr 2025 und 1 Prozent im Jahr 2026 – ein Rückgang um jeweils 0,3 Prozentpunkte pro Jahr. Auch für Frankreich wurden die Prognosen nach unten korrigiert, während für Spanien ein etwas schnelleres Wachstum als bisher prognostiziert erwartet wird.
Zweitens haben die europäischen Staats- und Regierungschefs stets innere Einheit und Solidarität angestrebt, aber nie erreicht. Der jüngste EU-Gipfel ist der deutlichste Beweis dafür. Laut Politico vom 21. März schlug die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, einen Plan vor, der die Ukraine in diesem Jahr mit 40 Milliarden Euro Militärhilfe unterstützen soll. Dieser Plan scheiterte jedoch nach dem Ende des EU-Gipfels in Brüssel. Das Hauptproblem war der fehlende Konsens unter den EU-Mitgliedsstaaten. Einige Länder, wie Ungarn, legten ihr Veto ein, während andere angesichts ihrer explodierenden Staatsverschuldung zögerten, das Hilfspaket zu unterstützen.
Drittens wäre auch der Plan, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden, schwierig. Moskau könnte die Friedenssicherung erst nach einer Einigung erörtern. Sollten sich die Parteien einig sein, dass das „Friedenspaket“ internationale Unterstützung benötigt, ergäbe sich ein Diskussionsthema. Möglich wären unbewaffnete Beobachter, eine zivile Mission zur Überwachung der Umsetzung bestimmter Aspekte des Waffenstillstands oder Garantiemechanismen.
Die Entsendung europäischer Friedenstruppen in die Ukraine wird in der aktuellen Kriegslage jedoch auf heftigen Widerstand Russlands stoßen. Es besteht die Gefahr eines direkten Konflikts zwischen Russland und Europa. Ein solches Szenario wollen die europäischen Länder nicht. Dafür gibt es viele Gründe, vor allem die Angst vor einem nuklearen Vergeltungsschlag. Doch selbst in einem konventionellen Krieg können europäische Taktiken und Waffen nicht garantieren, dass der Block die Oberhand über Russland gewinnt. Die Lage wird für Europa noch schwieriger, wenn sich die Trump-Regierung in diesem Fall wahrscheinlich aus dem Spiel zurückziehen wird.
Angesichts der Risiken einer Konfrontation mit Russland sind nicht alle europäischen Länder bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. So erklärte der italienische Außenminister Antonio Tajani am 17. März bei einem Treffen in Brüssel, Rom sei gegen die Entsendung von Truppen zu NATO- oder EU-Missionen. „Wir könnten dies tun, wenn es mit Zustimmung des UN-Sicherheitsrats eine UN-Mission in der Pufferzone gäbe. Aber jetzt wollen wir erst einmal den Krieg beenden und dann sehen, was passiert“, wurde der italienische Außenminister von der Iswestija zitiert. Auch Berlin sprach sich gegen eine vorzeitige Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine aus. Die Initiative von Paris und London wurde von der Slowakei, Finnland und Kroatien nicht unterstützt.
HUNG ANH (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/tu-chu-chien-luoc-hay-la-su-co-don-lac-long-nbsp-243302.htm








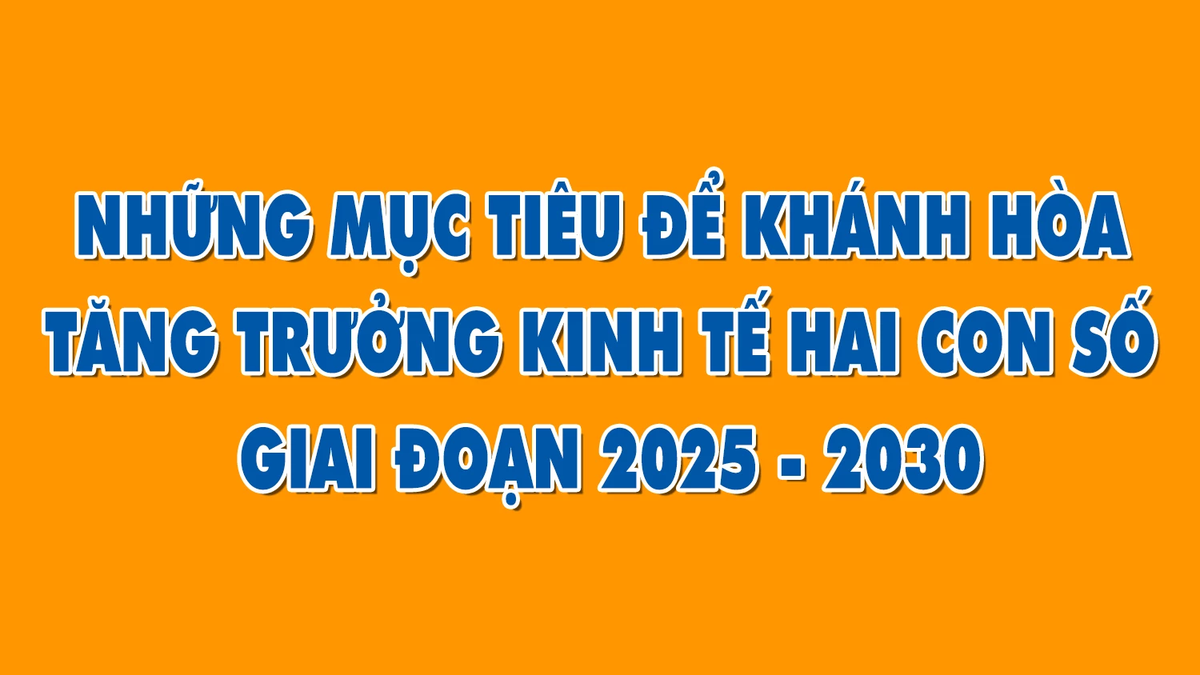
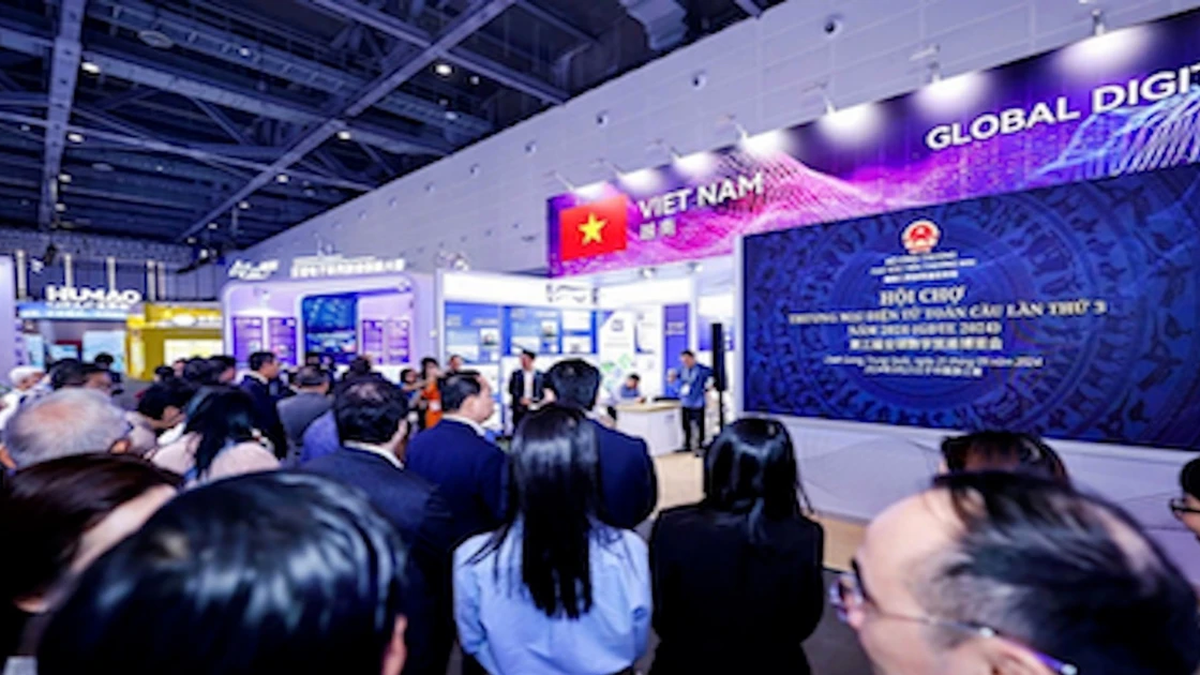



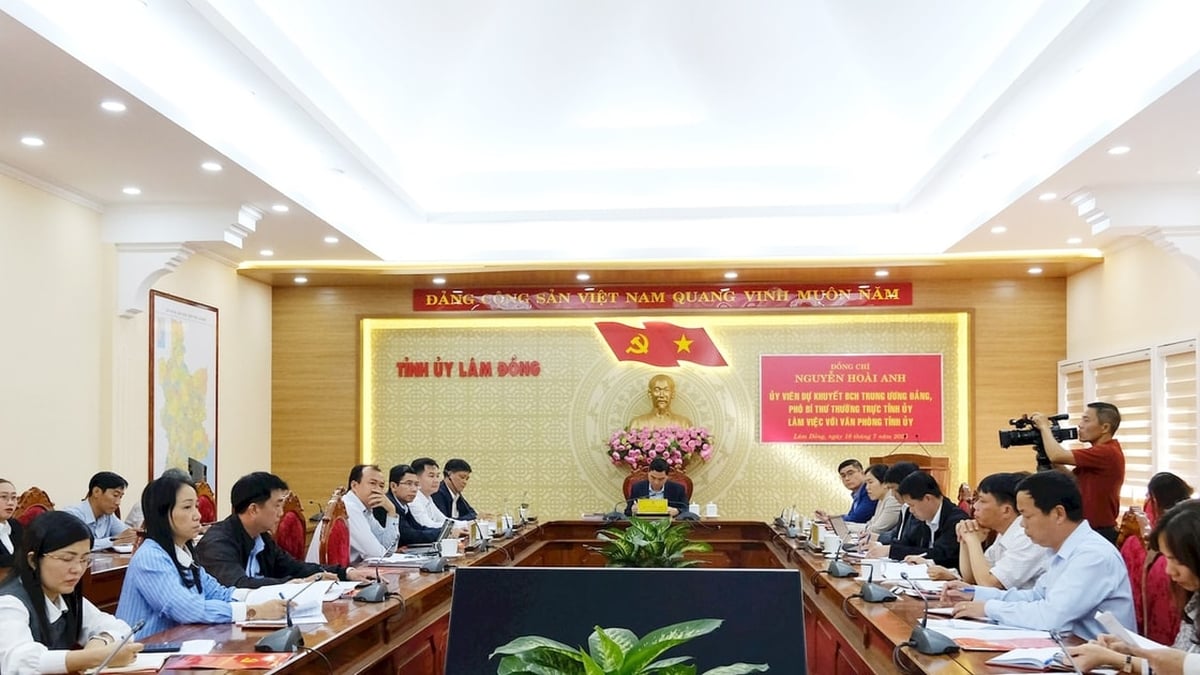

































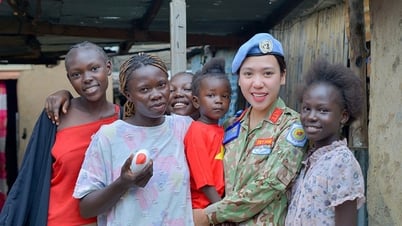






![[Maritime News] Mehr als 80 % der weltweiten Containerschifffahrtskapazität liegen in den Händen von MSC und großen Schifffahrtsallianzen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)


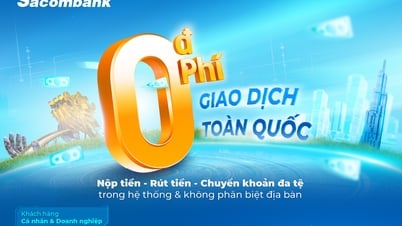














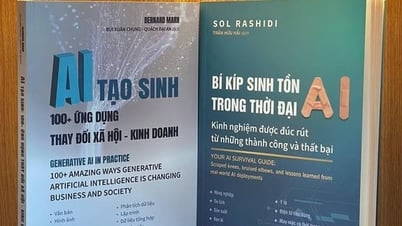

























Kommentar (0)