SGGP
Einem kürzlich von der Welthandelsorganisation (WTO) veröffentlichten Bericht zufolge wird der Welthandel im Jahr 2023 voraussichtlich um 1,7 % wachsen, nach 2,7 % im Jahr 2022.
 |
| Der Hafen von Taicang in der Provinz Jiangsu in Ostchina ist im März 2023 geschäftig. Foto: XINHUA |
Fokus auf multilateraler Zusammenarbeit
Das weltweite Handelsvolumen könnte 2023 trotz eines leichten Anstiegs der BIP-Prognosen seit letztem Herbst hinter den Erwartungen zurückbleiben, so WTO- Ökonomen in dem Bericht. Sie schätzten das globale reale BIP-Wachstum (zu Marktwechselkursen) im Jahr 2023 auf 2,4 Prozent. Die Prognosen für das Handels- und Produktionswachstum von 2,6 Prozent bzw. 2,7 Prozent lagen beide unter ihren Durchschnittswerten der letzten zwölf Jahre.
WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala erklärte, der Handel sei weiterhin eine treibende Kraft für die globale wirtschaftliche Erholung, werde aber auch 2023 unter dem Druck externer Faktoren stehen. Daher müssten Regierungen konsequent handeln und Maßnahmen vermeiden, die den Handel einschränken oder behindern. Laut Ngozi Okonjo-Iweala werde die Konzentration auf die multilaterale Zusammenarbeit im Handelsbereich, wie sie die WTO-Mitglieder auf der 12. Ministerkonferenz im Juni 2022 taten, das Wirtschaftswachstum und den Lebensstandard der Menschen langfristig fördern.
Gleichzeitig wurde die Prognose für das Handelswachstum im Jahr 2023 auf 1,7 % angehoben, verglichen mit der 1-%-Prognose der WTO in ihrem im Oktober 2022 veröffentlichten Bericht. Ein wichtiger Faktor für den Anstieg der Prognose ist Chinas Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Dies trägt dazu bei, die aufgestaute Verbrauchernachfrage im Land freizusetzen und so den internationalen Handel anzukurbeln.
Seien Sie sich der finanziellen Risiken bewusst
Die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 und die zunehmenden geopolitischen Spannungen belasten Handel und Produktion im Jahr 2022 maßgeblich und könnten laut WTO-Chefökonom Ralph Ossa auch 2023 spürbar sein. Steigende Zinsen in den Industrieländern haben zudem zu Schwächen im Bankensystem geführt, die, wenn sie nicht eingedämmt werden, zu einer allgemeinen finanziellen Instabilität führen könnten. Regierungen und Regulierungsbehörden müssen diese und andere Finanzrisiken in den kommenden Monaten im Auge behalten.
In einem Bericht, der für die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank nächste Woche erstellt wird, warnen IWF-Experten, dass die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die daraus resultierende Fragmentierung der Weltwirtschaft die Risiken für die Finanzstabilität weiter erhöhen, ausländische Investitionen verringern und die Vermögenspreise, Zahlungssysteme und die Kreditvergabekapazität der Banken schwächen würden.
Der IWF warnt seit langem vor steigenden Kosten, Wirtschaftskonflikten und einem sinkenden BIP im Zusammenhang mit der Fragmentierung der Weltwirtschaft entlang geopolitischer Blöcke. In seinem neuen Bericht weist er jedoch auf das Risiko zunehmender Spannungen hin, die zu einer Flucht ausländischen Kapitals, einschließlich Direktinvestitionen, führen könnten. Besonders hoch sei dieses Risiko in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Die politischen Entscheidungsträger sollten die Krisenreaktionsmechanismen stärken, indem sie die Koordination zwischen zentralen und lokalen Behörden sicherstellen. Die Länder sollten zudem regionale Sicherheitsnetze stärken, etwa durch Währungsumtauschsysteme oder Kreditlinien internationaler Institutionen wie dem IWF.
Das Handelswachstum dürfte sich im Jahr 2024 wieder auf 3,2 % erholen, während das BIP auf 2,6 % steigt. Diese Schätzung ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da erhebliche Risiken bestehen, darunter geopolitische Spannungen, Unsicherheiten bei der Nahrungsmittelversorgung und die potenziellen unvorhergesehenen Risiken einer Straffung der Geldpolitik.
[Anzeige_2]
Quelle


![[Foto] Konferenz des Ständigen Ausschusses des Regierungsparteikomitees und des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Nationalversammlung zur 10. Tagung der 15. Nationalversammlung](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/15/1760543205375_dsc-7128-jpg.webp)

![[Foto] Viele Deiche in Bac Ninh wurden nach der Zirkulation des Sturms Nr. 11 erodiert](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/15/1760537802647_1-7384-jpg.webp)


![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt am 18. Parteitag in Hanoi (Legislaturperiode 2025–2030) teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760581023342_cover-0367-jpg.webp)




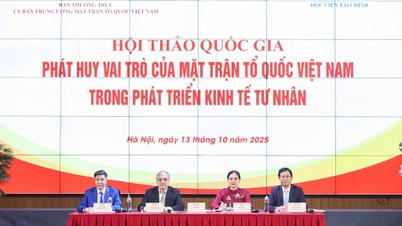














![[Video] TripAdvisor würdigt viele berühmte Sehenswürdigkeiten von Ninh Binh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760574721908_vinh-danh-ninh-binh-7368-jpg.webp)



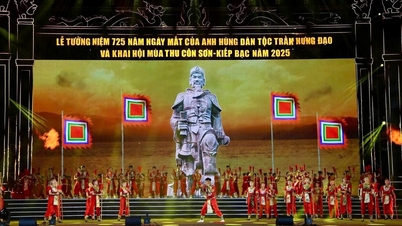




































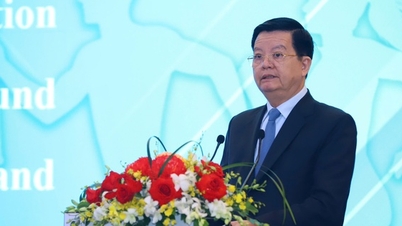





























Kommentar (0)