Gegen den Trend gehen?
Mit dem Eintritt in das Zeitalter künstlicher Intelligenz und Hightech-Industrien wird die zukünftige globale Wirtschaftskraft wahrscheinlich vom Zugang zu effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher Energie abhängen. Die jüngsten politischen Entscheidungen der USA scheinen diesem Trend jedoch entgegenzuwirken.
Die US-Regierung hat sich deutlich von erneuerbaren Energien zurückgezogen und viele Subventionen für saubere Energien gekürzt oder ganz gestrichen. Dies spiegelt die strategische Überzeugung wider, dass die USA ihre globale Energieposition durch die weitere Nutzung heimischer fossiler Brennstoffe behaupten können. Viele argumentieren jedoch, dass dies langfristig eine Fehlkalkulation sein könnte.
Fehlende Investitionen in saubere Energien bringen die USA nicht nur ins Hintertreffen bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien wie Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Solarenergie, sondern bergen auch die Gefahr, dass die Stromkosten im Inland steigen. Da andere Volkswirtschaften, insbesondere China, die globale Lieferkette für saubere Energie dominieren, könnten die USA in energieintensiven Branchen wie der Herstellung von KI-Chips, Rechenzentren und der Robotik einen Wettbewerbsnachteil erleiden.
Zwillingsdefizite und das Paradox der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der USA
Obwohl die Trump-Regierung darauf abzielt, die strategische und wirtschaftliche Autonomie Amerikas zu stärken, führt die aktuelle Steuer- und Handelspolitik zu einem Paradoxon: Sie verstärkt die Abhängigkeit der US-Wirtschaft von ausländischem Kapital.
Ein klares Beispiel ist der kürzlich verabschiedete Haushaltsentwurf, der bei Finanzanalysten Besorgnis ausgelöst hat. Reuters zitierte Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) und erklärte, der Plan könnte das Haushaltsdefizit des Bundes im nächsten Jahrzehnt um 3,4 Billionen Dollar erhöhen und es jahrelang auf dem hohen Niveau von 6 bis 7 Prozent des BIP halten. Gleichzeitig ist auch das Leistungsbilanzdefizit der USA gestiegen und erreichte im ersten Quartal 2025 6 Prozent des BIP – ein Niveau, das viele Experten als systemisches Warnsignal werten.
Die Kombination aus Haushaltsdefizit und Leistungsbilanzdefizit, das sogenannte „Zwillingsdefizit“, bedeutet, dass die Vereinigten Staaten weiterhin auf internationales Kapital angewiesen sind, um ihre öffentlichen Ausgaben und ihren Inlandskonsum zu finanzieren. Der Zugang zu diesem Kapital wird jedoch immer schwieriger, da andere Wirtschaftszentren dazu neigen, ihre Ressourcen im Inland neu auszubalancieren.
In Europa könnten die erhöhten Verteidigungsausgaben, die im nächsten Jahrzehnt fünf Prozent des BIP erreichen sollen, die Investitionsmöglichkeiten im Ausland, insbesondere in US- Staatsanleihen , beeinträchtigen. Zwar hat die EU im Rahmen eines kürzlich geschlossenen Handelsabkommens zugesagt, ihre Energieeinkäufe aus den USA zu erhöhen, doch ist ein Großteil der Vereinbarung noch vorläufig, und das geplante Transaktionsvolumen gilt als unrealistisch.
Gleichzeitig fördert Asien intraregionale Handelsstrategien und diversifiziert seine Exporte, wodurch die Abhängigkeit vom US-Markt schrittweise abnimmt. Die Länder der Region neigen zudem dazu, mehr Kapital für strategische Infrastruktur- und Industrieinvestitionsprogramme zurückzuhalten.
Sollten sich diese Trends fortsetzen, könnten die USA mit höheren Kreditkosten, steigendem Inflationsdruck und der Gefahr einer Abwertung des US-Dollars konfrontiert werden – Faktoren, die ihre globale Finanzlage direkt bedrohen.
Der tripolare Devisenblock: Der stille Wandel, der das globale Währungssystem umgestaltet
Der Trend zur Regionalisierung von Lieferketten, der durch die COVID-19-Pandemie deutlich eingeleitet und durch protektionistische Wirtschaftspolitiken wie „America First“ beschleunigt wurde, stellt einen Wendepunkt in der globalen Wirtschaftsstruktur dar. Alle Großmächte legen nun aus Gründen der nationalen Sicherheit Wert auf regionale Eigenständigkeit, insbesondere beim Zugang zu strategischen Rohstoffen wie Seltenen Erden und kritischen Mineralien. Das Ergebnis ist eine bewusste Fragmentierung der Globalisierung, und dieser Trend legt den Grundstein für die Bildung regionaler Devisenblöcke in Asien, Europa und Amerika.
In Europa drängen politische Entscheidungsträger auf einen autonomeren finanzpolitischen Rahmen. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), beschrieb kürzlich die Vision eines „globalen Euro-Moments“, unterstützt durch Pläne für eine Europäische Spar- und Investitionsunion. Ziel ist die Schaffung eines Finanzökosystems, das tiefgreifend und liquide genug ist, um sowohl sichere Anlagen, vergleichbar mit US-Staatsanleihen, als auch die Möglichkeit zur Finanzierung von Innovation und Infrastruktur innerhalb der Union zu bieten. Obwohl der US-Anleihenmarkt laut Weltwirtschaftsforum immer noch dreimal so groß ist wie der europäische, könnte es erhebliche Auswirkungen haben, einen größeren Anteil der Investitionsströme innerhalb der Region zu halten.
Europas Leistungsbilanzüberschuss lag in den letzten Jahren durchschnittlich bei rund 400 Milliarden Dollar pro Jahr, und die Region investiert jährlich rund 300 Milliarden Dollar in ausländische Finanzanlagen. Würden diese Mittel umverteilt, um die innere Stärke der Region zu stärken, könnte die Position der USA als Finanzzentrum erheblich geschwächt werden.
In Asien verfolgt China eine andere Strategie mit ähnlichen Zielen. Pan Gongsheng, Gouverneur der People’s Bank of China, betonte kürzlich seinen Wunsch nach einer größeren Rolle des Renminbi im globalen Finanzsystem. Während Chinas Kapitalbilanz weitgehend geschlossen bleibt, wächst der Spielraum für regionale Transaktionen in Renminbi rasant und ersetzt allmählich die traditionelle Rolle des Dollars im regionalen Handel.
Darüber hinaus unternimmt China erhebliche Reformanstrengungen, um ausländischen Investoren den Zugang zu seinen inländischen Kapitalmärkten zu erleichtern und gleichzeitig kontrollierte Kapitalabflüsse zu fördern. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie Deflation und einem Überangebot an erneuerbaren Energien reagiert Peking mit konsumorientierten Konjunkturprogrammen. Diese Maßnahmen könnten das Vertrauen der Anleger in langfristiges Wachstum stärken und mehr internationales Kapital anziehen.
Während Europa und Asien zunehmend auf regionale Haushaltsautonomie und eine geringere Abhängigkeit vom Dollar setzen, laufen die USA Gefahr, ihren globalen Einfluss zu verlieren. Die Aufrechterhaltung eines doppelten Haushalts- und Leistungsbilanzdefizits, gepaart mit einer lockeren Finanzpolitik und zunehmend einseitigen geopolitischen Strategien, könnte den Dollar langfristig schwächen.
Obwohl der US-Dollar dank der Größe und Liquidität der US-Finanzmärkte auch heute noch dominiert, wird dieses Monopol durch strukturelle Veränderungen, wie etwa die Umleitung intraregionaler Investitionen nach Europa oder die Kommerzialisierung lokaler Währungen in Asien, allmählich untergraben.
Hung Anh (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/dong-usd-va-trat-tu-tien-te-dang-doi-thay-256903.htm
































































































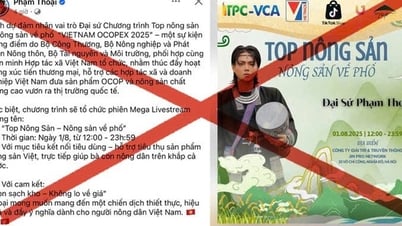





Kommentar (0)