Ihre Mission besteht nicht darin, Menschen zu schützen, sondern das wertvollste Gut unserer Zeit: Daten.
Inmitten der ruhigen Landschaft der englischen Grafschaft Kent umgibt ein drei Meter hoher Stacheldrahtzaun einen riesigen Grashügel. Kaum jemand würde vermuten, dass 30 Meter unter der Erde ein hochmodernes Cloud-Computing-Zentrum betrieben wird.
Dies war einst ein Atombunker, der in den 1950er Jahren als Kommandozentrale für das Radarnetzwerk der Royal Air Force gebaut wurde, wo Soldaten gebannt vor den Bildschirmen saßen und nach Anzeichen sowjetischer Bomber Ausschau hielten.
Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges, wird es von der Cyberfort Group als hochsicheres Rechenzentrum betrieben.
Anthropologisch gesehen setzen diese Einrichtungen eine lange Tradition der Menschheit fort: Die wertvollsten Dinge werden unter der Erde aufbewahrt, so wie unsere Vorfahren Gold, Silber und Juwelen in Grabhügeln vergraben haben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Schätze dieser Ära die Zahlen 0 und 1 sind.
Cyberfort ist nicht allein. Überall auf der Welt wird das Erbe des Kalten Krieges wiedergeboren.
Alte Luftschutzbunker in China, verlassene sowjetische Kommandozentralen in Kiew und Bunker des US- Verteidigungsministeriums wurden allesamt als „undurchdringliche“ Datenspeicherorte neu verpackt.

In der chinesischen Provinz Guizhou wird derzeit ein Rechenzentrum von Tencent gebaut (Foto: Wired).
Sogar Minen und Höhlen werden wiederverwendet, wie beispielsweise der Komplex der Mount10 AG – „Swiss Fort Knox“ tief in den Alpen oder das Arctic World Archive (AWA) in Norwegen.
Waren Atombunker architektonische Spiegelbilder der Angst vor der Vernichtung, so zeugen die heutigen Datenbunker von einer neuen existenziellen Bedrohung: der erschreckenden Aussicht auf Datenverlust.
Daten – die Goldmine der Ära
Tech-Experten bezeichnen Daten als „Goldmine“ – eine Metapher, die durch die Tatsache, dass Daten in verlassenen Minen gespeichert werden, noch anschaulicher wird. Mit dem steigenden Wert der Daten steigt auch die Angst vor ihrem Verlust.

Die dicke Stahltür außerhalb des Cyberfort-Bunkers (Foto: Wired).
Für Einzelpersonen bedeutet dies den Verlust von Erinnerungen und wertvoller Arbeit. Für Unternehmen und Regierungen kann ein schwerwiegender Datenverlust die Entwicklung und die nationale Sicherheit gefährden.
Beispiele hierfür sind die jüngsten Cyberangriffe auf Jaguar, Marks & Spencer und der Ransomware-Vorfall, der TravelEx in den Bankrott trieb. Angesichts der Aussicht auf einen „Weltuntergang“ durch Datenverlust wenden sich Unternehmen an diese Schutzräume.
Im Empfangsbereich des Cyberfort-Bunkers ist hinter einer Glasvitrine ein Betonzylinder ausgestellt, der die fast meterdicken Bunkermauern sichtbar macht. Seine Robustheit steht im krassen Gegensatz zur heiteren Metapher der Datenwolke.
Die Wahrheit ist, dass es keine „Cloud“ gibt, sondern nur Maschinen. Wenn Daten in die „Cloud“ hochgeladen werden, werden sie an Server gesendet, die sich in Gebäuden befinden, die als Rechenzentren bezeichnet werden.
Diese physischen Infrastrukturen bilden das Rückgrat nahezu aller Aktivitäten in der modernen Gesellschaft: von Kreditkartenzahlungen, Transport, Gesundheitsversorgung, nationaler Sicherheit bis hin zum Senden einer E-Mail oder Ansehen eines Films.
„Die meisten Menschen denken nur an Cybersicherheit – Hacker, Viren – und ignorieren den physischen Aspekt“, sagt Rob Arnold, Chief Digital Officer bei Cyberfort. „Herkömmliche Rechenzentren werden schnell gebaut und sind nicht darauf ausgelegt, Bomben oder Diebstahl standzuhalten.“
Angesichts geopolitischer Spannungen wird die Internetinfrastruktur zu einem begehrten Ziel.
„Kunden werden die Apokalypse vielleicht nicht überleben, aber ihre Daten werden es“, fasst Rob zusammen.
Der Eingang zum Bunker ist eine schwere Stahltür, die einer thermonuklearen Explosion standhält. Drinnen ist die Luft kühl und muffig; um tiefer zu gelangen, muss man durch eine Metallschleuse gehen und dann eine Stahltreppe hinabsteigen.
Angesichts unsichtbarer Datenströme wirken diese Explosionsschutztüren und Betonwände antiquiert. Doch das wäre ein Fehler.
Stellen Sie sich die „Cloud“ als ein Haus vor, in dem alle unsere digitalen Vermögenswerte gespeichert sind. Egal wie sicher sie ist, sie befindet sich immer noch auf der Erde und kann von der realen Welt beeinflusst werden.

Die explosionssichere Tür des Cyberfort-Bunkers, in dem sich das Serversystem des Rechenzentrums befindet (Foto: Wired).
Es kann zu Einbrüchen kommen, Naturkatastrophen wie Hurrikans können eintreten, oder es können auch kleinere Risiken wie das Anknabbern von Kabeln durch Tiere auftreten. Wenn dieses „Haus“ versagt und auch nur für wenige Minuten nicht mehr funktioniert, sind die finanziellen Folgen enorm und können sich auf Millionen von Dollar belaufen.
Die Vorfälle mit Cloudflare, Fastly, Meta und CrowdStrike im Jahr 2024 sind Paradebeispiele für diese Fragilität.
Auch die Geographie ist äußerst wichtig. Die Ansiedlung eines Rechenzentrums in einem bestimmten Land hilft Kunden, die dortigen Gesetze zur Datenhoheit einzuhalten. Entgegen der ursprünglichen Illusion eines grenzenlosen Internets verändert die Geopolitik die „Cloud“.
Als sich die letzten Explosionsschutztüren des Cyberfort-Bunkers öffneten, wurde der Serverraum – das Herz der Festung – sichtbar.
Hunderte von Servern sind ordentlich in Racks gestapelt und surren in einer streng kontrollierten Umgebung, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Um diese optimalen Bedingungen aufrechtzuerhalten, verbrauchen Rechenzentren enorme Mengen an Energie und Wasser. Weltweit machen sie etwa 1 % des gesamten Strombedarfs aus – mehr als der Verbrauch mancher Länder.
Inmitten des KI-Wahns, der den Bau immer energiehungrigerer Rechenzentren vorantreibt, wird das Internet langsam als „größte kohlebetriebene Maschine der Welt“ bezeichnet. Trotz der Bemühungen, erneuerbare Energien zu nutzen, ist die Realität klar: Die Datenerhaltung um jeden Preis hinterlässt einen enormen CO2-Fußabdruck.
Ewiges Erbe oder Lebensschuld?
„Der Bunker ist wie die Pyramide auf Langlebigkeit ausgelegt“, sagte Richard Thomas, Sicherheitschef von Cyberfort.

Serverraum im Cyberfort-Bunker (Foto: Wired).
Der Vergleich ist tiefgreifend. Der Bunker ist so konzipiert, dass sein Inhalt durch die Zeit transportiert wird. Ebenso machen Technologiegiganten wie Apple und Google Cloud-Speicher zu einem lebenslangen Service.
Sie raten den Benutzern, ihre Daten zu archivieren, anstatt sie zu löschen, da sie dadurch an immer teurere Abonnements gebunden werden.
Der Speicherplatz auf den Geräten wird immer kleiner, sodass die Nutzer auf die „Cloud“ angewiesen sind. Und wer sich einmal für einen Anbieter entschieden hat, kann nur schwer wechseln.
Nutzer werden zu digitalen Hamsterern, die an Dienste gebunden sind, die ihnen nicht wirklich gehören. Viele Tech-Experten argumentieren, dass, wenn wir Daten wirklich als Gold betrachten, Nutzer vielleicht für deren Speicherung bezahlt werden sollten, und nicht umgekehrt.
Das Überleben der Daten – ob in Tresoren oder „lebenslangen“ Cloud-Konten gespeichert – hängt von der Marktvolatilität, der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur und den dahinter stehenden Organisationen ab.
Quelle: https://dantri.com.vn/cong-nghe/hoi-sinh-di-san-thoi-chien-tranh-lanh-thanh-cac-trung-tam-du-lieu-20250928194557290.htm



![[Foto] Der Präsident der kubanischen Nationalversammlung besucht das Mausoleum von Präsident Ho Chi Minh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/1/39f1142310fc4dae9e3de4fcc9ac2ed0)


![[Foto] Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Lagers in allen Situationen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/1/3eb4eceafe68497989865e7faa4e4d0e)
![[Foto] Hanoi am Morgen des 1. Oktober: Anhaltende Überschwemmungen, Menschen waten zur Arbeit](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/1/189be28938e3493fa26b2938efa2059e)

























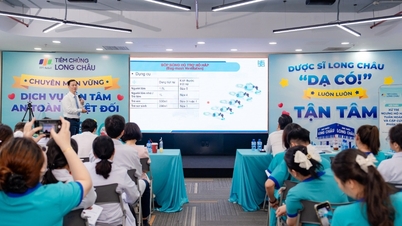
















































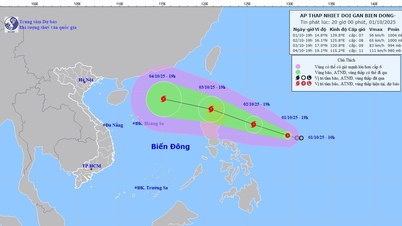















Kommentar (0)