Einflussbereich bedeutet nicht Kontrolle
Anders als im klassischen Hegemonialmodell kann Russland seine Nachbarn nicht mehr vollständig kontrollieren wie zu Sowjetzeiten. Sein Einfluss ist jedoch weiterhin durch vier Hauptachsen spürbar:
(1) Das Bildungssystem , das Recht, die Sprache und das administrative Denken tragen in vielen Ländern noch immer den russischen/sowjetischen Stempel.
(2) Die russischen, ethnisch russischen und postsowjetischen Diaspora-Gemeinschaften schaffen weiterhin informelle transnationale Einflusskanäle.
(3) Infrastruktur- und wirtschaftliche Sicherheitsabhängigkeiten: Insbesondere in den Bereichen Energie, Verkehr und Verteidigung.
(4) Strategien der harten und weichen Macht: Von militärischer Präsenz (wie in Armenien, Belarus, Tadschikistan) bis hin zu Instrumenten der weichen Einflussnahme durch Medien und Kultur.
Einfluss bedeutet jedoch nicht automatisch Vertrauen. Im Gegenteil, die Furcht vor Russlands Absichten wächst mit der historischen und geografischen Nähe. Länder mit engeren Verbindungen zu Russland versuchen zunehmend, ihre Handlungsoptionen durch Kooperation mit der Türkei, China, dem Westen oder sogar multilateralen Organisationen wie den BRICS-Staaten zu erweitern.
Analysten zufolge ist ein besonderes Merkmal des russischen Falls das Phänomen der „nahen Supermacht“. Anders als die USA, die geografisch isoliert sind und keine starken Nachbarn haben, teilt Russland eine lange Grenze mit vielen kleinen, schwachen, aber oft misstrauischen Staaten. Dies führt zu einer besonderen strategischen Spannung: Kleine Staaten fühlen sich stets durch eine mögliche Intervention bedroht, während Russland sich von der Absicht umgeben sieht, sich zurückzuziehen und mit dem Ausland zu kooperieren.
Die Befürchtung rührt nicht nur von der Geschichte, sondern auch von der Realität her: Russland hat in Georgien (2008) und der Ukraine (seit 2022) militärische Gewalt angewendet und maßgeblichen Einfluss auf den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ausgeübt. Daher kann Moskau, so gut seine Absichten auch sein mögen, seine Nachbarn kaum davon überzeugen, ein „normaler Partner“ zu sein.
Russland verfügt nicht über leicht zu verteidigende natürliche Grenzen wie die USA oder Großbritannien. Angesichts offener kontinentaler Grenzen und der Ausdehnung über viele instabile Regionen kann die Sicherheit nicht allein mit militärischen Mitteln gewährleistet werden, sondern muss auf soziopolitischem Einfluss im umliegenden Raum beruhen.
Gleichzeitig verhindert die ethnisch-soziale Struktur Russlands die Errichtung einer vollständigen Barriere. Eine Abkopplung vom postsowjetischen Raum würde nicht nur einen geopolitischen Zerfall bedeuten, sondern auch die Gefahr einer internen Fragmentierung bergen – mit Russen, Tataren, Dagestanern, Baschkiren, Tschetschenen oder zentralasiatischen Migranten, die ein Netz grenzüberschreitender Verbindungen bilden würden, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich. Dies ist nicht nur eine Sicherheitsfrage, sondern auch eine Frage des Fortbestands der Russischen Föderation.
Von Asymmetrie zu sanfter Balance
Die türkische Präsenz im Kaukasus und in Zentralasien kann Russlands traditionelle Rolle nicht in den Schatten stellen, aber sie genügt, um kleineren Ländern in Verhandlungen mit Moskau ein gewisses Druckmittel zu verschaffen. Dies ist ein typisches Beispiel für eine Strategie des „sanften Balancing“: Man konfrontiert die Zentralmacht nicht direkt, sondern versucht, die strategischen Optionen durch die Einbindung dritter Akteure zu erweitern.
Die Türkei ist jedoch nicht der einzige Akteur. In den letzten zehn Jahren haben die zunehmend sichtbare Präsenz und der Einfluss der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union (EU) und insbesondere Chinas die Machtstrukturen im postsowjetischen Raum verändert. Während die Vereinigten Staaten sich auf Militärhilfe, Ausbildung und Sicherheitskooperation mit Ländern wie Georgien, der Ukraine, Moldau und einigen baltischen Staaten konzentrieren, vor allem um Russlands militärstrategischen Einfluss einzudämmen, investiert die EU massiv in institutionelle Reformen, Infrastruktur und Handel, insbesondere im Rahmen der „Östlichen Partnerschaft“ – einem weichen, aber langfristigen Mechanismus zur schrittweisen Integration von Ländern wie der Ukraine, Moldau und Georgien in den europäischen Raum, nicht geografisch, sondern hinsichtlich ihres operativen Modells.
China verfolgt einen anderen Ansatz: vor allem durch Wirtschaftsmacht und strategische Investitionen, insbesondere in Zentralasien. Peking hat eine direkte Konfrontation mit Russland vermieden, aber seinen Einfluss durch die Neue Seidenstraße, Energieprojekte und die wachsende Rolle der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) ausgebaut.
Das Ergebnis ist ein postsowjetischer Raum, der nicht länger Russlands exklusiver Einflussbereich ist, sondern sich zu einer multipolaren Arena des Wettbewerbs um Einfluss entwickelt hat. Die Länder der Region, insbesondere kleine und verwundbare, bemühen sich zunehmend um eine Diversifizierung ihrer Partner – nicht um Russland abzuschneiden, sondern um absolute Abhängigkeit zu vermeiden. Dadurch wird das Beziehungsnetzwerk in der Region vielschichtiger und komplexer denn je: Russland ist nicht mehr der alleinige Dreh- und Angelpunkt, bleibt aber eine unverzichtbare Achse. Die Länder der Region versuchen, ihren strategischen Spielraum zu erweitern, ohne die Beziehungen zu Moskau vollständig abzubrechen. Neue Verbindungen zu China, der Türkei, der EU oder den USA sind taktischer und flexibler Natur und dienen oft als Instrumente, um in größeren strategischen Kreisen Verhandlungsmacht zu erlangen.
In diesem Kontext wird die Diplomatie zum zentralen Instrument, und jede außenpolitische Lösung erfordert Einfallsreichtum unter Berücksichtigung interregionaler und langfristiger Folgen. Einseitige oder einseitige Lösungen sind selbst für eine Macht wie Russland nicht mehr möglich.
Es ist offensichtlich, dass der postsowjetische Raum in den letzten Jahren komplexer geworden ist. Russlands Einfluss wird fortbestehen, seine Kontrolle hat jedoch abgenommen. Jede wirksame Außenpolitik in der Region muss auf einem tiefen Verständnis der Unsicherheiten kleiner Staaten, der Offenheit des geografischen Raums und der Grenzen der russischen Staatsstruktur selbst beruhen. Langfristige Stabilität kann nur erreicht werden, wenn Russland von einer Denkweise der „Einflusssicherung“ zu einer Denkweise des „Beziehungsmanagements“ übergeht, in der sich Macht nicht durch Zwangsmittel, sondern durch Verlässlichkeit als regionaler Partner ausdrückt.
Hung Anh (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/khong-gian-hau-xo-viet-va-nghich-ly-anh-huong-cua-nga-253898.htm






![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt den Präsidenten der kubanischen Nachrichtenagentur für Lateinamerika.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)
































































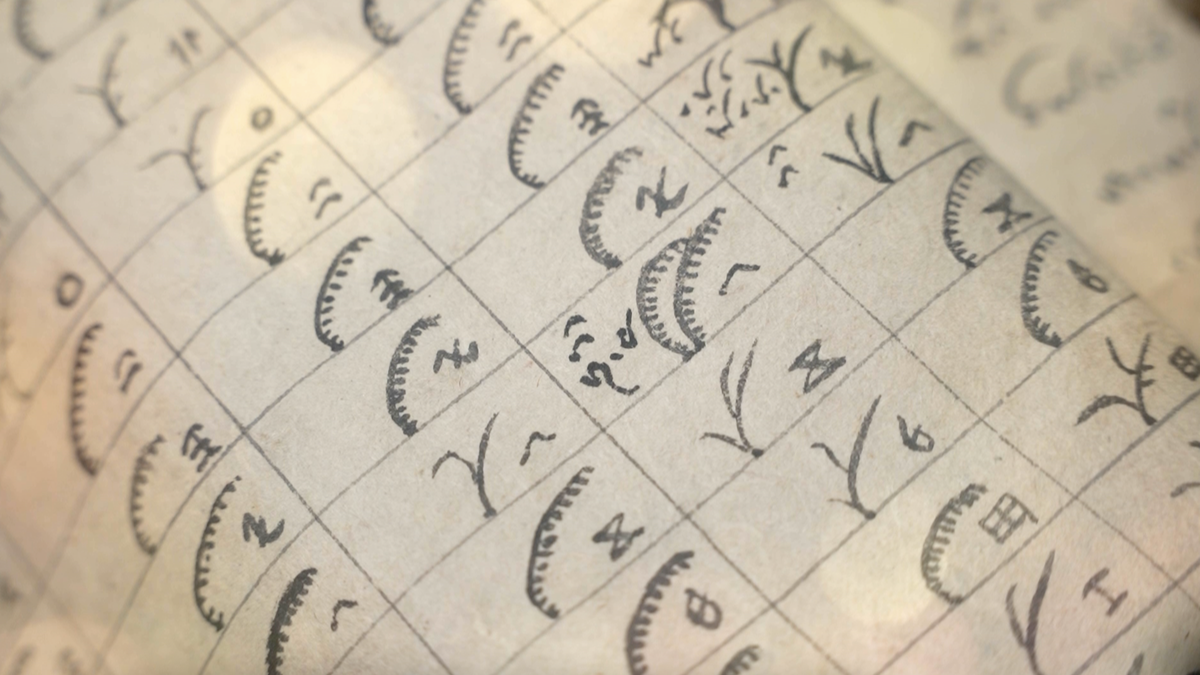












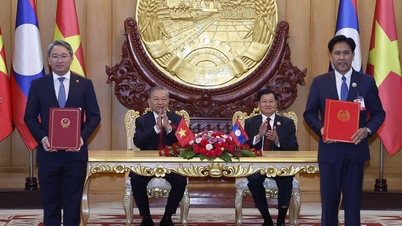
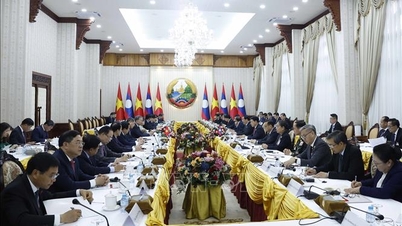






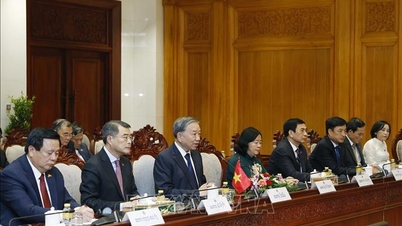






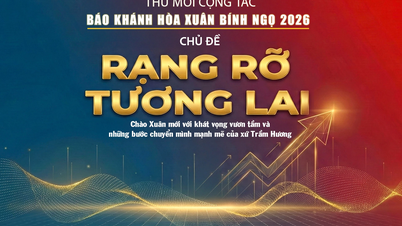















Kommentar (0)