Seit der Kreml vor 18 Monaten eine spezielle Militäroperation in der Ukraine startete, ist die russische Wirtschaft von einer beispiellosen Flut von Sanktionen aus Großbritannien, den USA und der EU betroffen.
Doch die Risse, Schlupflöcher und blinden Flecken im westlichen Sanktionsregime haben es Moskau ermöglicht, weiterhin „ein Vermögen zu machen“.
„Schlupflöcher“ im Finanzsystem
Sanktionen, die sich gegen ein breites Spektrum der Moskauer Industrie und des Handels richten, haben die russische Wirtschaft „katastrophal lahmgelegt“, heißt es in einer Studie der Yale University vom Juli 2022. Als Gründe werden der Zusammenbruch des Rubels und eine Massenflucht westlicher Unternehmen vom russischen Markt genannt.
Moskaus Wirtschaft hingegen hat sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Das BIP – ein Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit, der den Gesamtwert der von einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen misst – soll in diesem Jahr um 0,7 Prozent wachsen, während andere europäische Volkswirtschaften sich in einer Rezession und Stagnation befinden, wie aus einer aktuellen Reuters-Umfrage hervorgeht.
Es gibt viele Gründe für Russlands wirtschaftliche Stärke. Einige Experten argumentieren jedoch, dass die westlichen Sanktionen so viele blinde Flecken, Schlupflöcher und Schwachstellen aufweisen, dass sie Russlands „Geldbeutel“ wahrscheinlich nicht schädigen werden.

Ein russisches Frachtschiff wird in St. Petersburg beladen. Foto: RUSI
„Es gibt viele Lücken im aktuellen Sanktionsregime“, sagte Tom Keatinge, Direktor des Financial Crime and Security Research Centre am Royal United Services Institute (RUSI), gegenüber Euronews.
Die erste „Schwachstelle“ liege im Finanzsystem, da Banken, die mit Russland Geschäfte machen, immer noch im Westen tätig seien, so Keatinge.
Zwar sind diese Zahlungen, die angeblich für Energieimporte bestimmt sind, in einigen Fällen noch erlaubt, doch laut Keatinge sind die Transaktionen „sehr schwer zu überwachen“. Das bedeutet, dass Zahlungen für Öl und Gas als Tarnung für den Kauf anderer Güter dienen können, beispielsweise für hochtechnologische Militärgüter.
Dasselbe gelte für Unternehmen, die in anderen Sektoren mit eher humanitären Zielen tätig seien, etwa in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, fuhr Herr Keatinge fort.
„Es besteht immer das Risiko, dass eine exportierte Charge von Medikamenten oder ähnlichen Arzneimitteln als Deckmantel für etwas anderes dienen könnte. Ich bin nicht dagegen, Schlupflöcher für humanitäre Zwecke zu lassen, solange diese ordnungsgemäß identifiziert und verwaltet werden“, sagte er.
Finanzierung der „Kriegskasse“
Eine weitere Lücke, die der RUSI-Analyst erwähnte, besteht darin, dass viele bestimmte Sektoren weiterhin ungestraft bleiben.
Diamanten sind ein solches Beispiel. Trotz der von den USA und Großbritannien verhängten Beschränkungen nimmt die Europäische Union (EU) den Edelstein weiterhin von der elften Sanktionsrunde gegen Russland aus.
Dies ermöglicht dem weltgrößten Diamantenproduzenten weiterhin Zugang zu einem seiner wichtigsten Märkte.
„Die Regierungen versuchen, diese Schlupflöcher zu schließen, ohne ihre Geldbeutel zu sehr zu belasten“, sagte Keatinge gegenüber Euronews und nannte Belgien als Beispiel. Der Wunsch des westeuropäischen Landes, seine Diamantenindustrie zu schützen, erklärt, warum die Sanktionen gegen russische Diamanten so lange auf sich warten lassen.
Keatinge warnte jedoch, dass es sich bei den Sanktionen um ein komplexes Thema handele. Zwar gebe es viele „unangenehme“ Handelsaktivitäten, doch seien einige „sehr schwer einzudämmen, wie etwa der anhaltende Handel mit Kernbrennstoffen“.

Das berühmte Diamantenviertel in Antwerpen, Belgien. Foto: Luna Jets
Die Associated Press berichtete im August, dass Moskau Hunderte Millionen Euro durch den Verkauf von Kernbrennstoff an die Vereinigten Staaten und mehrere europäische Länder verdient habe, die vollständig von Uran aus Russland abhängig seien.
Auch für andere Güter, wie etwa Medikamente für die russische Zivilbevölkerung, keine Sanktionen zu verhängen, sei „völlig vernünftig“, da diese für den Westen ein „riesiges Propagandaziel“ darstellen würden, fügte Keatinge hinzu.
Im Mittelpunkt stehen dabei Debatten darüber, wie Sanktionen funktionieren und was ihr letztendlicher Zweck ist.
„Es ist ein Fehler zu glauben, dass es bei Sanktionen um alles oder nichts geht“, betonte Keatinge.
„Es ist offensichtlich nicht möglich, überall Sanktionen zu verhängen, damit das funktioniert“, erklärte er. „Es gibt viele Beschränkungen. Aber es gibt Risse im System – durch die Geld und Handel, wie Wasser, einen Weg finden, einzusickern.“
Was getan werden müsse, so der RUSI-Experte, sei es, die Zahl dieser Lücken, Schlupflöcher und blinden Flecken zu minimieren. Diese „Schlupflöcher“ beizubehalten, bedeute nicht zwangsläufig eine Schwächung des gesamten Sanktionsregimes, da sie offensichtlich Auswirkungen hätten.
Probleme für Drittländer
Mark Harrison, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick (Großbritannien), begrüßte zwar die Überprüfung der Mängel des westlichen Sanktionsregimes, sagte jedoch, es sei wichtig, Russland „einen höheren Preis zahlen zu lassen“.
„Der wahre Zweck des Wirtschaftskriegs besteht darin, die Kosten für den Gegner zu erhöhen, indem man ihn zur Anpassung zwingt“, sagte Professor Harrison gegenüber Euronews. „Man kann die russische Wirtschaft nicht blockieren. Man kann es Moskau aber immer teurer machen, seine Beziehungen zum Rest der Welt aufrechtzuerhalten.“
„Moderne Volkswirtschaften sind sehr schwierige Ziele. Das heißt nicht, dass sie es nicht wert sind, angegriffen zu werden. Es bedeutet, dass wir Realismus und Geduld brauchen“, sagte Professor Harrison.
Russlands Einnahmen aus fossilen Brennstoffen – von denen seine Wirtschaft abhängt – sind im Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel gesunken, so die Internationale Energieagentur (IEA).
Das letzte Problem des westlichen Sanktionsregimes, das Experten ansprechen, besteht darin, dass Drittländer nicht geschützt sind.

Die TurkStream-Pipeline transportiert Gas von Russland nach Türkei und Südosteuropa. Foto: NS Energy
Dies bedeutet, dass andere Länder mit ambivalenteren Ansichten zum Krieg in der Ukraine, wie etwa die Türkei, Kasachstan und Indien, als Vermittler für den Transport sanktionierter Güter durch ihr Territorium nach oder aus Russland fungieren könnten – und so die Sanktionen umgehen.
„Viele in Europa haben die Tatsache übersehen, dass Russland – das Ziel der Sanktionen – sich ganz sicher nicht zurücklehnen und die Dinge laufen lassen wird. Sie sind dabei, ihre Wirtschaft umzustrukturieren und neu zu organisieren“, sagte Keatinge von RUSI.
Indien hat seine Käufe russischen Rohöls erhöht, das einigen Berichten zufolge als raffiniertes Produkt verkauft wird und Moskau so dabei hilft, Sanktionen zu umgehen, berichtete Euronews im Mai.
Delhi verteidigte sich mit der Begründung, es könne sich die teureren Energieimporte aus anderen Ländern als Russland nicht leisten, wodurch Millionen von Menschen in Armut leben müssten.
„Wenn man den Handel auf einer Route blockiert, wird er sich eine andere Route suchen“, bemerkte Professor Harrison und verwies auf ein historisches Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg, als Exporte „einfach über neutrale europäische Länder umgeleitet“ wurden, nachdem Großbritannien eine Seeblockade gegen Deutschland verhängt hatte.
„Sanktionen sind ein politisches Instrument“
Selbst unter den westlichen Verbündeten der Ukraine, so Keatinge, würden die Sanktionen „inkonsistent“ umgesetzt. So kauften manche Länder beispielsweise aktiver russische Ölprodukte als andere, und einige russische Banken konnten weiterhin das SWIFT-Zahlungssystem nutzen.
„Das soll die Sanktionen nicht in Frage stellen, aber es erschwert die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchsetzung der Beschränkungen erheblich“, sagte Keatinge gegenüber Euronews.
Ungarn, das mitteleuropäische Land unter der Führung des nationalistischen Führers Viktor Orban, pflegt freundschaftliche Beziehungen zu Moskau und kauft weiterhin russische Energie. Im April schloss Budapest ein Energieabkommen mit Moskau ab, das es Ungarn erlaubt, bei Bedarf mehr Gas zu importieren als in einem im vergangenen Jahr überarbeiteten Langzeitvertrag vereinbart.
Die ungarische Regierung hat sich in der EU intensiv für eine Ausnahme von jeglichen Sanktionen gegen russisches Gas, Öl und Kernbrennstoffe eingesetzt und mit einem Veto gegen geplante EU-Maßnahmen gegen Moskau gedroht.

Der russische Präsident Wladimir Putin schüttelt dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban auf einer Straße in Budapest die Hand. Foto: DW
In Österreich, einem weiteren mitteleuropäischen Land, das in seiner Energieversorgung stark von Russland abhängig ist, gibt es einige Bedenken hinsichtlich der Sanktionsmüdigkeit. Eine politische Partei forderte, dass über die im vergangenen Oktober verhängten Beschränkungen in einem Referendum abgestimmt werden sollte.
„Sanktionen sind ein politisches Instrument“, sagte Keatinge gegenüber Euronews. „Wenn die Führung eines Landes keine klare Botschaft über Sanktionen aussendet, warum sollten die Unternehmen dieses Landes dann das Bedürfnis verspüren, sich daran zu halten?“
Die EU signalisierte im Juli, dass ihre Sanktionen gegen Russland mit der Zeit verschärft würden. Der Block sei bestrebt, bestehende Schlupflöcher zu schließen und neu entstehende zu begrenzen.
Diese könnten sich bis hin zu Sanktionen gegen Länder erstrecken, die als „Unterstützer“ Russlands gelten, obwohl dies ungewiss sei, sagte Professor Harrison.
„Indem wir Russland zu kostspieligen Maßnahmen zwingen, die seine Ressourcen verbrauchen, schwächen wir es sowohl im Inland als auch auf dem Schlachtfeld. Das ist hier das Ziel“, schloss der Professor .
Minh Duc (Laut Euronews, AP)
[Anzeige_2]
Quelle






![[Foto] Die Binh-Trieu-1-Brücke wurde fertiggestellt, um 1,1 m erhöht und wird Ende November für den Verkehr freigegeben.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/2/a6549e2a3b5848a1ba76a1ded6141fae)




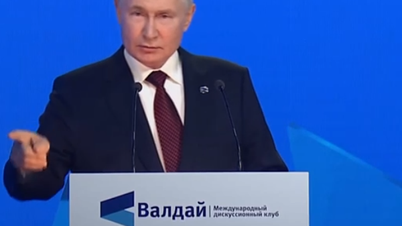

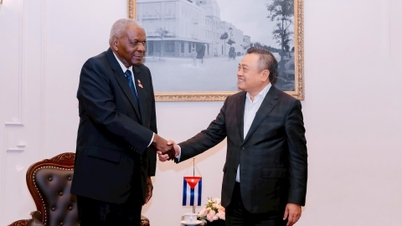












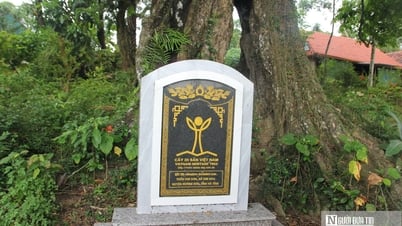
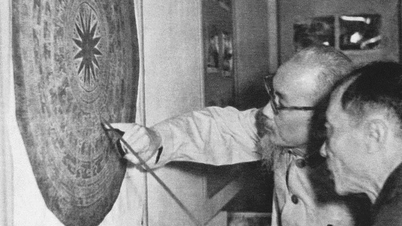



















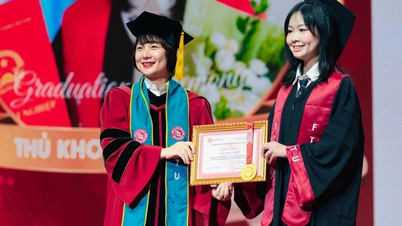















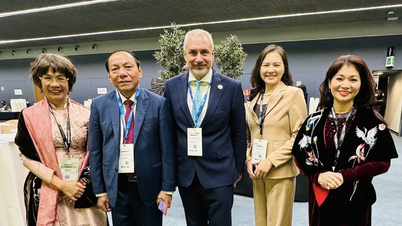











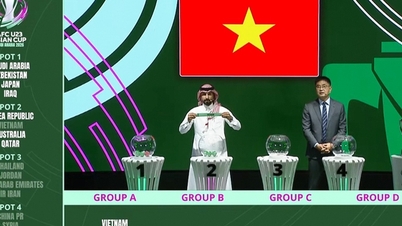


























Kommentar (0)