Bemerkenswerte Abwesenheiten in Den Haag: Präsident Selenskyj und das Vertrauensproblem der NATO
Die Nichteinladung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum für den 25. Juni in Den Haag geplanten NATO-Gipfel wird als deutlicher Rückschlag in den Beziehungen zwischen Kiew und seinen westlichen Partnern gewertet. Es ist das erste Mal seit 2022, dass Selenskyj bei einer so hochrangigen NATO-Veranstaltung weder virtuell noch persönlich anwesend war.
Westlichen Medien zufolge war die Entscheidung vor allem auf die Vorsicht des Weißen Hauses zurückzuführen. Da Präsident Donald Trump der Nato skeptisch gegenübersteht und ihre Mitglieder oft für ihre mangelnde Sicherheit kritisiert, besteht die Gefahr, dass Selenskyjs Auftritt zum Streitpunkt wird. Die Nato-Mitglieder scheinen sich einig zu sein, dass eine formelle Einladung die Spannungen innerhalb des Bündnisses verschärfen und ungelöste strategische Differenzen offenlegen könnte.
Zwar ist Kiew möglicherweise noch immer auf Ministerebene vertreten und nimmt an öffentlichen Veranstaltungen am Rande des Gipfels teil, doch die Abwesenheit von Präsident Selenskyj bei einer offiziellen Sitzung des NATO-Ukraine-Rates hat die derzeitigen Grenzen der Beziehungen zwischen beiden Seiten aufgezeigt.
Noch wichtiger ist, dass dieses Fehlen zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem immer mehr NATO-Mitgliedsstaaten einem baldigen Beitritt der Ukraine zur Allianz mit Vorsicht begegnen, ja sogar offen ablehnen. Laut Iswestija erklärte der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz kürzlich unverblümt, die Ukraine werde in den kommenden Jahren keine Einladung zum NATO-Beitritt erhalten. Auch die italienische Premierministerin Giorgia Meloni äußerte ihre Ablehnung einer Vollmitgliedschaft Kiews. Ähnliche Signale kommen auch aus einer Reihe anderer Mitgliedstaaten, wenn auch auf informeller Ebene.
Die Entscheidung der NATO, die Vertretung der Ukraine zurückzustufen und gleichzeitig konkrete Verpflichtungen hinsichtlich einer Mitgliedschaft zu vermeiden, spiegelt eine komplexepolitische Realität wider: Während der Westen Kiew weiterhin militärisch und finanziell unterstützt, wird das Ausmaß des langfristigen strategischen Engagements beider Seiten zu einem Thema interner Debatten, und Präsident Selenskyj, einst ein Symbol der Einheit, ist in diesen Überlegungen mittlerweile ein sensibler Faktor.
EU-Mitgliedschaft: Der Traum der Ukraine inmitten politischer Turbulenzen
Angesichts des anhaltenden Konflikts mit Russland stößt der Beitrittsantrag der Ukraine zur EU in den eigenen Mitgliedsstaaten auf gemischte Reaktionen. Während einige Länder wie Estland, Polen, Portugal, Schweden, die Niederlande und Spanien eine Mitgliedschaft Kiews nachdrücklich unterstützen, gibt es auch in anderen Ländern, insbesondere in Deutschland, Bulgarien und der Tschechischen Republik, eine Welle der Skepsis und Opposition.
Die vorherrschenden Sorgen der europäischen Öffentlichkeit drehen sich um zwei Hauptfaktoren: die Sicherheit der Ukraine und ihre Fähigkeit zur echten Integration. Viele in Deutschland, Italien, Griechenland und Spanien sehen einen EU-Beitritt der Ukraine während eines Kriegszustands als geopolitisches Risiko, das die Union in eine direkte Konfrontation mit Russland stürzen könnte. Daher lehnen sie die erhöhten Verteidigungsausgaben ab, die eine nahezu obligatorische Voraussetzung für die EU-Erweiterung eines kriegsbetroffenen Landes wären.
Neben Sicherheitsbedenken bremst ein weiteres internes Problem Kiew weiterhin: die Korruption. Umfragen in Deutschland, Bulgarien und Tschechien zufolge glaubt eine Mehrheit der Bevölkerung, dass die Ukraine der EU erst in mehr als fünf Jahren beitreten kann, wenn nicht sogar nie. Sie halten das derzeitige Ausmaß der Korruption in der Ukraine für zu gravierend, und die notwendigen Reformen zur Erfüllung der EU-Standards würden lange dauern und anhaltende politische Anstrengungen der Kiewer Regierung erfordern – etwas, das unter Kriegsbedingungen kaum möglich sein dürfte.
Die Zurückhaltung einiger EU-Mitgliedsstaaten spiegelt nicht nur die öffentliche Meinung im Land wider, sondern zeigt auch die vorsichtige Expansionsstrategie des Blocks. Die Aufnahme eines Konfliktlandes erfordert die Bereitschaft des Blocks, die Verantwortung für die Sicherheit, den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Stabilität eines der größten Länder Osteuropas zu übernehmen.
Angesichts dieser Hindernisse bleibt der Weg der Ukraine zur EU-Mitgliedschaft trotz der politischen Unterstützung einiger europäischer Staats- und Regierungschefs mit Schwierigkeiten behaftet. Diese Realität spiegelt ein Paradoxon wider: Während der Westen die Ukraine öffentlich in ihrem Kampf um die Verteidigung ihrer Souveränität unterstützt, dürfen strategische Überlegungen und geopolitische Realitäten bei einer tiefgreifenden institutionellen Integration wie der EU oder der NATO nicht ignoriert werden.
Wandel in Washington, Herausforderungen in Kiew: Persönliche Beziehungen und nationales Schicksal
Einer der Hauptgründe für den jüngsten Wandel der westlichen Haltung gegenüber der Ukraine ist das angespannte Verhältnis zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump. Während Selenskyj ein recht enges Verhältnis zur vorherigen Regierung unter Präsident Joe Biden aufgebaut hatte, war sein Verhältnis zu Trump nicht so positiv.
In den ersten Tagen seiner Präsidentschaft wirkte Trump als unberechenbarer, freimütiger Politiker, der sich kaum um konventionelle diplomatische Regeln kümmerte. Dies erschwerte Selenskyj den Aufbau persönlicher Beziehungen, ein Schlüsselelement der ukrainischen Außenpolitik. Zudem wurde Selenskyj unbeabsichtigt in innenpolitische Kontroversen innerhalb der USA hineingezogen, darunter die Untersuchung der Verbindungen von Präsident Trump zu Russland, die zuvor von den Demokraten vorangetrieben worden war. Dies verkomplizierte das Verhältnis zwischen den beiden Politikern zusätzlich.
Laut einigen westlichen Medien bemühte sich Selenskyj seit Trumps Rückkehr auf die US-amerikanische Politikbühne aktiv um eine Verbesserung der Beziehungen und warf der Biden-Regierung sogar vor, Entscheidungen zu verzögern und die Ukraine nicht ausreichend zu unterstützen. Diese Bemühungen scheinen jedoch keine nennenswerten Ergebnisse gebracht zu haben. Präsident Trump zeigte sich nicht nur unbeeindruckt, sondern äußerte sich auch weiterhin skeptisch gegenüber der Aufrechterhaltung der militärischen und finanziellen Unterstützung Kiews.
Das zerrüttete oder gar unzusammenhängende Verhältnis zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Trump, das von mangelndem Vertrauen europäischer Länder geprägt ist, ist zu einem strategischen Risiko für die Ukraine geworden. Tatsächlich sah sich Kiew in den ersten 100 Tagen von Trumps Amtszeit mit einem völlig veränderten politischen Umfeld konfrontiert, in dem die Grundsätze von Hilfsleistungen, Sicherheitsverpflichtungen und finanzieller Unterstützung unter dem Gesichtspunkt „Amerikanische Interessen zuerst“ neu überdacht werden.
„Ist es Zeit zu reden?“ – Europas veränderte Haltung gegenüber der Ukraine
Die einst starke Unterstützung, die die Ukraine in europäischen Ländern genoss, scheint zu schwinden, nicht nur unter Politikern, sondern auch in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr hat der Slogan „Unterstützt die Ukraine bis zum Sieg“ an Gewicht verloren. Eine im Dezember 2024 in sieben europäischen Ländern – Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, Dänemark und Großbritannien – durchgeführte Umfrage ergab, dass die Unterstützung für Kiew deutlich zurückgegangen ist.
Selbst in Ländern, die als besonders „pro-ukrainisch“ gelten, wie Schweden, Dänemark und Großbritannien, ist die Zustimmung laut Iswestija um durchschnittlich 14 Prozent gesunken. In Ländern wie Italien hingegen sprach sich mehr als die Hälfte der Befragten für eine Verhandlungslösung und nicht für eine fortgesetzte militärische Unterstützung aus.
Laut einer Studie des European Council on Foreign Relations (ECFR) klafft eine wachsende Kluft zwischen den Ansichten europäischer Staats- und Regierungschefs und der tatsächlichen Einstellung der Bevölkerung. In Griechenland, Bulgarien und Italien – wo die Kriegsmüdigkeit zunimmt – lehnt eine Mehrheit der Bevölkerung die weitere Lieferung von Waffen und Munition an Kiew ab. Gleichzeitig sind sie skeptisch, ob die Ukraine in naher Zukunft einen militärischen Sieg erringen kann.
Die Polarisierung der öffentlichen Meinung zeigt sich in Ländern wie Tschechien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz. Dort sind die Menschen gespalten zwischen der anhaltenden Unterstützung der Ukraine und dem Wunsch, die Friedensgespräche voranzutreiben. Insbesondere Präsident Wolodymyr Selenskyjs konsequente Konfrontationshaltung, die zu Beginn des Konflikts gelobt wurde, entwickelt sich zunehmend zum Streitpunkt. Kiews anhaltende Betonung eines totalen Sieges, anstatt die Tür für eine diplomatische Lösung zu öffnen, erscheint vielen unrealistisch und könnte das Leid auf beiden Seiten verlängern.
Diese Situation stellt die europäischen Regierungen vor ein schwieriges Problem: Wie können sie ihr politisches Engagement für die Ukraine mit dem immer deutlicher werdenden Wunsch ihrer Bevölkerung nach einer friedlichen Lösung in Einklang bringen? Angesichts steigender Kriegskosten und zunehmendem wirtschaftlichen Druck im Inland könnte der Stimmungsumschwung in der Bevölkerung in den kommenden Jahren direkte Auswirkungen auf die europäische Außenpolitik haben.
Hung Anh (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/tin-hieu-lanh-lung-tu-phuong-tay-ukraine-co-dang-danh-mat-dong-minh-249339.htm









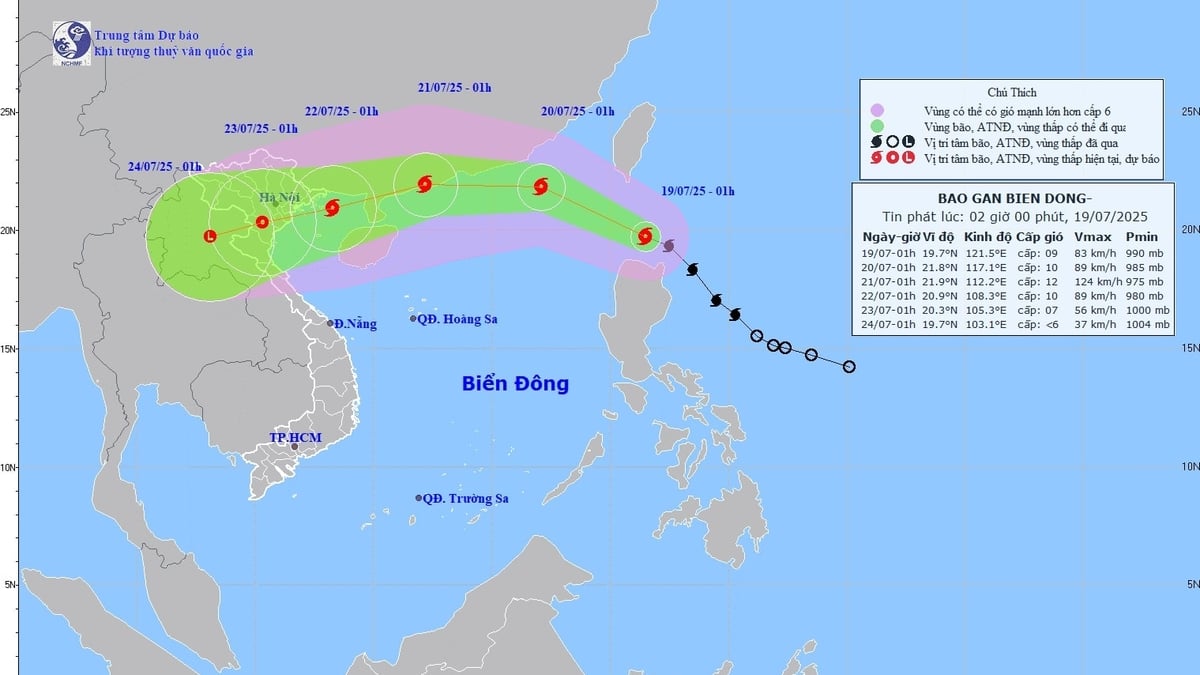

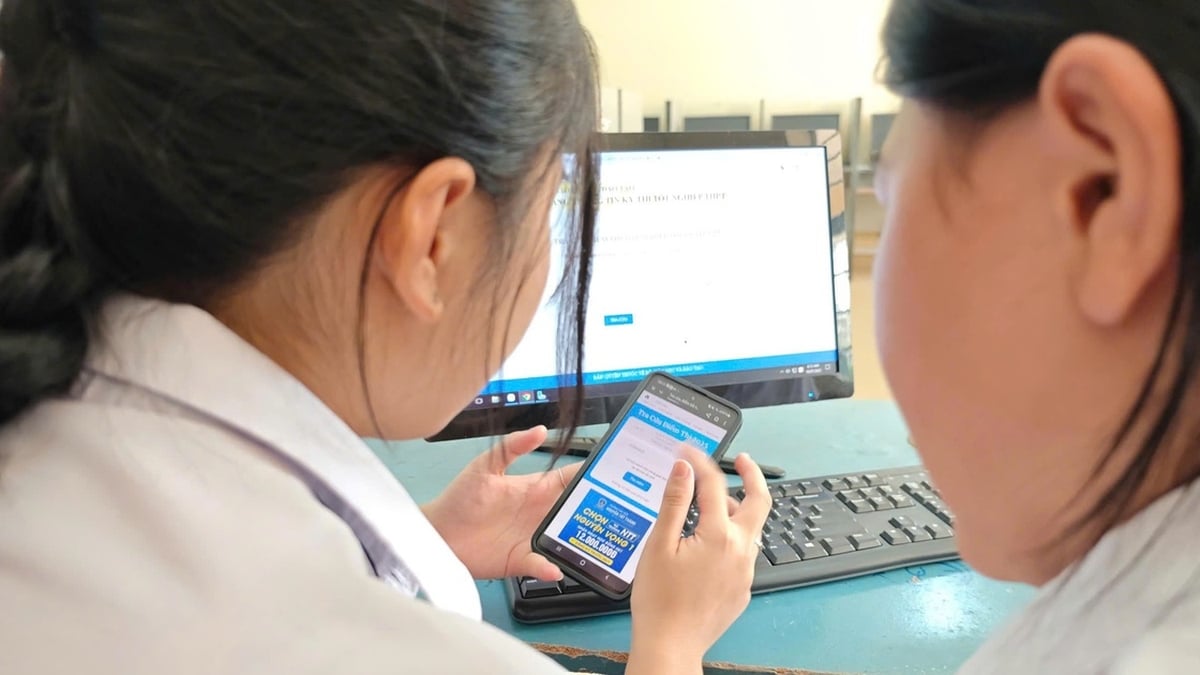
























































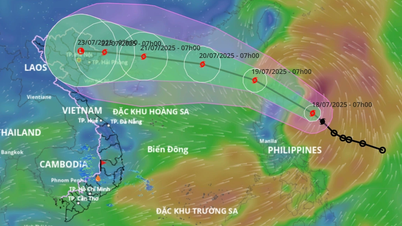



























![[Infografik] Im Jahr 2025 werden 47 Produkte das nationale OCOP erreichen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





Kommentar (0)