Europa hat seine Position als weltweit größter Offshore-Windmarkt an die von China angeführte Region Asien -Pazifik (APAC) verloren, berichtete die Financial Times (UK) am 28. August.
Bis 2022 werden rund 47 Prozent der 64,3 GW der weltweiten Offshore-Windkapazität auf Europa entfallen. Die restlichen 53 Prozent entfallen auf die Region Asien-Pazifik, wo China allein fast 49 Prozent der weltweiten Offshore-Windkapazität bereitstellt, berichtete die Financial Times unter Berufung auf Daten des Global Wind Energy Council (GWEC).
Tatsächlich hat der Führungswechsel in diesem Markt bereits seit 2021 begonnen, als auf Europa 50 % der 55,9 GW der kumulierten installierten Kapazität entfielen, so GWEC in seinem jüngsten Bericht über den Zustand des globalen Offshore-Windmarktes.
„Der Ausbau der Offshore-Windkapazitäten dürfte in naher Zukunft relativ langsam voranschreiten … aufgrund geringerer Aktivitäten in den etablierten Märkten in der Nordsee … sowie der Auswirkungen der derzeit schwierigen Marktbedingungen“, heißt es in dem Bericht.
GWEC fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass Europa in den nächsten zehn Jahren seine Position als weltgrößter Offshore-Windmarkt zurückgewinnen werde, obwohl man erwarte, dass die jährlichen Installationen in der Region ab 2030 die in Asien-Pazifik übertreffen werden.
Die europäische Offshore-Windindustrie hat zu kämpfen, da Lieferkettenprobleme und hohe Zinsen im Zuge der Pandemie und des Russland-Ukraine-Konflikts die Kosten für alles – von Turbinen über Arbeitskräfte bis hin zu Krediten – in die Höhe getrieben haben. Dies hat zu Verlusten bei den Turbinenherstellern geführt und Projekte wurden abgesagt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll waren.

Der weltweit erste Offshore-Windpark mit einer Stromerzeugungskapazität von 16 Megawatt wird am 19. Juli 2023 vor der Küste von Fujian im Osten Chinas in Betrieb genommen. Foto: Global Times
Letzten Monat stoppte der staatliche schwedische Energieversorger Vattenfall die Pläne zum Bau des Windparks Norfolk Boreas vor der Ostküste Englands mit der Begründung, dass das Projekt aufgrund steigender Kosten nicht länger rentabel sei.
Anfang des Monats hatte Siemens Energy angekündigt, dass das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich einen Verlust von 4,5 Milliarden Euro verzeichnen werde, da das Unternehmen mit der Sanierung des angeschlagenen Windturbinengeschäfts seiner Tochtergesellschaft Siemens Gamesa zu kämpfen habe.
Diese Herausforderungen führen dazu, dass in Europa in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich weniger Offshore-Windkapazität installiert wird als bisher prognostiziert. GWEC geht davon aus, dass Europa zwischen 2023 und 2027 insgesamt 34,9 GW Offshore-Windkapazität hinzufügen wird. Das ist weniger als die im Vorjahresbericht prognostizierten 40,8 GW.
In der Region Asien-Pazifik wird im gleichen Zeitraum ein Zubau von 76,1 GW erwartet, angetrieben von China. Der asiatische Riese wird 84 % des Zuwachses ausmachen.
In Europa und den USA wurden Offshore-Windprojekte „aufgrund unzureichender und ineffizienter Genehmigungsvorschriften“ verzögert oder auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, sagte Rebecca Williams, Leiterin der Abteilung Offshore-Wind bei GWEC. „Diese Faktoren haben Unsicherheit geschaffen und die Projektentwickler gezwungen, die Rentabilität ihrer Projekte zu überdenken und in einigen Fällen die Entwicklung zu stoppen.“
„Derartige ineffektive, auf Preiswettbewerb ausgerichtete Maßnahmen werden zusammen mit unrealistischen und nicht umsetzbaren Vorschriften zum lokalen Anteil die Kosten der Projekte erhöhen und den Ausbau der Offshore-Windenergie verlangsamen, der notwendig ist, damit die Welt ihre Netto-Null-Emissionsziele erreichen kann“, sagte sie .
Minh Duc (Laut Financial Times, The Telegraph)
[Anzeige_2]
Quelle


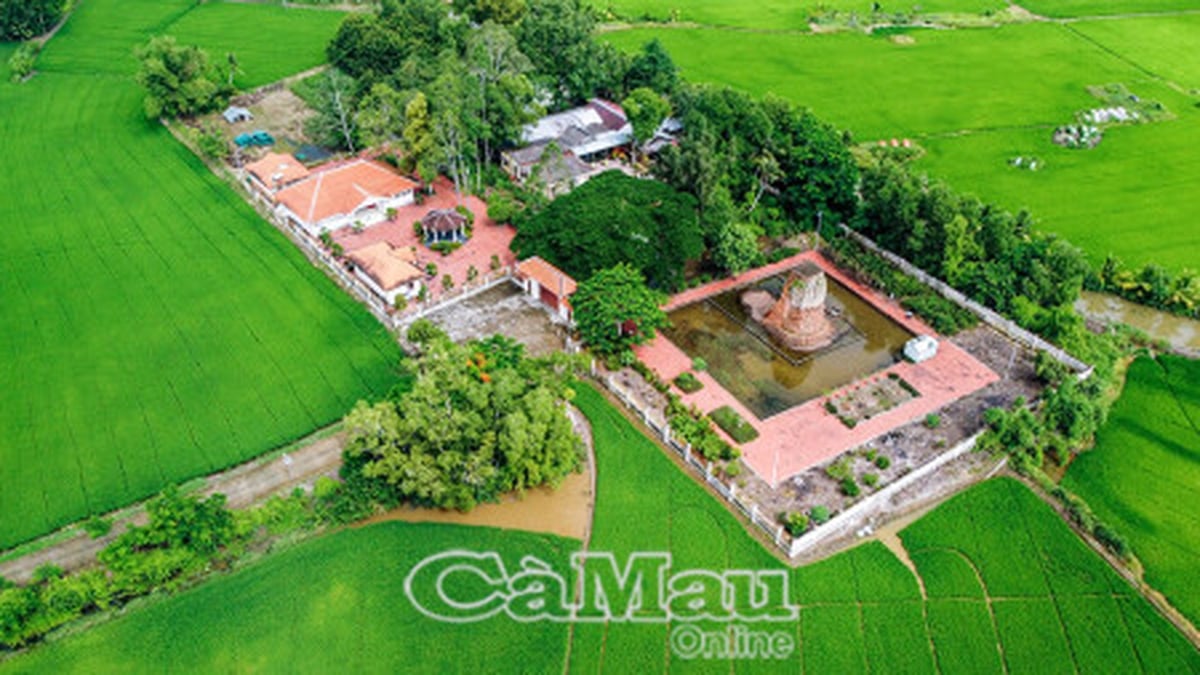
![[Fotoserie] Nahaufnahme der Brücke im Wert von über 1,6 Billionen VND und der Straße, die Dong Nai mit Ho-Chi-Minh-Stadt verbindet und für den Verkehr freigegeben wird](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/e8806165b0a240c0b8f139f6f22f3a8a)




















![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)













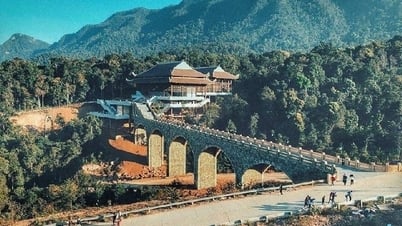

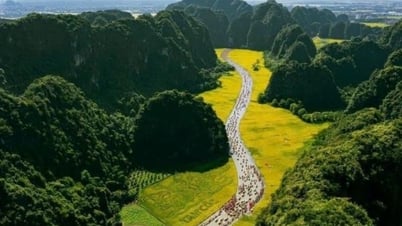




































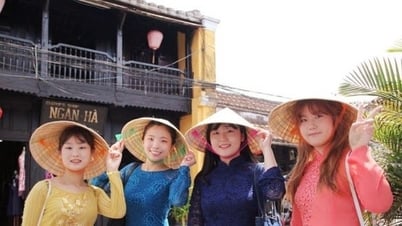























Kommentar (0)