Der Staat spielt die Rolle des Schiedsrichters.
Im vergangenen Jahrzehnt wurden zwar zahlreiche Programme und Resolutionen zur wirtschaftlichen Umstrukturierung und zur Innovation des Wachstumsmodells verabschiedet, die Ergebnisse entsprachen jedoch nicht den Erwartungen. Mit den Resolutionen des 12. Zentralkomitees (Resolution Nr. 05-NQ/TW zu einer Reihe wichtiger Maßnahmen und Leitlinien zur weiteren Förderung der wirtschaftlichen Umstrukturierung; Resolution Nr. 11-NQ/TW zur Vervollkommnung der sozialistisch orientierten marktwirtschaftlichen Institutionen) haben wir den Weg der „wirtschaftlichen Umstrukturierung“ und der „Transformation des Wachstumsmodells“ klar definiert.
Dieser Wandel ist, wie international üblich, unausweichlich: von einem ressourcenbasierten Wachstumsmodell (Phase 1) über ein auf Produktivität und Effizienz basierendes Modell (Phase 2) bis hin zu einem auf Wissenschaft, Technologie und Innovation basierenden Modell (Phase 3). Um die Falle des mittleren Einkommens zu überwinden, muss bei einem Durchschnittseinkommen von 3.800–4.000 US-Dollar die zweite Phase (Produktivität, Effizienz) den größten Anteil ausmachen.

Wir haben in diese Richtung gedacht. Selbst im Kontext der Industrie 4.0 haben wir uns die Devise „Aufholen, voranschreiten und womöglich übertreffen“ gesetzt. Die Realität der letzten Jahre zeigt jedoch, dass die Transformation des Wachstumsmodells von Breite zu Tiefe nicht erfolgreich war. Die Wirtschaft basierte selbst an den günstigsten Standorten nicht wirklich auf der Verbesserung von Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Wir wollen Phase 3 erreichen ( Wissenschaft , Technologie, Innovation und digitale Transformation als treibende Kraft), obwohl Phase 2 (Effizienz, Produktivität) noch nicht abgeschlossen ist. Dies ist ein zentraler Widerspruch. Ein Übergang zu einem Modell, das Wissenschaft und Technologie als treibende Kraft nutzt, ist unmöglich, solange Effizienz nicht die Haupttriebkraft darstellt.
Es ist nicht so, dass wir die Krankheit nicht kennen. Die Ursache dieser Stagnation wurde von Generalsekretär To Lam bereits mehrfach benannt. In der Eröffnungssitzung der 8. Tagung der 15. Nationalversammlung erklärte Generalsekretär und Präsident To Lam, dass die drei größten Engpässe derzeit Institutionen, Infrastruktur und Humanressourcen seien.
Von den drei Engpässen wird das institutionelle System als größter Engpass identifiziert, da es an der veralteten Managementmentalität „Wenn man etwas nicht steuern kann, dann verbieten“ festhält, anstatt „neuen Entwicklungsraum zu schaffen“. Der Staat konzentriert sich weiterhin auf das „Erlauben“ (vor der Kontrolle), anstatt klare Spielregeln festzulegen und Verstöße zu ahnden (nach der Kontrolle).
Noch gefährlicher ist, dass es Gesetze gibt, die eher den Interessen von Industrieverbänden als dem Gemeinwohl dienen. Solange der „Geben-Nehmen-Mechanismus“ besteht, können sich die Märkte für Produktionsfaktoren (Boden, Kapital, Arbeit, Wissenschaft und Technologie) nicht entwickeln und Ressourcen nicht effektiv verteilt werden.
Die digitale Transformation ist untrennbar mit der Realwirtschaft verbunden.
Wie Generalsekretär To Lam betont hat, muss die institutionelle Reform als der Durchbruch aller Durchbrüche betrachtet werden, denn hohes Wachstum ist nicht möglich, solange das rechtliche Umfeld restriktiv, fragmentiert und inkonsistent bleibt. Das aktuelle Reformziel beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Abbau administrativer Verfahren, sondern umfasst auch einen grundlegenden Wandel im legislativen Denken.
Ein anschauliches Beispiel: Das Investitionsgesetz wurde zwar zweimal umfassend überarbeitet, enthält aber immer noch über 230 bedingte Geschäftsbereiche, von denen viele nicht mehr zeitgemäß sind. Die Dokumente des 14. Parteitags müssen das Ziel klar formulieren, alle unnötigen Geschäftsbedingungen abzuschaffen, von der Vorprüfung zur Nachprüfung überzugehen und gleichzeitig den Grundsatz zu vereinheitlichen, dass Fachgesetze keine zusätzlichen Geschäftsbedingungen vorschreiben dürfen.
In diesem innovativen Rechtssystem fungiert der Staat als Schiedsrichter, um eine faire Entwicklung aller Wirtschaftssektoren zu gewährleisten. Dieser Grundsatz muss im Dokument klar formuliert sein.
Anders ausgedrückt: Die sozialistisch orientierte Marktwirtschaft muss in einem modernen Sinne verstanden werden: Jeder hat das Recht, innerhalb des Rechtsrahmens frei zu wirtschaften, Geschäfte zu tätigen und Wohlstand zu erlangen. Der Staat reguliert lediglich, um Ordnung, Sicherheit und eine entwicklungsfördernde Ausrichtung zu gewährleisten. Dann stellt die neue Institution kein Hindernis mehr dar, sondern wird zum Wachstumsmotor.
Im Kontext der industriellen Revolution 4.0 bietet sich uns die Chance, die digitale Transformation zu beschleunigen. Diese ist jedoch untrennbar mit der Realwirtschaft verbunden, und digitale Technologien allein können nicht die treibende Kraft sein. Die eigentliche Triebkraft liegt in der Innovationsfähigkeit der gesamten Gesellschaft – wenn jedes Unternehmen, jede Organisation und jeder Einzelne frei experimentieren kann und seine Eigentums- und Urheberrechte geschützt sind.
Für eine erfolgreiche Transformation des Wachstumsmodells sind drei Schlüsselfaktoren entscheidend. Erstens muss der Markt für Produktionsfaktoren – insbesondere Boden, Kapital, Arbeit sowie Wissenschaft und Technologie – stark ausgebaut werden. Zweitens greift der Staat nicht administrativ ein, sondern schafft einen institutionellen Rahmen für ein transparentes Funktionieren des Marktes. Drittens muss der Verwaltungsapparat umfassend reformiert und neue, mit einer modernen Marktwirtschaft und tiefgreifender Integration vereinbare Kapazitäten aufgebaut werden.
Das Ziel eines nachhaltigen zweistelligen Wachstums lässt sich mit überholten Denkweisen und Vorgehensweisen nicht erreichen. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass ein kreativer Staat entsteht, dessen Gesetze die Entwicklung fördern, dessen Regierung handlungsorientiert agiert und stets nach Wegen sucht, Hindernisse zu beseitigen, Ressourcen freizusetzen und Kreativität anzuregen. Zudem sind dynamische Bereiche notwendig, um nationale Dynamik zu erzeugen.
Quelle: https://www.sggp.org.vn/kien-tao-cuoc-doi-moi-ve-the-che-va-tu-duy-phat-trien-post821564.html


![[Foto] Panorama des Patriotischen Wettbewerbskongresses der Zeitung Nhan Dan für den Zeitraum 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

![[Foto] Die Straße, die Dong Nai mit Ho-Chi-Minh-Stadt verbindet, ist nach 5 Jahren Bauzeit immer noch nicht fertiggestellt.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762241675985_ndo_br_dji-20251104104418-0635-d-resize-1295-jpg.webp)

![[Foto] Jugendliche in Ho-Chi-Minh-Stadt engagieren sich für eine sauberere Umwelt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762233574890_550816358-1108586934787014-6430522970717297480-n-1-jpg.webp)
![[Foto] Ca Mau kämpft mit der höchsten Flut des Jahres; Prognosen zufolge wird die Alarmstufe 3 überschritten.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762235371445_ndo_br_trieu-cuong-2-6486-jpg.webp)







































































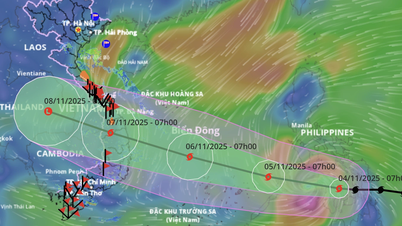
























Kommentar (0)