
Nur zwei Monate bevor Zinedine Zidane im WM-Finale 1998 gegen Brasilien zwei Tore erzielte und Frankreich damit zum Titel führte, wurde Luca Zidane geboren. Nachdem die französischen Fans Luca später eine Fußballkarriere anstreben und beim renommierten Verein Real Castilla trainieren sahen (wie auch Zidanes andere Kinder Enzo, Theo und Elyaz), hofften sie, dass Zizous Sohn in die Fußstapfen seines Vaters treten und bei der Weltmeisterschaft spielen würde.
Dieser Traum wird bei der Weltmeisterschaft 2026 wahr. Nur wird Luca nicht für Frankreich, sondern für Algerien, das Land seiner Großeltern, auflaufen. Der 27-jährige Torhüter, der für Granada in der spanischen zweiten Liga spielt, wusste, dass er keine Chance hatte, für die Équipe Tricolore zu spielen, und beantragte daher einen Wechsel der Nationalität . Im vergangenen September genehmigte die FIFA den Antrag, und im Oktober bestritt er sein erstes Länderspiel für Algerien gegen Uganda.
Nur fünf Tage vor Lucas Debüt sicherte sich Algerien erfolgreich die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Nachdem das nordafrikanische Land die beiden vorherigen Turniere verpasst hatte, forcierte es seine Einbürgerungspolitik, um den Kader zu verstärken. Zidanes zweiter Sohn ist Teil dieser Strategie und konnte Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Houssem Aouar, Ismael Bennacer und Ibrahim Maza, einen in Deutschland geborenen Mittelfeldspieler mit algerischen, französischen und vietnamesischen Wurzeln, für sich gewinnen.

Afrikanische Länder waren in der Vergangenheit stets stolz auf ihre einheimischen Talente. Doch dem modernen Fußballtrend folgend, insbesondere inspiriert durch Marokkos Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2022, hat der Schwarze Kontinent begonnen, vermehrt Spieler aus anderen Ländern zu verpflichten.
Senegal beispielsweise, das sich ungeschlagen für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizierte, hatte sieben seiner elf Stammspieler im Ausland geboren. Darunter Edouard Mendy, Koulibaly, Iliman Ndiaye und Papa Gueye. Ähnliches gilt für die Demokratische Republik Kongo. Das zentralafrikanische Land rückt der Qualifikation für das größte Fußballereignis der Welt immer näher, nachdem es Kamerun und Nigeria besiegt und die interkontinentalen Play-offs erreicht hat. Und von den Spielern, die beim jüngsten Sieg gegen Nigeria in der Startelf standen, wurden nur drei im Kongo geboren.
In der Nord-, Zentral- und Karibikregion (CONCACAF) ist die Einbürgerungspolitik noch radikaler. Da die drei regionalen Giganten USA, Mexiko und Kanada nicht an der Qualifikationsrunde teilnahmen (sie waren als Gastgeber automatisch qualifiziert), nutzen die übrigen Länder die günstige Gelegenheit und liefern sich seither einen ständigen Wettlauf um die Stärkung ihrer Position.

Man kann sagen, dass Curaçao die WM 2026 mit einem rein ausländischen Kader erfolgreich erreicht hat. Im letzten Qualifikationsspiel gegen Jamaika waren alle Start- und Ersatzspieler in den Niederlanden geboren und aufgewachsen und hatten anschließend in Europa professionell Fußball gespielt. Sogar Trainer Dick Advocaat ist Niederländer.
Haiti ist zwar nicht so groß wie Curaçao, setzt aber ebenfalls auf seine Diaspora, um sich für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Zu den Schlüsselspielern zählen Placide, Providence und Bellegarde, die alle in Frankreich geboren wurden. Bis zum Turnier könnten noch einige namhafte Spieler hinzukommen, wie beispielsweise Allan Saint-Maximin von Newcastle United und Wilson Isidor, der Schlüsselstürmer von Sunderland.
Auch in Asien findet vielerorts ein Wettlauf um die Einbürgerung statt. Aufgrund der Besonderheiten des AFC-Qualifikationssystems und der übermächtigen Stärke der großen Gruppe mit Japan, Korea, Saudi-Arabien, Iran und Australien gestaltet sich der Erwerb eines solchen Tickets jedoch äußerst schwierig.

Mit Ausnahme von Katar, das seit den 2000er Jahren eine Politik der Anwerbung ausländischer Spieler verfolgt, sind andere Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien gescheitert. Die Tatsache, dass diese beiden Länder ihrem Traumziel so nahe gekommen sind, sollte anderen Teams jedoch die Vorteile der Nutzung externer Ressourcen verdeutlichen. Die Einbürgerungsbewegung wird mit Sicherheit noch einmal deutlich zunehmen, wenn die Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2030 beginnen.
„Mehr WM-Startplätze bedeuten mehr Hoffnung und mehr Chancen für jedes Land“, sagte Shaji Prabhakaran, Mitglied des AFC-Exekutivkomitees. „Sie glauben, dass sie durch die Umsetzung des Einbürgerungsprogramms ihre Qualität, Leistung und Ergebnisse schnell verbessern und sich so eine Chance auf die Qualifikation sichern können.“
Angesichts der vielen Erfolgsgeschichten, die in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 entstanden sind, scheint die Einbürgerung als Schlüssel zum Erfolg angesehen zu werden.
Quelle: https://tienphong.vn/nhap-tich-cau-thu-chia-khoa-de-mo-canh-cua-world-cup-post1798646.tpo



![[Foto] Neben dem „Müllberg“ nach der Flut versuchen die Bewohner von Tuy Hoa, ihr Leben wieder aufzubauen.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F24%2F1763951389752_image-1-jpg.webp&w=3840&q=75)































![[Foto] Premierminister beendet Reise zum G20-Gipfel in Südafrika](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F24%2F1763944494358_vna-potal-thu-tuong-ket-thuc-chuyen-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-tai-nam-phi-8428321-4810-jpg.webp&w=3840&q=75)






















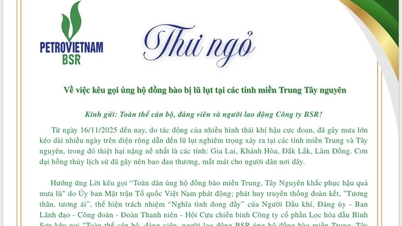











































Kommentar (0)