Die Europäer sind mit einer neuen wirtschaftlichen Realität konfrontiert, die sie seit Jahrzehnten nicht erlebt haben: Sie werden ärmer.
Das Leben auf dem Kontinent, lange Zeit der Neid der Welt , verliert seinen Reiz, da die Kaufkraft der Europäer schwindet. Die Franzosen essen weniger Foie gras und trinken weniger Rotwein. Auch die Finnen nutzen an windigen Tagen die Sauna – wenn der Strom günstiger ist.
In Deutschland liegt der Fleisch- und Milchkonsum auf einem 30-Jahres-Tief, und der einst boomende Markt für Biolebensmittel gerät ins Trudeln. Im Mai berief Italiens Wirtschaftsminister Adolfo Urso eine Krisensitzung ein, da die Preise für Pasta – ein Grundnahrungsmittel des Landes – doppelt so schnell stiegen wie die nationale Inflation.
Mit dem Konsum im freien Fall geriet auch Europa Anfang des Jahres in eine Rezession. Dies war lange vorhersehbar. Jahrelang stagnierten Wirtschaftswachstum und Produktivität in der Region aufgrund der alternden Bevölkerung, da Arbeitnehmer mehr Freizeit und Arbeitsplatzsicherheit einem höheren Einkommen vorziehen. Dann kamen Covid-19 und der Russland-Ukraine-Konflikt. Die Abschnürung globaler Lieferketten sowie die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise verschärften die Situation zusätzlich.
Die Reaktionen der Regierungen haben das Problem unterdessen nur verschärft. Um Arbeitsplätze zu erhalten, konzentrierten sie sich auf die Subventionierung von Arbeitgebern, sodass die Verbraucher im Falle eines Preisschocks kein finanzielles Polster hatten. Die Amerikaner hingegen taten das Gegenteil: Sie profitierten von niedrigeren Treibstoffpreisen und direkten staatlichen Subventionen, um ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten.

Eine Frau verlässt eine Lebensmittelausgabestelle in Berlin. Foto: AP
Bisher konnte sich Europa auf Exporte verlassen. Da sich China, ein wichtiger Markt für europäische Waren, jedoch noch nicht erholt hat, ist dieser Wachstumsmotor bisher nicht in Gang gekommen.
Hohe Energiekosten und eine seit 50 Jahren hohe Inflation schwächen zudem den Preisvorteil der Unternehmen auf den internationalen Märkten. Mit dem schrumpfenden Welthandel wird Europas Exportabhängigkeit zu einer Schwäche. Exporte machen mittlerweile 50 Prozent des BIP der Eurozone aus, verglichen mit 10 Prozent in den USA.
Inflations- und kaufkraftbereinigt sind die Löhne in Deutschland seit 2019 um 3 Prozent gesunken. In Italien und Spanien betrugen die Rückgänge jeweils 3,5 Prozent, in Griechenland 6 Prozent. In den USA sind die Reallöhne im gleichen Zeitraum laut Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) um 6 Prozent gestiegen.
Selbst die Mittelschicht spürt die Krise. In Brüssel, einer der reichsten Städte Europas, stehen Lehrer und Krankenschwestern abends Schlange, um Lebensmittel zum halben Preis von einem Lastwagen zu kaufen. Der Händler Happy Hours Market sammelt fast abgelaufene Lebensmittel aus Supermärkten und verkauft sie über eine App. Kunden können am frühen Nachmittag bestellen und ihre Lebensmittel abends abholen.
„Manche Kunden sagen mir: ‚Dank Ihnen kann ich zwei- oder dreimal pro Woche Fleisch essen‘“, sagte Lieferant Pierre van Hede.
Karim Bouazza, ein 33-jähriger Krankenpfleger, besorgte für seine Frau und seine beiden Kinder zu Hause Fleisch und Fisch. Er beklagte sich, die Inflation bedeute, dass man „fast einen zweiten Job annehmen muss, um alles bezahlen zu können“.
Ähnliche Dienste schießen in ganz Europa auf den Markt und versprechen, Geld zu sparen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren. TooGoodToGo, 2015 in Dänemark gegründet, verkauft Essensreste von Einzelhändlern und Restaurants. Mittlerweile hat TooGoodToGo europaweit 76 Millionen Abonnenten – eine Verdreifachung bis Ende 2020.
In Deutschland verkauft Sirplus – ein 2017 gegründetes Startup – ebenfalls „gerettete Lebensmittel“, beispielsweise abgelaufene Produkte. Motatos – 2014 in Schweden gegründet – ist mittlerweile in Finnland, Deutschland, Dänemark und Großbritannien vertreten.
Auch die Ausgaben für Genussmittel sind stark zurückgegangen. Die Deutschen werden 2022 52 Kilogramm Fleisch pro Person konsumieren, 8 % weniger als im Vorjahr und der niedrigste Wert seit 1989. Ein Grund dafür ist der Wunsch nach gesünderer Ernährung und Tierschutz. Experten zufolge hat sich der Trend jedoch beschleunigt, da die Fleischpreise in den letzten Monaten um 30 % gestiegen sind. Laut dem Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft essen die Deutschen auch weniger Rindfleisch und bevorzugen stattdessen günstigere Alternativen wie Hühnchen.
Thomas Wolff, ein Bio-Lebensmittelhändler in der Nähe von Frankfurt, sagte, die Umsätze seien im vergangenen Jahr aufgrund der steigenden Inflation um 30 Prozent zurückgegangen. Wolff, der 33 Mitarbeiter beschäftigte, um die Nachfrage nach teuren Bio-Lebensmitteln zu decken, musste nun alle entlassen.
Ronja Ebeling, eine 26-jährige Beraterin aus Hamburg, sagte, sie spare stets etwa ein Viertel ihres Einkommens, auch weil sie sich Sorgen um ihre Rente im Alter mache. Für Kleidung und Kosmetik gibt sie wenig aus und teilt sich ein Auto mit einer Freundin.
Schwacher Konsum und eine alternde Bevölkerung haben Europa auch für Unternehmen wie den Konsumgütergiganten P&G und den Luxuskonzern LVMH weniger attraktiv gemacht. „Amerikaner geben mittlerweile mehr Geld aus als Europäer“, sagte Unilever-Finanzvorstand Graeme Pitkethly im April.
Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge ist die Wirtschaft der Eurozone in den vergangenen 15 Jahren um 6 Prozent (in US-Dollar) gewachsen. Die US-Wirtschaft verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 82 Prozent.
Schwaches Wachstum und hohe Zinsen belasten Europas großzügige Sozialsysteme. Ökonomen warnen, dass die staatlichen Subventionen und Steuererleichterungen in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar zur Deckung höherer Treibstoffkosten die Inflation in die Höhe treiben könnten.
Vivek Trivedi, 31, lebt in Manchester und verdient 51.000 Pfund (67.000 Dollar) im Jahr. Doch da die Inflation in Großbritannien seit fast einem Jahr über 10 Prozent liegt, mussten Trivedis monatliche Ausgaben angepasst werden. Er kauft Lebensmittel zu reduzierten Preisen und geht seltener auswärts essen. Einige von Trivedis Kollegen haben aus Angst vor steigenden Kosten sogar monatelang die Heizung abgestellt.
Huw Pill, Ökonom der Bank of England, warnte die Briten im April, ihre zunehmende Armut zu akzeptieren und nicht mehr höhere Löhne zu fordern. „Ja, wir werden alle ärmer“, sagte er. Pill erklärte, der Versuch, steigende Preise durch höhere Löhne auszugleichen, würde die Inflation nur verschärfen.
Analysten prognostizieren, dass die europäischen Regierungen angesichts steigender Verteidigungsausgaben und hoher Zinsen bald die Steuern erhöhen müssen. Im Vergleich zu anderen Industrieländern sind die Steuern in Europa bereits hoch. Amerikaner behalten etwa drei Viertel ihres Einkommens nach Steuern. Franzosen und Deutsche hingegen nur die Hälfte.
Viele europäische Gewerkschaften drängen auf kürzere Arbeitszeiten statt auf höhere Löhne. Die IG Metall, Deutschlands größte Gewerkschaft, fordert gleiche Löhne, aber eine Vier-Tage-Woche. Sie argumentiert, eine kürzere Arbeitswoche würde die Arbeitsmoral und Lebensqualität der Arbeitnehmer verbessern und jüngere Arbeitnehmer anziehen.
Kristian Kallio, ein Spieleentwickler aus Nordfinnland, hat kürzlich seine Arbeitswoche um 20 % verkürzt und 10 % Gehalt eingebüßt. Ein Drittel seiner Kollegen ist seinem Beispiel gefolgt. In seiner Freizeit verbringt er seine Freizeit mit Dingen, die ihm Spaß machen, wie Kochen und Langstreckenradfahren. „Ich will nicht mehr zum alten Pendeln zurück“, sagt er.
In einem Autowerk im italienischen Melfi arbeiten die Mitarbeiter seit Jahren wegen Rohstoffknappheit und hoher Energiekosten in Kurzarbeit. Zuletzt wurden die Arbeitszeiten um 30 Prozent gekürzt, die Löhne entsprechend gekürzt. „Die hohe Inflation und die hohen Energiepreise machen es schwieriger, die Familienausgaben zu decken“, sagte Marco Lomio, ein Arbeiter im Werk.
Ha Thu (laut WSJ)
[Anzeige_2]
Quellenlink

















































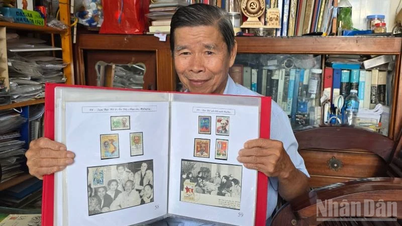



















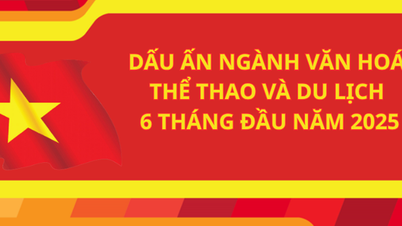


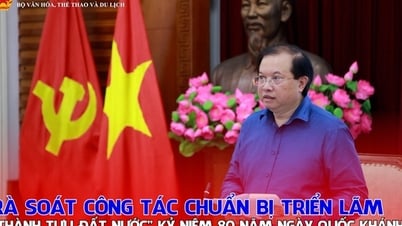



























Kommentar (0)