SGGP
Laut NHK wird das japanische Industrieministerium eine Reihe von Projekten finanzieren, um die Technologie zur CO2- Abscheidung und -Speicherung in die Praxis umzusetzen. Das CO2- Abscheidungsverfahren, bekannt als CCS, trennt und sammelt das von Fabriken ausgestoßene CO2 und speichert es tief unter der Erde.
 |
| CO2-Abscheidungs- und -Speicherungsprojekt in Hokkaido, Japan |
Der Versuch läuft derzeit in Hokkaido. Die Regierung wird sieben neue Projekte, die im Haushaltsjahr 2030 starten sollen, finanziell unterstützen, darunter fünf in Japan und zwei im Ausland. Eines davon, an dem unter anderem der japanische Energiekonzern Eneos beteiligt ist, soll CO2- Emissionen von Raffinerien und Wärmekraftwerken vor der Küste Nord- und West-Kyushus speichern.
Bei einem weiteren Projekt, an dem Itochu Trading Co. und Nippon Steel Co. beteiligt sind, wird CO2 gespeichert, das in Stahlwerken entlang des Japanischen Meeres abgeschieden wurde. An einem der beiden Projekte im Ausland ist Mitsui & Co. Trading Co. beteiligt. Dabei wird in Japan abgeschiedenes CO2 transportiert und in Gebiete vor der Küste Malaysias gelagert.
Die japanische Regierung beabsichtigt, bis 2030 bis zu 12 Millionen Tonnen CO2 unterirdisch zu speichern, was 1 % der jährlichen CO2- Emissionen Japans entspricht.
Laut Daten des japanischen Umweltministeriums von Ende April stiegen die Treibhausgasemissionen des ostasiatischen Landes im Haushaltsjahr 2021/2022 auf 1,17 Milliarden Tonnen CO2 , verglichen mit 1,15 Milliarden Tonnen im Vorjahr. Daher plant Japan zusätzlich zu seinem Plan zur CO2- Abscheidung und -Speicherung die Ausweitung von Offshore-Windkraftanlagen in seiner Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), um seine Bemühungen um CO2-Neutralität zu verstärken und die Energiesicherheit zu gewährleisten.
Laut der Nachrichtenagentur Kyodo ist Japan, das über wenige natürliche Ressourcen verfügt, auf Wärmekraft angewiesen. Angesichts der zunehmenden weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes muss Japan auch mehr erneuerbare Energiequellen nutzen, die derzeit nur einen geringen Anteil an der gesamten Energieproduktion des Landes ausmachen. Weltweit haben einige europäische Länder wie Großbritannien, Belgien und die Niederlande Windparks in ihren AWZs errichtet. Auch China und Südkorea steigern ihre Windenergieproduktion.
Japan verfügt derzeit in seinen Hoheitsgewässern über fest im Meeresboden verankerte Offshore-Windturbinen. In der tiefen AWZ sind schwimmende Turbinen nach Ansicht von Experten besser geeignet. Bis diese Anlagen betriebsbereit sind, dürfte es noch Jahre dauern.
Japan strebt nun an, die Offshore-Windkraftkapazität auf 30 bis 45 Gigawatt zu erhöhen. Dies entspricht der Leistung von etwa 45 Kernreaktoren. Die japanische Regierung strebt außerdem an, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Energieproduktion bis zum Haushaltsjahr 2030 30 bis 36 Prozent beträgt – doppelt so viel wie im Haushaltsjahr 2019.
Das Problem beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen in der AWZ besteht darin, dass die japanische Regierung entscheiden muss, wo diese Anlagen errichtet werden dürfen, und sich mit den relevanten Parteien beraten muss.
Im Bericht der Expertengruppe heißt es, die japanische Regierung könne Sicherheitszonen rund um Anlagen und Bauwerke wie Windkraftanlagen einrichten, müsse gleichzeitig aber die Freiheit der Schifffahrt für alle Länder gewährleisten.
[Anzeige_2]
Quelle





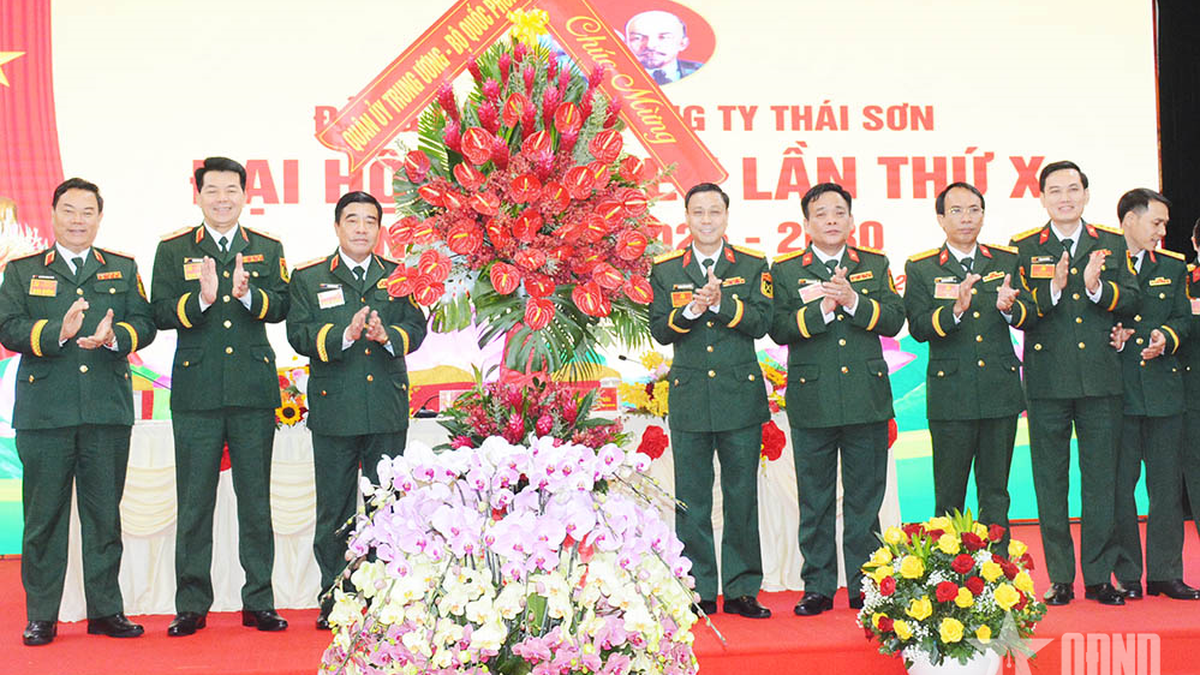


















![[Foto] Unterzeichnung einer Kooperation zwischen Ministerien, Zweigstellen und Ortschaften Vietnams und Senegals](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)



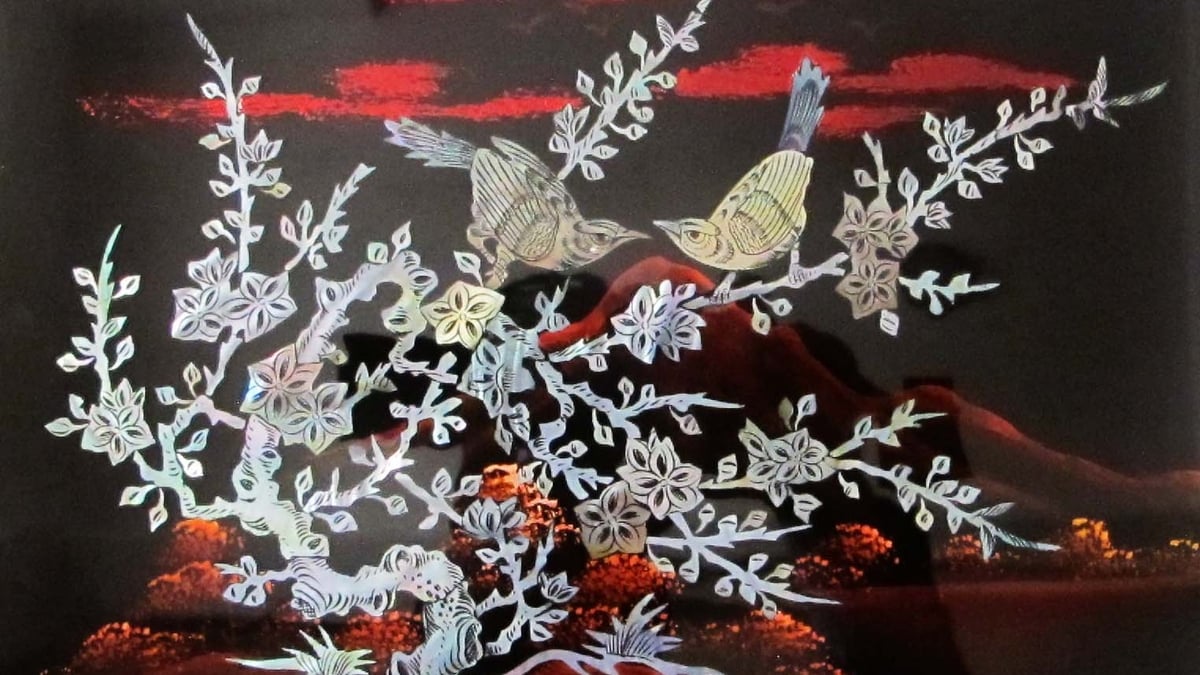


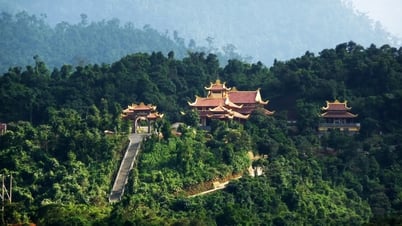

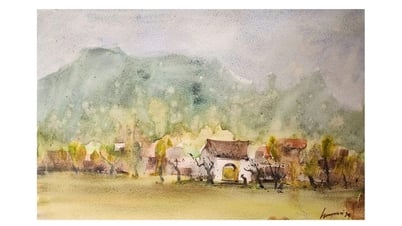


































































Kommentar (0)