„Wir können ins Jahr 2006 zurückkehren.“ Deutschland erinnert sich an die glorreichen Tage der Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 und hofft, dass das Land nach sportlichen Misserfolgen und wirtschaftlichen undpolitischen Herausforderungen im Sommer das WM-Märchen von vor 18 Jahren wieder aufleben lassen kann.

Manchmal kann ein Tor nicht nur die Zuschauer im Stadion begeistern, sondern eine ganze Nation. Vor 18 Jahren erzielte der deutsche Linksverteidiger Philipp Lahm das erste Tor beim WM-Auftaktspiel 2006 gegen Costa Rica. Lahms Traumtor eröffnete ein Turnier, das als „Sommermärchen“ in die deutsche Geschichte einging.
Vier Wochen lang im Juni und Juli 2006 prägte Fußball das Leben in Deutschland. Schätzungsweise 18 Millionen Menschen versammelten sich vor riesigen Videoleinwänden , um die WM-Spiele zu verfolgen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Deutschen von der Vergangenheit belastet und zögerten, Nationalstolz zu zeigen. Das Sommermärchen änderte das.
Plötzlich schienen die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold allgegenwärtig. „Hier sehen Sie ein vereintes und glückliches deutsches Volk“, sagte der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan. „So hat sich der liebe Gott die Welt vorgestellt, auch wenn wir in der Realität noch 100.000 Jahre davon entfernt sind“, sagte Organisationschef „Kaiser“ Franz Beckenbauer.
Der Begriff „Ein Sommermärchen“ wird sogar vom Duden, dem maßgeblichsten Wörterbuch der deutschen Sprache, wie folgt definiert: „Ein wunderbares, großes Ereignis, das im Sommer stattfindet.“
Es gibt kaum ein „wirtschaftliches Feuerwerk“
Doch während sich Europas größte Volkswirtschaft auf die Ausrichtung eines weiteren großen Fußballturniers vorbereitet, dürfte die Begeisterung von 2006 nicht zurückkehren. „Die Erfahrung der WM 2006 zeigt, dass große Sportereignisse kein wirtschaftliches Feuerwerk sind“, sagte Michael Groemling, Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Viele Verbraucher, so Groemling, könnten die EM 2024 als Gelegenheit sehen, sich einen neuen Fernseher zu kaufen oder beim Anschauen der Spiele ein zusätzliches Bier zu trinken. „Aber sie werden Geld sparen“, so Groemling. „Die Konsumausgaben steigen nicht unbedingt, sie verändern sich.“

Eine im April vom Augsburger Institut für Generationenforschung durchgeführte Umfrage ergab, dass jeder fünfte Bundesbürger nicht wusste, dass in Deutschland bald ein großes Sportereignis stattfinden würde. In derselben Umfrage sprachen 88 Prozent lediglich über vergangene Fußballturniere.
Deutschland war im vergangenen Jahr das einzige Industrieland, das nach einer Rezession in den ersten drei Monaten des Jahres kein Wachstum verzeichnete. Im März korrigierte eine Gruppe führender deutscher Ökonomen ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr von 1,2 Prozent auf nahezu stagnierende 0,1 Prozent nach oben. Hohe Energiepreise und steigende Produktionskosten schürten die Sorge vor einem industriellen Abschwung. In einer Eurobarometer-Umfrage im Frühjahr glaubten nur 14 Prozent der Deutschen an eine Verbesserung der Konjunktur in den nächsten zwölf Monaten – weniger als in den meisten anderen EU-Ländern.
Die Europameisterschaft 2024 könnte den zehn Austragungsstädten einen kleinen wirtschaftlichen Aufschwung bescheren. Laut IW-Studien wird sich dies jedoch nicht auf das Bruttoinlandsprodukt auswirken. Mit bereits 2,7 Millionen verkauften Tickets können die Austragungsstädte Berlin, München, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig und Stuttgart mit einem starken Zustrom nationaler und internationaler Besucher rechnen.
„Die Menschen reisen aktiver, zum Beispiel zu Großveranstaltungen und Konzerten mit internationalen Stars“, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). „Möglicherweise wird 2024 ein neues Rekordjahr für den Deutschlandtourismus – auch dank der vielen begeisterten Fußballfans, die das Event live erleben wollen.“
„Bei früheren Fußballgroßereignissen wurde während des Turniers mehr Bier getrunken als in den üblichen Sommerwochen“, sagte Holger Eichele vom Deutschen Brauer-Bund. Bei der WM 2006, die ebenfalls in Deutschland ausgetragen wurde, stieg der Bierabsatz vor und während des Turniers um rund 5 Prozent. Ein Sprecher des Konsumgüterverbands sagte, die Umsätze im Einzelhandel könnten steigen, wenn die Gastgeber sportlich gut abschneiden: „Nur wenn die deutsche Nationalmannschaft die Vorrunde übersteht, wird sich die Verbraucherstimmung verbessern.“
Dies wäre besonders zu begrüßen, da 2023 ein schwieriges Jahr für die Bierindustrie war. Laut Regierungsdaten sanken die Inlandsverkäufe um 4,5 Prozent auf 8,4 Milliarden Liter und setzten damit einen langfristigen Abwärtstrend fort.
Aber der Fußball hat einen viel größeren Einfluss.
Der psychologische Effekt dürfe jedoch nicht unterschätzt werden. „Ein großes Sportereignis kann die Stimmung heben und das Image des Gastgeberlandes verbessern“, erklärte der Experte in einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Er verwies auf die Attraktivität des Ereignisses in einer Zeit rückläufiger ausländischer Direktinvestitionen im Land.
Die Blütezeit von Angela Merkels weiblicher Ära fiel mit einer Phase der Dominanz der deutschen Fußballnationalmannschaft unter Trainer Joachim Löw zusammen. Während Löw Deutschland 2014 zum vierten Weltmeistertitel führte, erlebte die deutsche Wirtschaft in der ersten Hälfte von Merkels Amtszeit einen Aufschwung. Trotz eines starken Rückgangs des BIP in den Jahren 2008 und 2009 verzeichnete Deutschland während der globalen Rezession nur einen geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Als Kanzlerin und Trainer 2021 ihre Ämter verließen, wurde es schwierig. „Es gibt einige Ähnlichkeiten mit dem Fußball“, sagte ein deutscher Oppositionspolitiker. „Die WM 2006 galt als so erfolgreich, dass der Deutsche Fußball-Bund keine Innovationen wagte. Der deutsche Fußball hat es nicht geschafft, moderne Stürmer wie Kylian Mbappé oder Erling Haaland hervorzubringen. Es fühlte sich an, als wären die deutsche Politik und der deutsche Fußball gleichzeitig abgestanden. Das war um 2018.“
Doch genau dieser Zufall war es, der die Deutschen erneut auf einen „Märchensommer“ warten ließ. Die Stimmung in Deutschland war vor der WM 2006 ähnlich düster. Wirtschaftliche Stagnation, hohe Arbeitslosigkeit und eine heftige Debatte über die Arbeitsmarktreform Anfang der 1990er Jahre hatten dem Land den Ruf des „kranken Mannes Europas“ eingebracht. Gleichzeitig hatte die deutsche Nationalmannschaft 1998 schwache Leistungen gezeigt und war bei den Europameisterschaften 2000 und 2004 gescheitert. „Die ganze Welt lacht über unsere Verlierer“, schrieb die Bild-Zeitung damals.
Nun besteht Hoffnung, dass die EM ein unvergesslicher Sommer wird. Nach einem holprigen Start unter dem erst 36-jährigen Nagelsmann zeigt die Nationalmannschaft vielversprechende Leistungen. Julian Nagelsmann ist, wie Klinsmann 2006, bereit, alle Regeln zu brechen.
„2006 hat die Macht des Fußballs die Skeptiker dazu gebracht, ihre Arme auszustrecken und eine große Party zu veranstalten“, sagt der Soziologe Thomas Druyen. „Heute ist die deutsche Gesellschaft zutiefst enttäuscht. Dies ist eine historische Chance, die emotionale Sackgasse zu überwinden.“
YEN PHUONG
[Anzeige_2]
Quelle: https://www.sggp.org.vn/nuoc-duc-cho-doi-co-tich-mua-he-tu-euro-2024-post744516.html











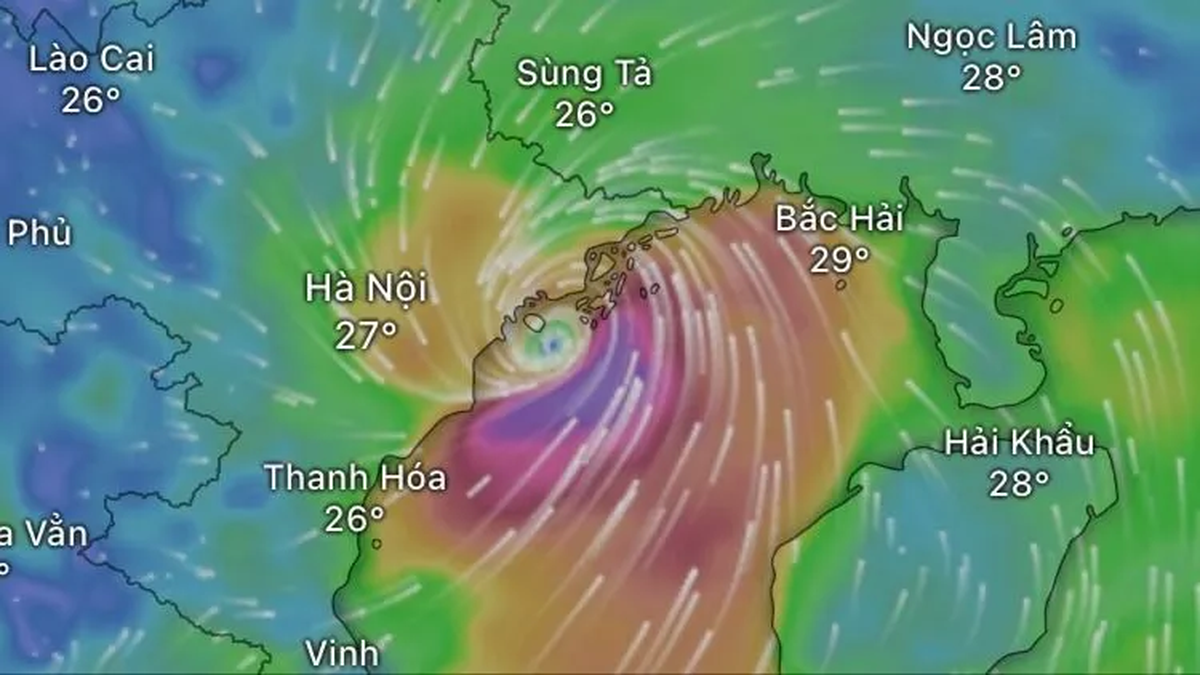

























































































Kommentar (0)