Moustapha & Yu führten eine quantitative Studie in 35 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durch und fanden heraus, dass eine Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) um 1 % zu einer Steigerung des realen BIP-Wachstums um 2,83 % beitragen kann. Dies verdeutlicht die zentrale Rolle von Innovationen für ein langfristiges Wirtschaftswachstum .
Laut Statistiken der Weltbank aus dem Jahr 2024 ist in Vietnam das Verhältnis der Ausgaben für Forschung und Entwicklung zum BIP von 0,3 % im Jahr 2013 auf 0,43 % im Jahr 2021 gestiegen. Dies ist ein positiver Fortschritt, aber im Vergleich zum Durchschnitt der Industrieländer (normalerweise zwischen 2 % und 4 % des BIP) immer noch niedrig.
Vietnam steht noch immer vor zahlreichen Herausforderungen, wie etwa Einschränkungen bei der Einführung und Beherrschung neuer Technologien, fehlenden Verbindungen zwischen Unternehmen und Universitäten und einer ineffektiven Nutzung globaler intellektueller Ressourcen.
AVSE Global (Vietnam Science and Expert Organization Global) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Paris, die in Zusammenarbeit mit dem Volkskomitee der Provinz Ninh Binh das Vietnam Research and Development Forum 2025 (Vietnam R&D Forum – VRDF 2025) unter dem Motto „Förderung der Zukunft Vietnams durch strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung“ organisiert.
Von dieser Veranstaltung erwartet man, dass sie einen strategischen Schritt darstellt, um den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft zu fördern und gleichzeitig die endogene Innovationsfähigkeit zu stärken – ein Schlüsselfaktor für eine nachhaltige Entwicklung und die Stärkung des nationalen Status.
VietNamNet führte ein Interview mit Herrn Hamilton Mann über die Forschungs- und Entwicklungsstrategie in Vietnam. Herr Hamilton ist ein internationaler Technologieexperte und derzeit Group Vice President bei Thales, wo er das globale digitale Transformations- und KI-Programm für das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Cybersicherheit mitleitet.

Wem und was dient F&E?
Herr Hamilton Mann, was sind die grundlegenden Elemente für die Etablierung eines langfristigen und nachhaltigen Verbindungsmechanismus zwischen den Interessengruppen im F&E-Ökosystem – etwa dem Staat, Unternehmen, Instituten/Schulen und der internationalen Gemeinschaft?
Entscheidend ist nicht, was Sie mit F&E erreichen wollen, sondern die grundlegendere Frage: Wem dient F&E und zu welchem Zweck? Dies ist das erste grundlegende Element: Der Zweck von F&E muss neu definiert werden – nicht als intrinsischer Motivator, sondern als verbindender Dreh- und Angelpunkt.
F&E muss als Plattformmodell konzipiert werden – eine Struktur, die Wertschöpfung in mehreren Dimensionen ermöglicht. Innerhalb dieser Plattformlogik ist der Ausgangspunkt jeder technologischen F&E-Aktivität im Wesentlichen eine „ideologische F&E“: Das heißt, es geht darum, bewusst zu fragen, warum Innovation notwendig ist und wem sie dient.
Jede Gruppe – von Behörden, privaten Unternehmen, der Wissenschaft bis hin zur Zivilgesellschaft – hat ihre eigenen Prioritäten, Zwänge und Kapazitäten. Ziel ist nicht die Vereinheitlichung, sondern die Schaffung eines Umfelds, in dem unterschiedliche Beiträge die Gesamtentwicklung fördern und zu Ergebnissen führen, die besser sind als das, was jeder Einzelne allein erreichen könnte.
Wille und Inklusivität reichen jedoch nicht aus. Der zweite grundlegende Faktor sind Unterstützungsmechanismen. Damit sich das F&E-Plattformmodell entwickeln kann, müssen die Beteiligten zwei Haupthürden überwinden: Zugangskosten – einschließlich Informationen, Finanzen, Infrastruktur und Partner; Transaktionskosten – einschließlich rechtlicher, technischer, kultureller und organisatorischer Hürden, die Vertrauen, Koordination und Umsetzung behindern.
Diese Mechanismen bieten nicht nur Zugriff, sondern gewährleisten auch Stabilität, Interoperabilität und Verantwortlichkeit.
Kurz gesagt bilden zwei Elemente – gemeinsame Ziele und systemische Mechanismen – die Grundlage für die Entwicklung eines nachhaltigen F&E-Ökosystems.
Gibt es aufgrund Ihrer Erfahrungen in Europa und am MIT typische F&E-Kooperationsmodelle, von denen Vietnam lernen kann, um langfristige strategische Partnerschaften aufzubauen?
Sowohl Europa als auch das MIT bieten F&E-Modelle an, die nicht zum Kopieren gedacht sind, sondern aus denen sich Prinzipien ableiten lassen, die an den Kontext angepasst werden können. Dies ist insbesondere für Länder wie Vietnam nützlich, die Innovationsökosysteme aufbauen und ihre Position in der globalen Wertschöpfungskette behaupten möchten.
Fraunhofer-Modell (Deutschland): Das Fraunhofer-Modell zeichnet sich durch sein hybrides Finanzierungssystem aus: Rund 30 % aus dem Landeshaushalt, 70 % aus anwendungsorientierten Forschungsaufträgen mit Unternehmen. Fraunhofer-Institute sind oft eng mit lokalen Industrieclustern verknüpft, haben eine klare Missionsorientierung und konzentrieren sich auf marktreife Innovationen.
Die Lektion für Vietnam liegt nicht im Organisationsmodell, sondern im Prinzip – der Verknüpfung von Forschungskapazitäten mit der Mission, der Industrie zu dienen und Eigentum und Risiken zu teilen.
EIT- und KIC-Modell (Europa): Europäische Innovations- und Technologieinstitute (EIT) und Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) sind europaweite öffentlich-privat-akademische Netzwerke zu großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klima, Gesundheit, Verkehr, Digitalisierung usw.
Dieses Modell ermöglicht sowohl lokale Experimente als auch Lernen auf Systemebene.
Vietnam kann diese Logik anwenden, um regionale Kompetenzzentren aufzubauen, nicht allein, sondern als Grundlage für die Entwicklung von Ökosystemen rund um nationale Missionen wie digitale Infrastruktur, intelligente Landwirtschaft oder Anpassung an den Klimawandel.
MIT Industrial Liaison Program (ILP): ILP verbindet nicht nur Unternehmen mit Fakultäten, sondern konzipiert auch langfristige strategische Beziehungen zwischen globalen Unternehmen und dem Innovationsökosystem des MIT, darunter Startups, Spin-offs und angewandte Labore.
MIT Jameel World Education Lab (J-WEL): Dieses Programm arbeitet mit Regierungen, Universitäten und Entwicklungsfonds in Entwicklungsländern zusammen, um Innovationskapazitäten gemeinsam zu schaffen, anstatt sie einfach zu übertragen. Es zeichnet sich durch sein langfristiges Engagement und seinen Fokus auf den Aufbau institutioneller Kapazitäten aus.
Vietnam – mit seiner Vorliebe für Investitionen in Bildung und digitale Transformation – könnte von diesem Modell durchaus profitieren, und zwar in Form mehrjähriger Programme zur Kapazitätsentwicklung, die eher auf den Aufbau als auf die Ausbeutung abzielen.
Politik hilft Ideen, sich zu „investierbaren Signalen“ zu entwickeln
Ein häufiges Problem in Entwicklungsländern ist die Kluft zwischen Forschung und Markt. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Politik bei der Förderung des Transfers und der Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen in Vietnam?
Die Lücke zwischen Forschung und Markt wird oft fälschlicherweise als Mangel an Technologie oder Unternehmergeist interpretiert. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Designlücke – das Versäumnis, Motivation, Kapazität und Timing des Forschungsökosystems mit dem Marktökosystem in Einklang zu bringen.
Hier kommt der öffentlichen Politik eine entscheidende Rolle zu, und zwar nicht nur bei der Finanzierung, sondern auch bei der Schaffung der Voraussetzungen, damit der Transfer zu einer nachhaltigen Norm wird und Werte schafft.
Die öffentliche Politik muss auf drei integrierten Ebenen eingreifen:
Missionsrahmen: Ein Beispiel hierfür sind die Catapult-Zentren in Großbritannien, die staatlich gefördert werden, um strategische Industriemissionen (fortgeschrittene Fertigung, Energie, Zellmedizin usw.) durchzuführen. Die Politik ist hier nicht ergebnisorientiert, sondern zielorientiert – sie hilft Unternehmen zu verstehen, für wen und wofür sie Forschung und Entwicklung betreiben sollten.
Aufbau einer Plattform – Reduzierung von Systemreibungen: Ein prominentes Beispiel ist das VTT in Finnland, das nicht nur ein Forschungsinstitut, sondern auch ein neutraler Integrator zwischen Wissenschaft und Industrie ist. Es bietet gemeinsame Labore, unterstützt den Transfer von geistigem Eigentum und die Projektkoordination und reduziert so die Zugangs- und Transaktionskosten.
Kapazitätsaufbau – die Lücke zwischen den Vermittlern schließen: Ein großes Problem in Entwicklungsländern ist der Mangel an vermittelnden Institutionen und Kompetenzen, die Forschungsergebnisse in Geschäftsmodelle, Prototypen oder Rechtsstrategien umsetzen können. Ein Beispiel hierfür ist Israel: Die Israelische Innovationsbehörde (IIA) fördert nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern investiert auch in Technologietransferbüros, Ideentestprogramme, öffentlich-private Inkubatoren usw.
Die Strategie besteht darin, Ideen dabei zu unterstützen, sich zu „investierbaren Signalen“ zu entwickeln – dies ist die entscheidende Wertschöpfungsebene, die Vietnam aufbauen muss.
Kurz gesagt: Die öffentliche Politik muss als Bindeglied zwischen Wissenschaft, Märkten und Gesellschaft konzipiert werden, und zwar nicht nur durch die Finanzierung, sondern auch durch Normen, gemeinsame Infrastruktur, Anreize und soziale Legitimität.
Die Politik muss eine Architektur für Forschung und Entwicklung schaffen: Orientierung – Reibungsverluste reduzieren – Kapazitäten erhöhen. Dann ist die Kommerzialisierung kein Engpass mehr, sondern ein strategischer Motor für die nationale Wertschöpfung.
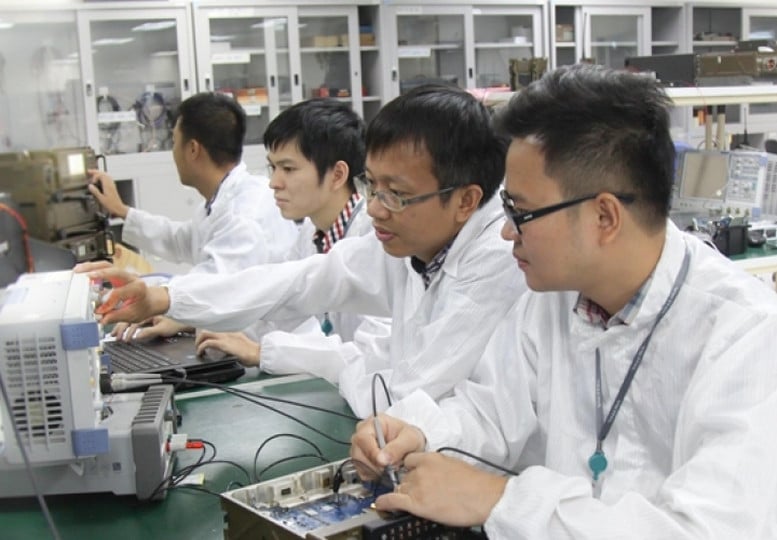
Damit Unternehmen nicht länger „Empfänger“, sondern Lernpartner sind
Im Innovationsökosystem sind Unternehmen oft „Wissenskäufer“. Wie kann sich der Privatsektor in Vietnam Ihrer Meinung nach aktiver an F&E-Investitionen beteiligen und Forschungsergebnisse aus dem akademischen Sektor nutzen?
Zunächst möchte ich das Konzept des „Wissenskäufers“ an sich in Frage stellen.
Die Betrachtung von Unternehmen als „Käufer von Wissen“ spiegelt eine transaktionale Sichtweise von Innovation wider – die Wissenschaft produziert und die Industrie konsumiert. Tatsächlich entsteht Innovation jedoch nicht durch bloßen Wissenstransfer, sondern durch die Ko-Evolution von Wissen und Nachfrage.
Dies erfordert vom privaten Sektor nicht nur, dass er Forschung aufnimmt, sondern auch proaktiv die Bedingungen dafür gestaltet, dass Forschung relevant, anwendbar und skalierbar ist.
In Vietnam bedeutet dies, Unternehmen zum „Zentrum“ des Innovationsökosystems zu machen. Es geht nicht nur darum, Mittel bereitzustellen, wenn es passt, sondern von Anfang an mitzuwirken, Fähigkeiten zu integrieren und den Innovationspfad gemeinsam zu gestalten.
Modell aus Dänemark: GTS Institute of Advanced Technology: Dieses Institut fungiert als Vermittler für angewandte Forschung und Entwicklung zwischen Universitäten und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Seine Stärke liegt darin, dass insbesondere mittelständische Unternehmen Kapital in Technologieplattformen bündeln, die sie allein nicht entwickeln könnten. Unternehmen kaufen nicht einfach Forschung, sondern identifizieren gemeinsam Probleme, testen Lösungen und reduzieren Innovationsrisiken.
Dies ist ein wirksames Modell für vietnamesische Unternehmen, um den Bedarf an angewandter Forschung strategisch zu decken, insbesondere in wichtigen Bereichen wie Hightech-Landwirtschaft, Logistik, umweltfreundlicher Fertigung usw.
Vorbild aus Singapur: A*STARs Tech Access Initiative: Hier erhalten Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Unternehmen – mit staatlicher Unterstützung Zugang zu Laboren und hochmoderner Ausrüstung zu Vorzugspreisen, dazu technische Beratung, Probentests, Schulungen... Forschung ist kein „Luxus“ mehr, sondern für Unternehmen zu einer „Kapazitäten-Startrampe“ geworden.
In diesem Modell bringt der private Sektor praktische Probleme, Produktentwicklungsbedürfnisse und Innovationsziele in das System ein und wird so zum Mitbestimmenden der angewandten F&E-Programme, statt passiv darauf zu warten, dass akademische Ergebnisse „nach unten fließen“.
Sie sind nicht länger „Empfänger“, sondern Lernpartner und Multiplikatoren der nationalen F&E-Ressourcen, die die Forschungsinfrastruktur in eine Plattform für langfristige Wettbewerbsfähigkeit verwandeln.
Der wichtigste strategische Wandel liegt in der Denkweise: Talententwicklung, Vertrauensbildung und eine langfristige Vision sind ebenso wichtig wie geistige Eigentumsrechte.
Unternehmen müssen über die Denkweise des „Return on Product“ hinausgehen und sich dem „Return on Participation“ zuwenden – was die Faktoren Menschen, Zusammenarbeit und Ökosystem einschließt.
Wenn Unternehmen nicht nur zu „Käufern von Wissen“, sondern zu „Erzeugern von Wissen“ werden, beschleunigen sie nicht nur ihre eigene Innovationskraft, sondern steigern auch die gesamte kreative Kapazität eines Landes.
* Teil 2: F&E-Investitionen müssen mit der „nationalen Mission“ verknüpft sein
Hamilton Mann ist ein internationaler Technologieexperte, Bestsellerautor und derzeit Group Vice President bei Thales, wo er das globale Programm zur digitalen Transformation und KI für das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Cybersicherheit mitleitet.
Er ist Dozent an INSEAD und HEC Paris und Doktorand für Künstliche Intelligenz an der École des Ponts – Polytechnic Institute of Paris. Hamilton ist außerdem Berater am Priscilla King Gray Center (MIT) und Senior Fellow am Retech Center (Frankreich).
Im Jahr 2024 wurde er vom Technology Magazine als einer der Top 10 Global Technology Thinker ausgezeichnet, in das Thinkers50 Radar aufgenommen und erhielt 2025 von den Who Is Who International Awards den Titel „Digital & AI Leader for Humanity“.

Quelle: https://vietnamnet.vn/khi-doanh-nghiep-khong-chi-la-nguoi-mua-ma-la-nguoi-kien-tao-tri-thuc-2426559.html






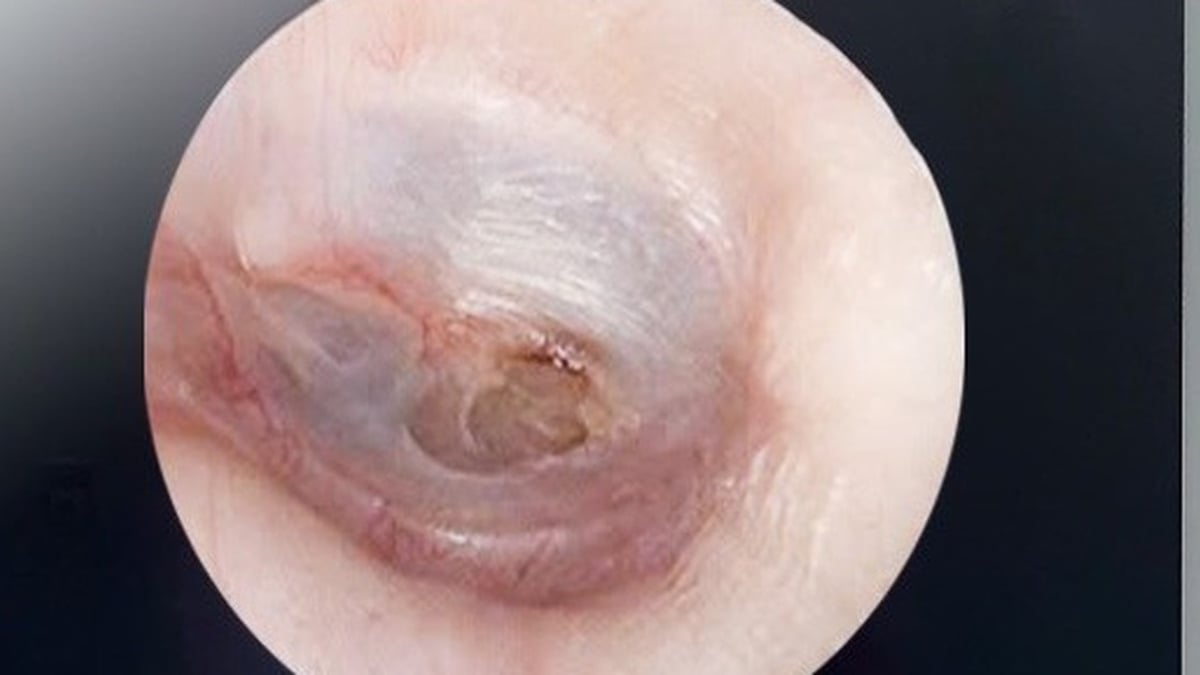




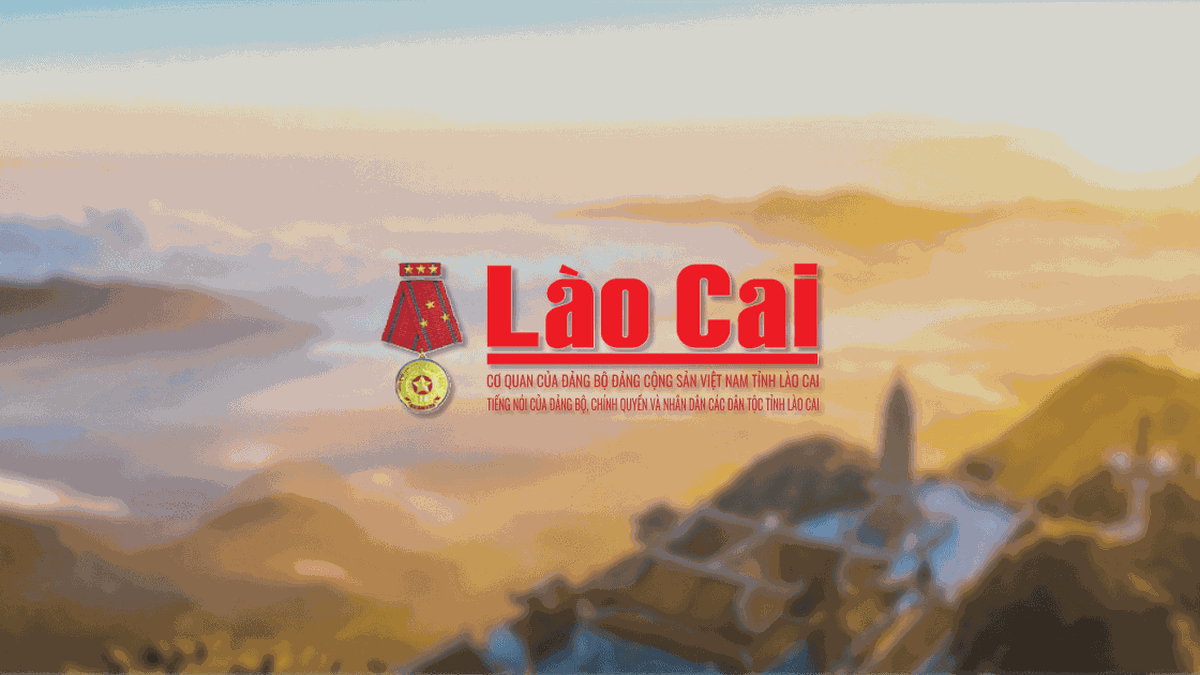















![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)

























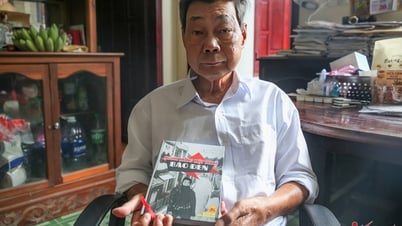


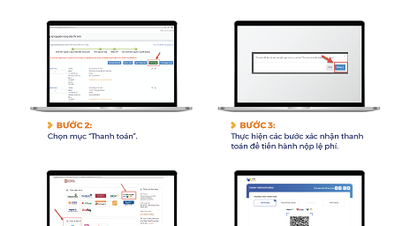










































Kommentar (0)