
Die sandige Sahara war einst übersät mit Seen und Flüssen, während einer Periode, die als Feuchtperiode in Afrika bekannt ist - Foto: Sapienza-Universität Rom
Die Sahara ist einer der trockensten und ödesten Orte der Erde. Sie erstreckt sich über einen Streifen Nordafrikas, durch elf Länder und bedeckt eine Fläche von etwa der Größe Chinas oder der USA. Eine neue Studie in der Fachzeitschrift „Nature“ legt jedoch nahe, dass die Wüste nicht immer so hart war.
Es gibt eine grüne Sahara
Vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren war die Region eine üppige, grüne Steppe, reich an Wasser und voller Leben, wie Forschungen belegen. Und DNA-Analysen aus den Überresten zweier Menschen, die vor etwa 7.000 Jahren im heutigen Libyen lebten, belegen, dass hier eine geheimnisvolle Abstammungslinie lebte, die isoliert von der Außenwelt .
Forscher haben die ersten Genome von Menschen analysiert, die in der sogenannten „Grünen Sahara“ lebten. Sie entnahmen DNA aus den Knochen zweier Frauen, die in einem Felsvorsprung namens Takarkori im abgelegenen Südwesten Libyens begraben waren. Die Frauen waren auf natürliche Weise mumifiziert und stellen die ältesten bekannten mumifizierten menschlichen Überreste dar.
„Damals war Takarkori eine üppige Steppe mit einem nahegelegenen See, ganz anders als die trockene Wüstenlandschaft von heute“, sagte der Archäologe Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Deutschland), einer der Autoren der Studie.
Die Genome zeigen, dass die beiden Takarkori-Völker einer separaten und bislang nicht identifizierten menschlichen Linie angehören, die Tausende von Jahren getrennt von den Populationen südlich der Sahara und Eurasiens lebte.
„Interessanterweise zeigen die Takarkori keinen signifikanten genetischen Einfluss von Populationen südlich der Sahara im Süden oder im Nahen Osten und prähistorischen europäischen Gruppen im Norden“, sagte Krause. „Das deutet darauf hin, dass sie trotz der Viehzucht – einer kulturellen Innovation, die ihren Ursprung außerhalb Afrikas hat – genetisch isoliert blieben.“
Archäologische Funde deuten darauf hin, dass diese Menschen Vieh hüteten. Zu den an der Stätte gefundenen Artefakten gehören Werkzeuge aus Stein, Holz und Tierknochen, Töpferwaren, geflochtene Körbe und geschnitzte Figuren.
Mysteriöse isolierte Menschen

Eine 7.000 Jahre alte natürliche Mumie, die in einer Höhle im Süden Libyens gefunden wurde, enthält noch immer DNA – Foto: Sapienza-Universität Rom
Die Vorfahren der beiden Takarkori stammten aus einer nordafrikanischen Linie, die sich vor etwa 50.000 Jahren von den Völkern südlich der Sahara abspaltete. Dies geschah zu der Zeit, als sich andere menschliche Linien über den Kontinent und in den Nahen Osten, nach Europa und Asien ausbreiteten – und so zu den Vorfahren aller Völker außerhalb Afrikas wurden.
„Die Takarkori-Linie könnte Überreste der genetischen Vielfalt darstellen, die vor 50.000 bis 20.000 Jahren in Nordafrika vorhanden war“, sagte Krause.
„Genetische Belege deuten darauf hin, dass ab vor 20.000 Jahren Gruppen aus dem östlichen Mittelmeerraum einwanderten, gefolgt von Migrationen aus Iberien und Sizilien vor etwa 8.000 Jahren. Aus bislang ungeklärten Gründen blieb die Takarkori-Linie jedoch viel länger isoliert als erwartet. Da die Sahara erst vor etwa 15.000 Jahren bewohnbar war, bleibt ihre ursprüngliche Heimat ungewiss“, fügte er hinzu.
Ihre Abstammungslinie blieb lange Zeit isoliert, bevor die Sahara erneut unbewohnbar wurde. Am Ende eines wärmeren, feuchteren Klimas, bekannt als die Afrikanische Feuchtperiode, verwandelte sich die Sahara um 3.000 v. Chr. in die größte heiße Wüste der Welt.
Mitglieder unserer Spezies Homo sapiens, die sich von Afrika aus ausbreiteten, trafen auf Neandertaler in Teilen Eurasiens und kreuzten sich mit ihnen. So hinterließen sie ein bleibendes genetisches Erbe in nichtafrikanischen Populationen. Die Menschen der Grünen Sahara trugen jedoch nur geringe Mengen Neandertaler-DNA in sich, was darauf hindeutet, dass sie nur sehr wenig Kontakt zu anderen Populationen hatten.
Obwohl die Takarkori-Bevölkerung selbst vor etwa 5.000 Jahren mit dem Ende der afrikanischen Feuchtperiode und der Rückkehr der Wüste verschwand, sind laut Krause in vielen nordafrikanischen Gruppen bis heute Spuren ihrer Vorfahren erhalten geblieben.
„Ihr genetisches Erbe bietet eine neue Perspektive auf die lange Geschichte dieser Gegend“, sagte er.
Quelle: https://tuoitre.vn/phat-hien-dau-vet-toc-nguoi-bi-an-o-sa-mac-sahara-20250406071654501.htm



































































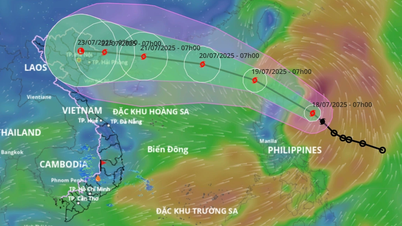





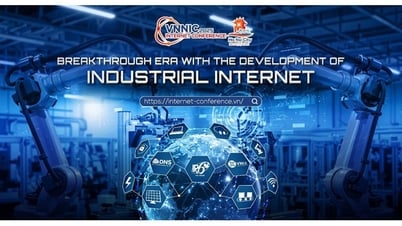






















![[Infografik] Im Jahr 2025 werden 47 Produkte das nationale OCOP erreichen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





Kommentar (0)