Aufgrund der engen Finanz- und Handelsbeziehungen können die Auswirkungen einer Aufwertung des US-Dollars oder einer Zinserhöhung der Fed in Europa manchmal größer sein als in den USA.
Nicht nur die Amerikaner warten gespannt darauf, ob die Federal Reserve die Zinsen erhöht oder das Land in eine Rezession stürzt; auch die Europäer und viele andere Länder tun dies. Denn trotz aller Diskussionen über Deglobalisierung und Dedollarisierung ist der Dollar dort immer noch König. Die Finanz- und Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren wichtigsten Partnern sind stärker denn je. Im Falle Europas sind sie sogar noch stärker.
Anfang letzten Jahres versuchte die Europäische Zentralbank (EZB), einen anderen Kurs als die Fed einzuschlagen. Sie plante, die Zinsen trotz der Zinserhöhungen der Fed niedrig zu halten. Doch als der Euro gegenüber dem Dollar fiel, sah sich die EZB gezwungen, ihren Kurs rasch zu ändern, da sie inflationäre Importe von in Dollar bezahlten Energieprodukten befürchtete.
Nun steht die Herausforderung im umgekehrten Fall. Die Fed hat signalisiert, dass sie ihre Zinserhöhungen auf ihrer Juni-Sitzung aussetzen wird, um zu prüfen, ob der Anstieg um fünf Prozentpunkte seit Jahresbeginn die US- Wirtschaft deutlich gebremst hat. Das könnte es der EZB erschweren, die Zinsen angesichts der hohen Inflation zu erhöhen. „Der Dollar spielt eine dominierende Rolle in der Weltwirtschaft “, sagte Maurice Obstfeld, ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds.
Da Länder wie Saudi-Arabien, China und Russland zunehmend andere Währungen nutzen, wird zunehmend darüber spekuliert, dass der Dollar seinen Status als Reservewährung verliert. Dies ist eine Reaktion darauf, dass die USA den Dollar als Waffe einsetzen, beispielsweise durch das Einfrieren der russischen Devisenreserven. Im zweiten Quartal 2022 machte der Dollar weniger als 60 % der weltweiten offiziellen Devisenreserven aus, verglichen mit 72 % vor zwei Jahrzehnten. Er verliert also seine Dominanz.
Die USA erwirtschaften zwar nur etwa ein Viertel der globalen Produktion und etwas mehr als 10 Prozent des Welthandels, doch fast die Hälfte des Welthandels wird in Dollar abgewickelt. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich war der Greenback im vergangenen Jahr an fast 90 Prozent der globalen Devisentransaktionen beteiligt.
Etwa die Hälfte aller internationalen Schuldverschreibungen und grenzüberschreitenden Kredite, die auf ausländischen Märkten ausgegeben werden, lauten ebenfalls auf Dollar. Diese Verflechtungen übertragen höhere US-Zinsen auf vielfältige Weise auf andere Volkswirtschaften. Sie ziehen beispielsweise Kapital aus den Volkswirtschaften ab, treiben die Kreditkosten in die Höhe und führen zu einer Abwertung anderer Währungen gegenüber dem Dollar.
Etwa ein Drittel der durch die Straffung der Fed verursachten Zinsänderungen führte laut EZB-Studien zu einem entsprechenden Anstieg der deutschen Zinsen. Mit der Stärkung des Dollars verteuern sich in Dollar gehandelte Rohstoffe – wie etwa Öl –. Höhere Zinsen bremsen zudem das US-Wachstum und verringern die Nachfrage nach ausländischen Gütern.
Das bedeutet, dass die Zinserhöhungen der Fed laut EZB die europäische Wirtschaft ebenso stark beeinflussen wie die der USA. Die Studie ergab zudem, dass die Zinserhöhungen der Fed zwischen 1991 und 2019 die Industrieproduktion, die Aktienkurse, die Unternehmenskredite und die Inflation in der Eurozone verringerten und gleichzeitig den Welthandel außerhalb der USA unter Druck setzten. Im Gegensatz dazu hatten die Maßnahmen der EZB kaum Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.
EZB-Vertreter beobachten die geldpolitischen Maßnahmen der Fed aufmerksam und beobachten den Euro-Dollar-Kurs. „Wenn die Fed vorangeht, folgen andere ohne zu zögern“, sagte Panicos Demetriades, ein ehemaliger EZB-Vertreter und ehemaliger Gouverneur der Zentralbank von Zypern.
Natürlich folgt die EZB nicht nur der Fed, sondern ergreift auch eigene Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation. EZB-Präsidentin Christine Lagarde räumte ein, dass Geld Auswirkungen hat. Eventuelle Spillover-Effekte würden berücksichtigt, aber sie erklärte, sie verlasse sich nicht auf die Fed. „Wir haben mehr Spielraum und werden nicht aufhören“, sagte sie Anfang Mai zur Inflationsbekämpfung.
Die nächsten Schritte der EZB hängen jedoch auch stark von den USA ab. Experte Maurice Obstfeld sagte, der Leitzins der EZB liege rund zwei Prozentpunkte unter dem der Fed, und die EZB habe keine Zeit, aufzuholen.
Ob die EZB künftig ihre Geldpolitik weiter verschärft, hängt davon ab, ob die Fed die USA in eine Rezession treibt. Für Europa sind Exporte – insbesondere in die USA – eine seltene Stütze, wenn die inländische Kaufkraft schwindet. Der Warenhandel zwischen der EU und den USA stieg laut US Census Bureau im März auf 86 Milliarden Dollar, rund 8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Sollten die USA in den kommenden Monaten in eine Rezession geraten, könnten ihre Importe sinken und Europa damit eine Wachstumssäule verlieren. Im Gegenzug würde dies den Dollar schwächen, was Europa günstigere Energie und weniger inflationsfördernde Importe bescheren würde. Das bedeutet, eine Rezession in den USA würde das Leben für die Europäer schwieriger machen, für die EZB jedoch leichter zu bewältigen sein.
„Europa als Ganzes befindet sich in einer ziemlich prekären Lage, die die EZB vorsichtig machen wird“, schätzt Obstfeld.
Phien An ( laut WSJ )
[Anzeige_2]
Quellenlink








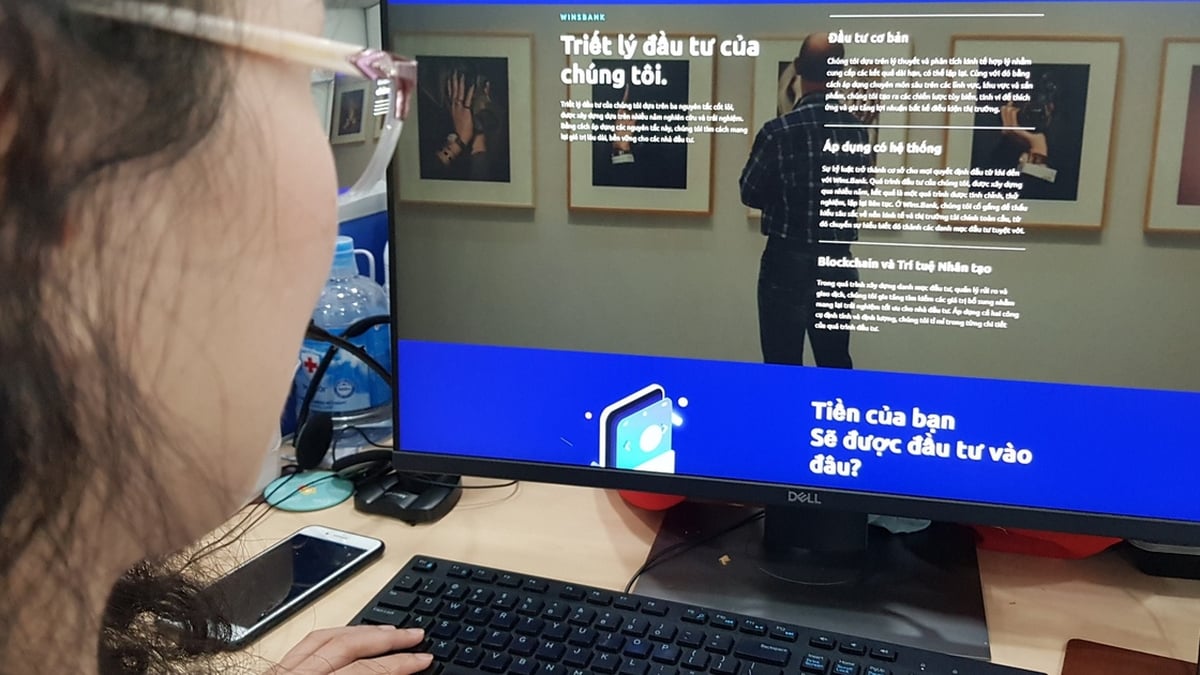

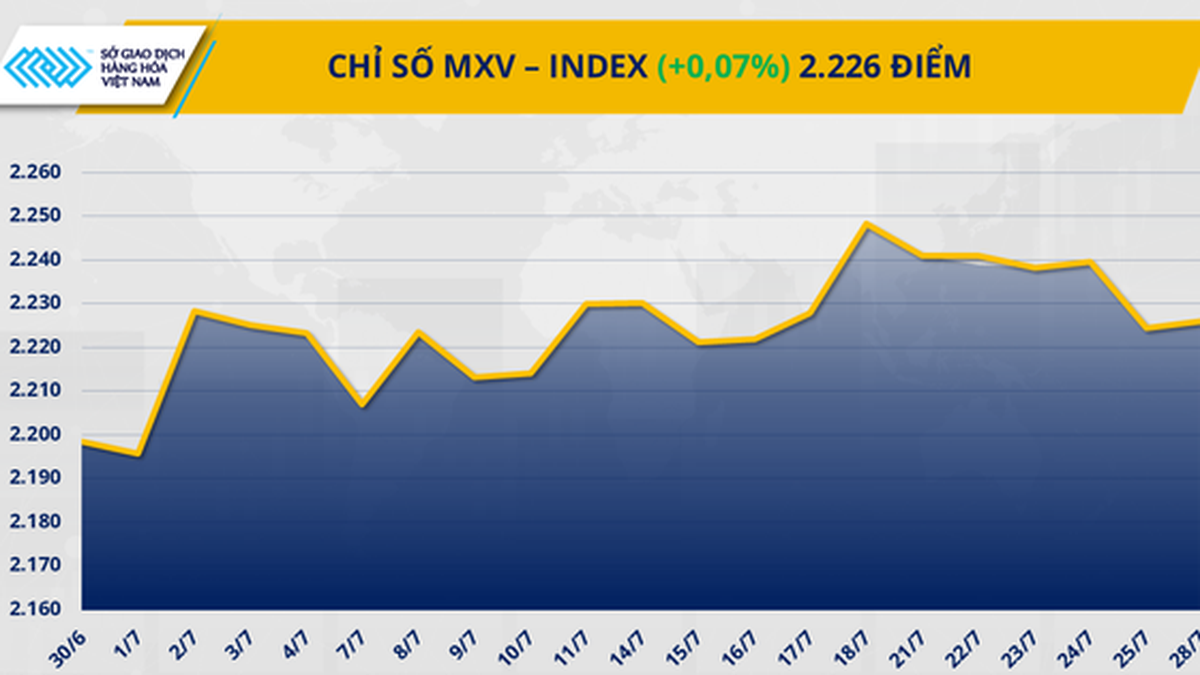














![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
























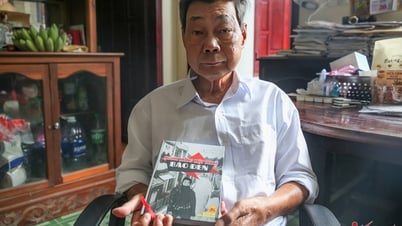


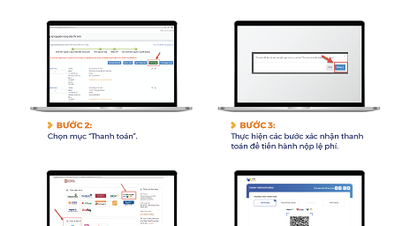














































Kommentar (0)