Wenn sich Irans Atomprogramm in die „Dunkelheit“ zurückzieht
Der Nahe Osten bleibt in letzter Zeit ein globaler Brennpunkt. Nachdem die Diplomatie mit dem Iran gescheitert ist, hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf militärische Maßnahmen gesetzt und wichtige Atomanlagen angegriffen. Obwohl dies bisher keine gravierende Eskalation des Konflikts zur Folge hatte, ist die langfristige Wirksamkeit dieser Strategie fraglich.
Die unmittelbaren technischen Folgen von Angriffen auf das iranische Atomprogramm abzuschätzen, bleibt selbst für die Vereinigten Staaten eine schwierige Aufgabe. Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass die Raketenangriffe der USA und Israels die iranische Nuklearinfrastruktur erheblich beschädigt haben, und detaillierte Analysen sind weiterhin umstritten. Insbesondere das Schicksal der Urananreicherungsbestände – ein Hauptziel der Operation – ist ungewiss.
Berichten zufolge haben selbst US-Geheimdienste eingeräumt, dass es nicht möglich ist, den genauen Standort und das Ausmaß der Schäden an Irans radioaktiven Lagern zu bestimmen. Der Generaldirektor der IAEA schätzt, dass Iran die Urananreicherung innerhalb von zwei Monaten wiederaufnehmen kann. Dies ist jedoch nur eine vorläufige Angabe, da genaue Daten zum Status des Atomprogramms fehlen.
Washingtons Militärkampagne hat zwar einen Teil der iranischen Nuklearinfrastruktur zerstört, gleichzeitig aber den Zugang zu transparenten Informationen eingeschränkt und damit eine diplomatische Lösung der Krise erschwert. Diese Informationslücke könnte bestehen bleiben, insbesondere da Teheran sein Atomprogramm tendenziell im Verborgenen hält, um Angriffe zu vermeiden – ein Vorgehen, das in der Vergangenheit bereits teilweise angewendet wurde.
Beobachter sagen, dass Irans Rückzug in den Untergrund nicht nur die Wirksamkeit der US-amerikanischen Zwangsstrategie verringert, sondern auch die Verhandlungsaussichten negativ beeinflusst. Während die Parteien zuvor konkret über die Anzahl der Zentrifugen oder den Grad der Urananreicherung sprechen konnten, ist der Abschluss eines neuen Abkommens angesichts der Instabilität und mangelnden Transparenz nun deutlich schwieriger geworden.
Von der Abschreckung zur Konfrontation: Ein Kreislauf ohne absehbares Ende
Die Trump-Regierung scheint ein neues Atomabkommen nicht länger als Voraussetzung für eine Lösung der Iran-Krise zu betrachten. Auf dem jüngsten NATO-Gipfel erklärte Präsident Trump, ein neues Abkommen sei unnötig. Dies deutet darauf hin, dass Washington Raketenangriffe für ausreichend hält, um die Bedrohung langfristig einzudämmen, selbst wenn diese das iranische Atomprogramm nicht vollständig zerstören. Sollte der Iran sein Programm wieder aufnehmen, könnten die USA erneut militärisch eingreifen.
Viele äußerten jedoch Zweifel an dieser US-Strategie. Erstens widersprechen die US-Geheimdienste Präsident Trumps Aussage; sie glauben, dass Irans Atomprogramm nicht vollständig zerstört wurde. Zweitens sind wiederholte Angriffe aufgrund der zunehmenden Intransparenz des Programms nicht nur technisch wirkungslos, sondern bergen auch das Risiko einer Eskalation des Konflikts. Jede militärische Intervention der USA erhöht das Risiko eines regionalen Krieges. Dass es bisher nicht zu einer Eskalation gekommen ist, ist keine Garantie dafür, dass dies in Zukunft der Fall sein wird.
Tatsächlich könnten die Angriffe den Iran in seinem Entschluss bestärken, sein Atomprogramm – offen oder verdeckt – als Mittel zur Sicherung seiner Sicherheit weiterzuverfolgen. Dies würde die Vereinigten Staaten zu wiederholten militärischen Interventionen zwingen, ohne eine klare Strategie zur vollständigen Beseitigung der potenziellen iranischen Nuklearkapazitäten zu verfolgen. Gleichzeitig würde die zunehmende Intransparenz künftige Verhandlungsbemühungen behindern.
Darüber hinaus wirkt sich die Unsicherheit über das iranische Atomprogramm weiterhin destabilisierend auf die Region aus. Je geringer die Transparenz, desto größer ist das Risiko, dass die Golfstaaten vorsorglich eigene Nuklearkapazitäten entwickeln, selbst wenn es sich nur um potenzielle handelt. Dies mag zwar nicht unmittelbar zur Entstehung einer neuen Atommacht führen, doch es wird genügen, um die Verbreitung nuklearer Fähigkeiten in der Region zu fördern und die strategische Instabilität zu erhöhen.
Washington, das es sich nicht leisten kann, sich aus jeder größeren Krise im Nahen Osten herauszuhalten, wird kontinuierlich militärische, diplomatische und politische Ressourcen investieren müssen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen – etwas, das Präsident Trump zu vermeiden suchte. Eine erwogene Option ist ein Regimewechsel in Teheran. Sollte eine prowestliche Regierung an die Macht kommen, könnte sie ihr Atomprogramm beenden und die Unterstützung regionaler Stellvertreter einstellen. Die Aussicht auf einen gewaltsamen Regimewechsel ist jedoch eindeutig unrealistisch. Statt das iranische Volk zu schwächen, haben die Angriffe es angesichts einer äußeren Bedrohung geeint. Zwar ist das politische System des Irans nicht völlig stabil, insbesondere im Falle des Todes des Obersten Führers Khamenei, doch niemand kann genau vorhersagen, wer die Macht übernehmen und ob sich dessen Politik ändern wird. Darüber hinaus haben die Angriffe auf die USA und Israel den Einfluss der Kräfte geschwächt, die eine Zusammenarbeit mit dem Westen befürworten, wodurch die Möglichkeit eines Kurswechsels noch unwahrscheinlicher geworden ist.
Die Aussichten auf eine diplomatische Lösung der iranischen Atomkrise in naher Zukunft bleiben gering. Trotz der militärischen Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran haben sich die Positionen beider Seiten kaum verändert: Washington fordert weiterhin, dass der Iran auf sein Recht zur Urananreicherung verzichtet, während Teheran dies als eine rote Linie betrachtet, die nicht überschritten werden darf.
Auch nach den US-Raketenangriffen hat die Urananreicherung für den Iran als alternative Abschreckungsmöglichkeit zu seinen konventionellen militärischen Fähigkeiten, die sich als unzureichend erwiesen haben, um eine Intervention von außen zu verhindern, noch an Bedeutung gewonnen. Selbst wenn Teheran keine Absicht hat, Atomwaffen zu entwickeln, wird eine leistungsfähige Urananreicherungsinfrastruktur als einziges Mittel gesehen, um wiederholte US-Militäraktionen zu verhindern.
Der Verzicht auf das Recht zur unabhängigen Urananreicherung würde von Iran nicht nur als Nachgeben gegenüber dem Druck der USA und Israels gewertet, sondern auch als Akzeptanz eines untergeordneten Status in der internationalen Ordnung – etwas, das die Führung Teherans sowohl vor als auch nach dem Ausstieg der USA aus dem JCPOA stets zu vermeiden suchte. Die Unterzeichnung eines solchen Abkommens, insbesondere nach den jüngsten Anschlägen, käme einer schweren innenpolitischen Niederlage gleich.
Auch die US-Regierung unter Trump scheint keinerlei Absicht zu haben, Zugeständnisse zu machen oder die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Trump ist der Ansicht, dass die Militäraktion das iranische Atomprogramm erheblich geschwächt habe und Teheran daher Zugeständnisse machen müsse. Offensichtlich setzt Präsident Trump in seiner aktuellen Politik auf Druck und Zwang statt auf Diplomatie. Washington sucht nicht mehr aktiv nach Verhandlungen und ist noch weniger bereit, nennenswerte Zugeständnisse zu machen – was die Aussicht auf eine diplomatische Lösung weiter in die Ferne rückt.
Hung Anh (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/van-de-hat-nhan-iran-khi-suc-manh-khong-khuat-phuc-duoc-y-chi-254704.htm






![[Foto] Lam Dong: Bilder der Schäden nach einem mutmaßlichen Seeausbruch in Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)































![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet die zweite Sitzung des Lenkungsausschusses für private Wirtschaftsentwicklung.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)

























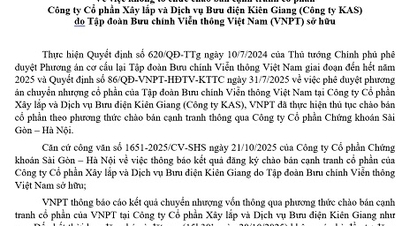







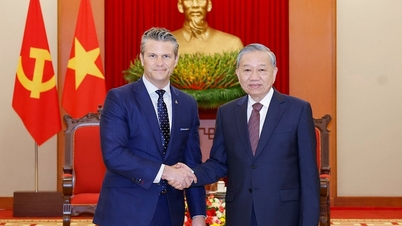

















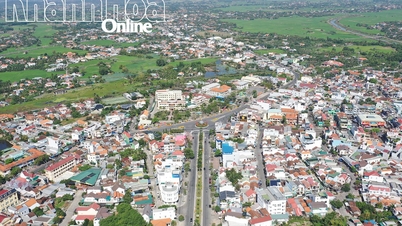





















Kommentar (0)