Auf den ersten Blick erscheint dieses Argument plausibel. Im Alltag basieren Kaufentscheidungen größtenteils auf freier Wahl. Konsumenten kaufen, was ihnen gefällt, und lassen es bleiben, wenn nicht. Energie, insbesondere Erdöl, ist jedoch nicht einfach ein privates Gut. Sie ist die Lebensader der Wirtschaft und eng mit Energiesicherheit und internationalen Klimaverpflichtungen verknüpft. An diesem Punkt erfordern Vergleiche mit Industrieländern eine umfassendere Betrachtung.
Tatsächlich haben viele Industrieländer verpflichtende Mechanismen für Biokraftstoffe eingeführt. Die Europäische Union hat 2009 die Richtlinie über erneuerbare Energien (RED) erlassen, die den Mindestanteil von Biomasse in Benzin regelt. Die Vereinigten Staaten verpflichten seit 2005 mit dem RFS-Programm alle Hersteller und Händler, einen bestimmten Ethanolanteil – üblicherweise E10, in vielen Bundesstaaten sogar E15 – zu gewährleisten. In Brasilien schwankt der Ethanolanteil je nach Zeitraum zwischen 18 % und 27 %, sodass der Markt die Entscheidung trifft. Anfang August 2025 erhöhte Brasilien den obligatorischen Ethanolanteil in Benzin auf 30 % (E30), um die Benzinversorgung zu sichern und Importe zu reduzieren.
Man kann sagen, dass die Entstehung und Entwicklung der globalen Ethanolmärkte diesem „Zwang“ zu verdanken ist. Setzt man allein auf die freiwillige Teilnahme der Verbraucher, wird die Biokraftstoffindustrie kaum überleben können, denn die Gewohnheit, traditionelle Kraftstoffe zu verwenden, ist seit Generationen tief verwurzelt.
Die Annahme, dass „Staaten nicht zwingen“, ist daher ein Irrtum oder zumindest eine einseitige Betrachtung. Ihr Unterschied besteht darin, dass sie politische Maßnahmen systematisch, transparent und in Partnerschaft mit Unternehmen und Verbrauchern umsetzen.
(Abbildung: Internet)
Viele Gegner von E10 verweisen oft auf das Scheitern von E5. Es stimmt, dass die Bevölkerung kein Interesse daran hatte, einige Unternehmen Verluste erlitten und viele Tankstellen schließen mussten. Die Ursache für das Scheitern liegt jedoch nicht in der „Aufzwingung“, sondern in der mangelnden einheitlichen und konsequenten Umsetzung.
Der Verkaufspreis von E5 bietet im Vergleich zu herkömmlichem Benzin keinen ausreichend attraktiven Preisvorteil. Die Kommunikation verdeutlicht weder die Umweltvorteile noch die gesundheitlichen Vorteile oder die Motorverträglichkeit. Das Lager- und Vertriebssystem entspricht nicht den Standards, was zu Trennungen und Qualitätseinbußen führt. All dies untergräbt das Vertrauen der Verbraucher.
Das Scheitern von E5 lag also nicht am „Pflichtfaktor“, sondern daran, dass zum damaligen Zeitpunkt nicht genügend Voraussetzungen für die Wirksamkeit der verpflichtenden Maßnahme gegeben waren. Dies ist die Erkenntnis, die beim Übergang zu E10 gewonnen werden muss.
Warum ist ein Fahrplan erforderlich?
Erstens hat sich Vietnam verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein. Dies ist nicht nur ein Versprechen an die internationale Gemeinschaft, sondern auch eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Wenn wir es bei freiwilligen Anreizen belassen, wird der Übergang sehr langsam verlaufen, wodurch es schwierig wird, den strengen Zeitrahmen einzuhalten.
Zweitens schafft der verpflichtende Mechanismus einen ausreichend großen Markt für den stabilen Betrieb von Ethanol-Anlagen. Auch der Agrarsektor profitiert von einer nachhaltigeren Produktion von Maniok und Mais, wodurch Arbeitsplätze für Landwirte geschaffen werden.
Drittens sind Kraftstoffverbrauchsgewohnheiten von Natur aus konservativ und ohne politische Anreize schwer zu ändern. Wenn E10 zum neuen Standard wird, werden sich die Menschen allmählich daran gewöhnen, genau wie wir von A83 auf A92 und dann auf A95 umgestiegen sind.
Das bedeutet nicht, dass es „unbedingt vorgeschrieben“ ist. Viele Länder bieten weiterhin Premium-Kraftstoff für Sportwagen oder Spezialfahrzeuge an. Vietnam kann sich an diesem Modell orientieren: E10 als gängiger Basiskraftstoff und ein kleiner Anteil an Premium-Kraftstoff für spezielle Kundengruppen und Fahrzeuge.
Wichtiger noch: Die Politik muss von sanften Maßnahmen begleitet werden: Angemessene Subventionen, damit E10 deutlich günstiger ist als A95; Strenge Qualitätskontrollen, um ein erneutes Auftreten von Trennungen zu vermeiden und E10 nicht zu einem „Albtraum“ für die Verbraucher zu machen; Wissenschaftliche Kommunikation, Veröffentlichung einer Liste geeigneter Fahrzeuge und klare Erläuterung der Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Energiesicherheit; Eine angemessene Übergangsfrist, die parallel für mindestens einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten wird, damit die Bevölkerung die Umstellung überprüfen kann.
Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird der „zwanghafte“ Faktor zu einer treibenden Kraft für die Entwicklung, anstatt sich in Marktwiderstand zu verwandeln.
Thailand verdeutlicht eindrucksvoll die Bedeutung von verpflichtenden und fördernden Maßnahmen. Das Land führte 2007 den Biokraftstoff E10 ein und schaffte bereits wenige Jahre später herkömmliches Benzin (RON 91) vollständig ab, wodurch die Bevölkerung gezwungen war, auf E10 umzusteigen. Dank der Subventionspolitik ist E10 20–40 % günstiger als herkömmliches Benzin, was zu einem rasanten Anstieg des Verbrauchs führte. Heute werden in Thailand über 90 % der Kraftstoffe im Verkehrssektor mit E10, E20 oder E85 betrieben, wobei E10 den größten Anteil ausmacht.
Viele erinnern sich noch daran, dass vor 2007 das Tragen von Helmen zwar jahrelang propagiert wurde, aber kaum Beachtung fand. Helme galten als „unbequem, heiß und teuer“ und wurden als willkürliche Entscheidung betrachtet. Erst als die Regierung am 15. Dezember 2007 eine Helmpflicht mit strengen Sanktionen einführte, stieg die Helmtragequote innerhalb weniger Monate von unter 30 % auf über 90 %.
Diese Maßnahme veränderte nicht nur das Verhalten, sondern rettete auch Zehntausende Leben. Laut Weltgesundheitsorganisation trugen Helmpflichtvorschriften in Vietnam in den ersten Jahren ihrer Einführung dazu bei, Kopfverletzungen und Todesfälle durch Verkehrsunfälle um mehr als 20 % zu reduzieren.
Allerdings gibt es Veränderungen im öffentlichen Interesse, die nicht freiwillig eintreten können, sondern einen politischen Anstoß erfordern. Und sobald sie zur Norm geworden sind, stellt kaum noch jemand ihre Notwendigkeit in Frage.
Biokraftstoffe sind keine persönliche Entscheidung, sondern eine strategische, die mit der Zukunft der Umwelt und der nationalen Energiesicherheit verknüpft ist. Anfangs wird es sicherlich viele Bedenken geben, ähnlich wie bei der Helmpflicht vor fast zwei Jahrzehnten. Doch wenn die Richtlinien klar sind und konsequent durchgesetzt werden, werden die Menschen sie nach und nach als selbstverständlich, ja sogar als Teil ihrer Sicherheitskultur betrachten.
Wie ein brasilianisches Sprichwort aus einem Land, das in Sachen Ethanol führend ist, besagt: „Niemand nimmt gern Medikamente, aber jeder braucht sie, um gesund zu werden.“ Dasselbe gilt für Biokraftstoffe. Manchmal ist „Zwang“ keine Last, sondern ein Mittel, um uns selbst zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft zu bewegen.
Thien Tuong
Quelle: https://bsr.com.vn/web/bsr/-/xang-bi-hoc-bat-buoc-hay-tu-nguyen







![[Foto] Eröffnung der 14. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762310995216_a5-bnd-5742-5255-jpg.webp)







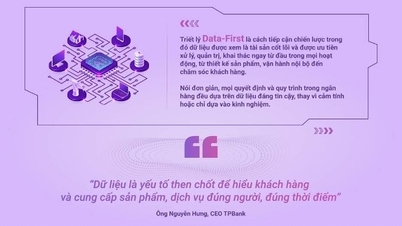













![[Foto] Panorama des Patriotischen Wettbewerbskongresses der Zeitung Nhan Dan für den Zeitraum 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

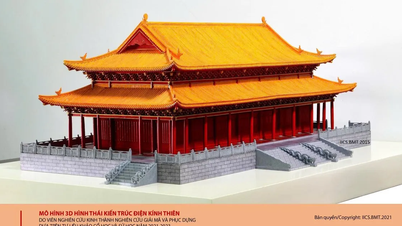































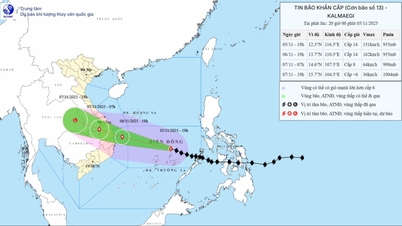










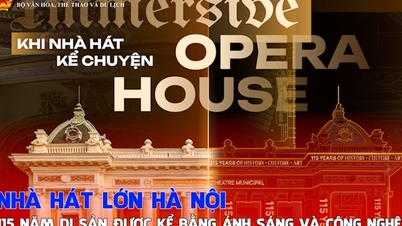























Kommentar (0)