Deutschland – jahrzehntelang der Motor des europäischen Wirtschaftswachstums und der Region dabei geholfen, vielen Krisen zu entgehen – ist gerade in eine Rezession gefallen.
Jahrzehntelange fehlgeleitete Energiepolitik, der Rückgang fossil betriebener Autos und ein schleppender Technologiewandel stellen die größte Bedrohung für Deutschland seit der Wiedervereinigung dar. Doch anders als 1990 fehlt Deutschland heute ein politischer Führer, der diese strukturellen Probleme angehen könnte.
„Wir waren zu selbstgefällig, weil alles gut aussah“, sagte Martin Brudermüller, CEO des Chemieriesen BASF, gegenüber Bloomberg. „Die Probleme in Deutschland häufen sich. Uns steht eine Zeit des Wandels bevor. Ich weiß nicht, ob die Leute das erkennen“, fügte er hinzu.
Berlin hat zwar bewiesen, dass es vergangene Krisen überstehen kann, doch stellt sich nun die Frage, ob es eine nachhaltige Strategie verfolgen kann. Diese Aussicht scheint unwahrscheinlich. Kaum ist die Gefahr von Energieengpässen gebannt, sieht sich die Koalitionsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz wieder mit einer Reihe von Problemen konfrontiert – von der Staatsverschuldung über die Ausgaben für Wärmepumpen bis hin zu Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen.
Doch die Warnsignale sind zu deutlich, um sie zu ignorieren. Im Januar erklärte Scholz gegenüber Bloomberg , Deutschland werde die Energieknappheit dieses Jahres überstehen, ohne in eine Rezession zu fallen. Doch die am 25. Mai veröffentlichten Daten zeigten, dass Europas größte Volkswirtschaft zwei Quartale in Folge schrumpfte und damit in eine Rezession stürzte.
Ökonomen prognostizieren, dass das deutsche Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren hinter dem der übrigen Region zurückbleiben wird. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass Deutschland in diesem Jahr die schwächste Volkswirtschaft der G7 sein wird.
Scholz bleibt optimistisch. „Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind sehr gut“, sagte er nach der Veröffentlichung der gestrigen Zahlen vor Journalisten in Berlin. „Indem wir den Marktteilnehmern mehr Freiheiten geben und die Bürokratie abbauen, werden wir die vor uns liegenden Herausforderungen meistern können“, sagte er.

Menschen auf einer Einkaufsstraße in Köln. Foto: Reuters
Beunruhigend ist allerdings, dass die jüngsten Zahlen nicht nur ein Ausrutscher sind. Sie sind ein Vorzeichen für die Zukunft.
Deutschland hat noch keine nachhaltige Lösung für den Energiebedarf seines riesigen Industriesektors gefunden. Zudem ist das Land zu sehr auf veraltete Produktionstechnologien angewiesen und es fehltihm an politischem Willen und wirtschaftlicher Flexibilität, um in schnell wachsende Sektoren vorzudringen. Diese strukturellen Herausforderungen sollten Europas größter Volkswirtschaft ein Weckruf sein.
Industriegiganten wie Volkswagen, Siemens und Bayer sehen sich von Tausenden kleinerer Unternehmen bedroht. Obwohl Deutschland dank seines konservativen Ausgabenverhaltens finanziell besser aufgestellt ist als andere Länder, um den wirtschaftlichen Wandel zu meistern, bleibt dem Land keine Zeit mehr.
Das dringlichste Problem ist, die Energiewende auf Kurs zu bringen. Günstige Energie ist eine wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Vor dem Wegfall der russischen Gaslieferungen hatte Deutschland mit die höchsten Strompreise Europas. Wenn sich diese Situation nicht stabilisiert, werden die Hersteller abwandern.
Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, plant Berlin, die Strompreise für einige energieintensive Industrien, wie etwa die Chemieindustrie, zu deckeln. Dies ist jedoch nur eine vorübergehende Lösung und verdeutlicht Deutschlands Versorgungsschwierigkeiten.
Deutschland hat Anfang des Jahres seinen letzten Atomreaktor abgeschaltet und treibt seine Pläne zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 voran. Im vergangenen Jahr wurden 10 Gigawatt Wind- und Solarenergiekapazität hinzugefügt, doch das ist immer noch halb so viel, wie nötig wäre, um die Klimaziele zu erreichen.
Die deutsche Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 625 Millionen Solarmodule und 19.000 Windkraftanlagen zu installieren. Doch die Versprechen, diesen Prozess zu beschleunigen, sind bislang ausgeblieben. Gleichzeitig wird ein rasanter Anstieg der Nachfrage prognostiziert, da die Elektrifizierung aller Bereiche – von der Heizung über den Verkehr bis hin zur Stahlproduktion – voranschreitet.
„Wir müssen darüber nachdenken, welche Branchen mit steigenden Brennstoffpreisen zurechtkommen und welche nicht, und uns auf die Zukunft konzentrieren“, sagte Siemens-Chef Roland Busch in einem Interview mit Bloomberg.
Deutschland verfügt aufgrund seiner kurzen Küstenlinie und der geringen Sonneneinstrahlung nicht über die nötigen Ressourcen, um ausreichend saubere Energie zu erzeugen. Um diesem Problem zu begegnen, hat das Land versucht, eine Infrastruktur für den Import von Wasserstoff aus Ländern wie Australien, Kanada und Saudi-Arabien aufzubauen. Dabei setzt es auf eine Technologie, die noch nie in einem so großen Maßstab getestet wurde.
Deutschland muss außerdem den Bau von Hochspannungsnetzen beschleunigen, die die Kraftwerke entlang der Nordküste mit Fabriken und Städten im Süden verbinden. Zudem mangelt es an Speicherkapazitäten, um die Widerstandsfähigkeit gegen Stromausfälle zu gewährleisten.
„Deutschland braucht die Einigkeit seiner Parteien, um den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien zu beschleunigen. Nach der Wahl 2025 könnten Konflikte zwischen den Parteien die Energiewende jedoch wieder bremsen. Das ist nicht gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagte Claudia Kemfert, Professorin für Energieökonomie am DIW.
Europas Wirtschaftsmacht investiert offenbar massiv und systematisch in Innovationen, um seinen Vorsprung zu behaupten. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen weltweit auf Platz vier, nach den USA, China und Japan. Rund ein Drittel der in Europa angemeldeten Patente stammen laut Daten des Weltpatentamts aus Deutschland.
Der Großteil dieser Aktivitäten findet jedoch bei großen Unternehmen wie Siemens oder Volkswagen oder in etablierten Branchen statt. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sinkt die Zahl der Startups in Deutschland entgegen dem Trend in Industrieländern.
Dafür gibt es viele Gründe, darunter einen hohen bürokratischen Aufwand. Unternehmen, die sich registrieren lassen möchten, müssen oft Papieranträge einreichen. Deutschland ist zudem von einer risikoscheuen Unternehmenskultur geprägt. Auch die Finanzierung ist ein Problem. Laut dem Datenunternehmen DealRoom beliefen sich die Risikokapitalinvestitionen in Deutschland im vergangenen Jahr auf lediglich 11,7 Milliarden Dollar – ein Bruchteil der 234,5 Milliarden Dollar in den USA.
Gleichzeitig schwindet Deutschlands technologischer Vorsprung, insbesondere in der Automobilindustrie. Während Marken wie Porsche und BMW bei Verbrennungsmotoren weiterhin führend sind, kämpft die deutsche Elektrofahrzeugbranche mit Problemen.
BYD überholte VW im letzten Quartal und wurde zur meistverkauften Automarke Chinas. Der Schlüssel zu BYD ist ein Elektroauto, das nur ein Drittel des VW-Preises kostet, aber eine größere Reichweite bietet und sich mit Apps von Drittanbietern verbinden lässt.
Ein Großteil des deutschen Wohlstands stammt aus dem verarbeitenden Gewerbe, das viele gut bezahlte Bürojobs bietet. Diese Stärke hat jedoch zu einer gefährlichen Abhängigkeit von ausländischen Märkten für Aufträge und Rohstoffe geführt, insbesondere von China. Nach dem Russland-Ukraine-Konflikt versucht Berlin wie viele andere Länder, seine Abhängigkeit von China zu verringern. Doch die größten deutschen Unternehmen haben bisher kein Interesse gezeigt.
Es gibt zwei Hauptbereiche, in denen Deutschland hinter den Erwartungen zurückbleibt und die es für sein Wirtschaftswachstum nutzen könnte: Finanzen und Technologie.
Der Großteil des deutschen Geldes wird in einem System von 360 kleinen, lokal geführten Sparkassen gehalten. Dies erhöht das Potenzial für Interessenkonflikte und schwächt die Finanzkraft des Landes.
Die beiden größten börsennotierten Banken Deutschlands, die Deutsche Bank und die Commerzbank, stecken seit Jahren in Schwierigkeiten. Obwohl sie sich im Wandel befinden, bleiben sie im Vergleich zu den Wall-Street-Banken klein: Ihre gemeinsame Marktkapitalisierung beträgt weniger als ein Zehntel der von JPMorgan Chase.
Im Technologiebereich ist SAP der größte Player in Deutschland. Das 1970 gegründete Unternehmen entwickelt komplexe Software, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Geschäftsprozesse unterstützt. Es ist schwer, in diesem Bereich einen Ersatz zu finden. Das elektronische Zahlungsunternehmen Wirecard kam dieser Position nahe, bevor es in einem Bilanzbetrugsskandal zusammenbrach.
Deutschland investiert zudem zu wenig in digitale Technologien. Obwohl es die 51.-schnellste Festnetz-Internetgeschwindigkeit der Welt hat, gehören seine Investitionen in die Internet-Infrastruktur zu den niedrigsten in der OECD. „Jahrelange Unterinvestitionen haben Deutschland zurückgeworfen“, sagt Jamie Rush, Chefvolkswirt für Europa bei Bloomberg Economics. Berlin müsse mehr investieren und die Umsetzung von Infrastrukturprojekten erleichtern, fordert er.
Deutschland muss seine Probleme mit einer langfristigen Strategie angehen. Doch das ist schwierig. Scholz wurde mit den niedrigsten Zustimmungswerten seit Jahrzehnten gewählt. Auch seine derzeitige Koalitionsregierung ist gespalten. Die deutsche Politik droht im Chaos zu versinken.
Diese Kluft ist umso besorgniserregender, da die Bevölkerung altert und junge Menschen sich Sorgen um die Zukunft machen. Die deutsche Industrie spürt die Auswirkungen dieses demografischen Wandels am stärksten. Jüngste Umfragen zeigen, dass 50 Prozent der Unternehmen aufgrund von Arbeitskräftemangel ihre Produktion drosseln mussten, was die Wirtschaft jährlich 85 Milliarden Dollar kostet.
In einem aktuellen Bericht der OECD zur deutschen Wirtschaft heißt es: „Kein großes Industrieland ist in seiner Wettbewerbsfähigkeit so sehr durch systemische Probleme wie Deutschland gefährdet, die von sozialen und ökologischen bis hin zu regulatorischen Zwängen reichen.“
Die Probleme in Deutschland würden sich auf die gesamte Region ausbreiten, sagte Dana Allin, Professor am SAIS Europe. „Die Gesundheit der deutschen Wirtschaft ist wichtig für die europäische Wirtschaft insgesamt sowie für die Harmonie und Einheit des Blocks“, sagte er.
Ha Thu (laut Bloomberg)
[Anzeige_2]
Quellenlink







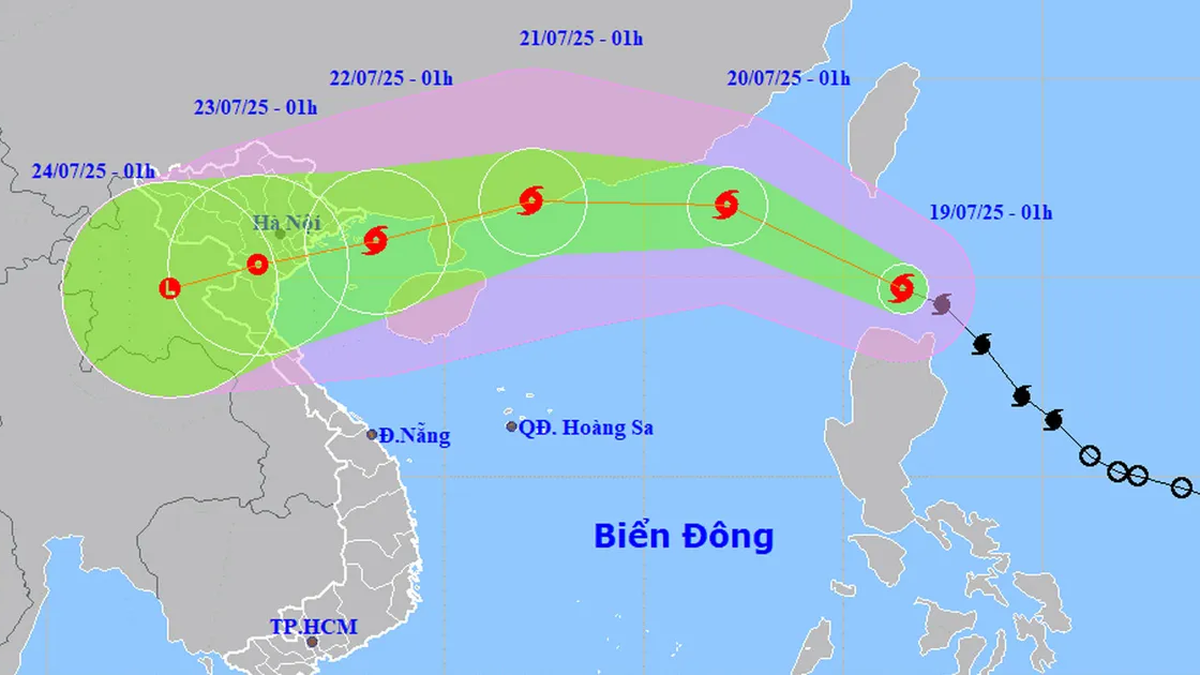


























































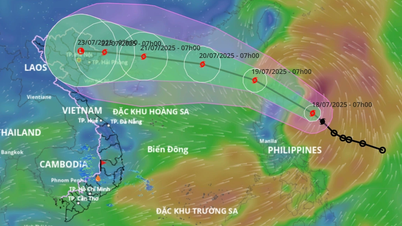



























![[Infografik] Im Jahr 2025 werden 47 Produkte das nationale OCOP erreichen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





Kommentar (0)