Chinas Verbraucherpreisindex (VPI) fiel im Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent, nachdem er im November bereits um 0,5 Prozent gefallen war, wie das Nationale Statistikamt am 12. Januar mitteilte. Der jährliche VPI blieb unterdessen mit 0,2 Prozent positiv und erreichte damit seinen niedrigsten Stand seit 13 Jahren. Dies verdeutlicht die Probleme Pekings, die denen des „verlorenen Jahrzehnts“ Tokios ähneln – das von Deflation, einem Einbruch des Immobilienmarkts und einer demografischen Krise begleitet war.
Der Erzeugerpreisindex (PPI), ein Maß für die Kosten von Waren in Fabriken, fiel im Dezember den 15. Monat in Folge und lag 2,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.
 |
| Chinas Verbraucherpreisindex fiel im Dezember den dritten Monat in Folge und löste damit Deflationssorgen aus. (Quelle: EPA-EFE) |
Deflationsängste
Die chinesischen Politiker betrachteten die Inflation lange Zeit als ständige Bedrohung und strebten in den vergangenen zehn Jahren ein jährliches Verbraucherpreiswachstum von drei Prozent an. Viele Ökonomen fordern jedoch einen Wandel, da Deflation für die Wirtschaft noch gefährlicher sei, insbesondere in Zeiten geringen Vertrauens und schwacher Nachfrage.
„Die politischen Entscheidungsträger sollten sich darüber im Klaren sein, dass Deflation Schaden anrichten wird. China sollte dieser Situation mehr Aufmerksamkeit schenken“, sagte Wang Tao, Chefvolkswirt für China bei UBS, am 8. Januar auf einem Forum in Shanghai.
Die Schweizer Bank prognostiziert, dass Chinas Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahr 2024 um 0,8 Prozent steigen wird. Li Xunlei, Chefvolkswirt bei Zhongtai Securities, sagte, China solle die Festlegung einer Untergrenze von mindestens einem Prozent für die Verbraucherinflation in Erwägung ziehen, um die Markterwartungen anzuheben.
Es wird erwartet, dass Peking im Arbeitsbericht des Ministerpräsidenten an den Nationalen Volkskongress Anfang März dieses Jahres Inflations- und Bruttoinlandsproduktziele sowie Haushaltsdefizitquoten und lokale Anleihequoten bekannt gibt.
In China herrsche die gleiche große Kluft zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen wie vor Jahrzehnten in Japan, sagte Alicia Garcia-Herrero, Chefvolkswirtin für den Asien- Pazifik-Raum bei Natixis. Sie warnte, die Deflation könne sich negativ auf die Löhne und den privaten Sektor auswirken.
„Ohne Produktivität müssen die Löhne sinken, denn es gibt keinen Grund, den Arbeitnehmern mehr zu zahlen, wenn die Produktivität sinkt. Chinas negatives Lohnwachstum im letzten Quartal 2023 ist ein Zeichen dafür, dass sich der deflationäre Druck verfestigen könnte“, sagte er.
Das Durchschnittsgehalt für neue Mitarbeiter in 38 Großstädten sank im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 10.420 Yuan (1.458 US-Dollar), wie aus Daten des Online-Jobportals Zhilian Zhaopin hervorgeht.
Historisch gesehen hat China in den vergangenen 25 Jahren drei Perioden sinkender Verbraucherpreise erlebt, zwei davon fielen mit Finanzkrisen zusammen.
Der erste, ein 22 Monate dauernder Einbruch, der Anfang 1998 begann, war größtenteils das Ergebnis der geldpolitischen Straffung Pekings zur Eindämmung uneinbringlicher Kredite sowie der sinkenden Auslandsnachfrage infolge der asiatischen Finanzkrise.
Im Jahr 2002, ein Jahr nach dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation, kam es zu einer kurzen Phase der Deflation, da der Zustrom ausländischer Unternehmen die Produktivität steigerte und die Kosten senkte.
Die Gefahr einer Deflation kehrte 2009 zurück, als die globale Finanzkrise die chinesischen Exporteure traf.
Maßnahmen der Regierung
Als Reaktion auf die jüngsten Bedenken hat Peking seit letztem Sommer eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt.
Doch die Erholung bleibt fragil, da der chinesische Immobilienmarkt Probleme hat, der private Sektor weiterhin schwach ist, der Druck zur Schaffung neuer Arbeitsplätze hoch ist und die Preisinflation niedrig bleibt.
Die Bemühungen der Regierung, die niedrige Inflation und die schleppende Konjunktur zu bekämpfen, haben die Markterwartungen auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik geweckt.
Höhere Staatsausgaben und eine lockerere Geldpolitik gelten als wirksame Maßnahmen zur Ankurbelung der Binnennachfrage, da die Exportaussichten mit Unsicherheiten behaftet sind. Gleichzeitig wird der Abbau von Überkapazitäten den Preisdruck verringern.
Peking ist sich dieses Risikos durchaus bewusst. Auf der Zentralen Wirtschaftskonferenz im Dezember 2023 räumte es erstmals deflationären Druck ein und erklärte, dass „die gesamte gesellschaftliche Finanzierung und Geldmenge mit dem Wirtschaftswachstum und den Preiszielen im Einklang stehen muss“.
Larry Hu, Chefvolkswirt für China bei Macquarie, sagte, die Geldpolitik könne künftig lockerer ausfallen.
„Dass die Konferenz eine Deflation anerkennt, bedeutet, dass es in den kommenden Monaten zu weiteren Senkungen der Leitzinsen und Mindestreserveanforderungen kommen wird“, prognostizierte er.
(laut SCMP)
[Anzeige_2]
Quelle







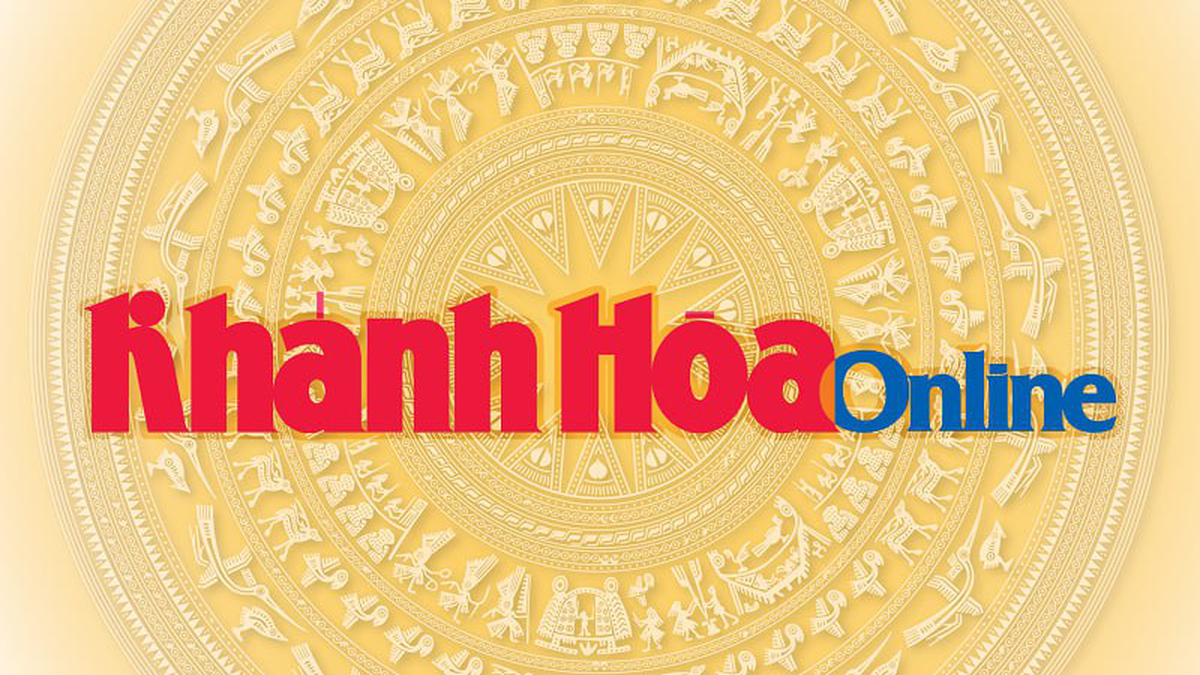























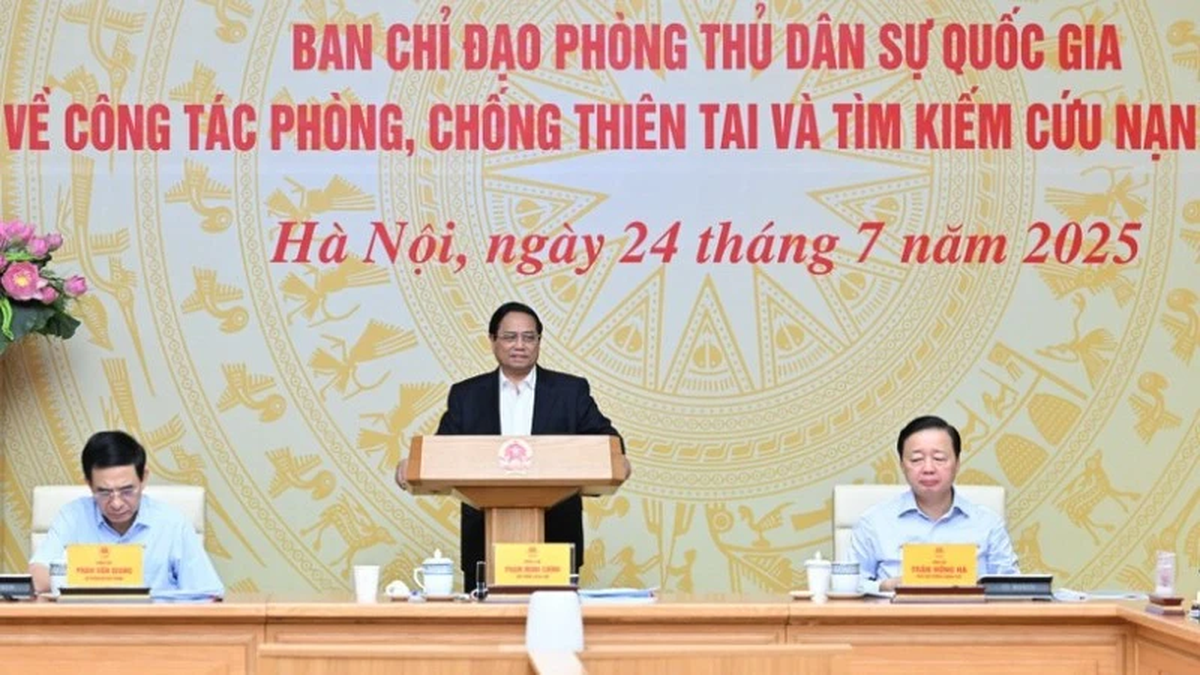



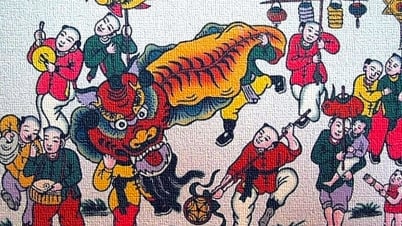























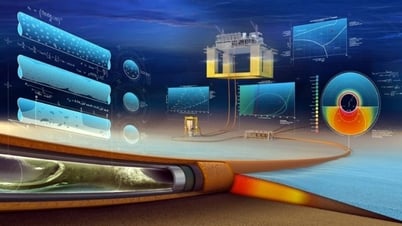







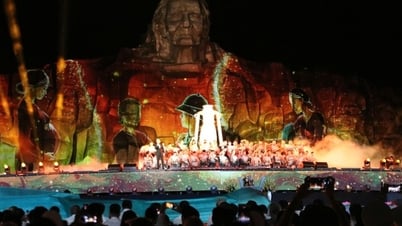























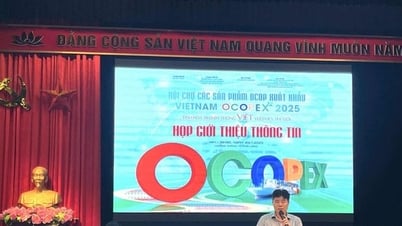






Kommentar (0)