Ganz oben auf dieser Liste steht die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl im November.
Von den US-Präsidentschaftswahlen…
In dem Bericht hieß es: „Im Jahr 2024 steht den Vereinigten Staaten eine weitere Schwächung bevor. Die US-Präsidentschaftswahlen werden die politischen Spaltungen des Landes verschärfen und die amerikanische Demokratie in einem Ausmaß herausfordern, wie sie es seit 150 Jahren nicht mehr erlebt hat.“
Dies rührt daher, dass das amerikanische politische System „erheblich gespalten“ ist und dass darüber hinaus „das Vertrauen der Öffentlichkeit in zentrale Institutionen wie den Kongress , die Justiz und die Medien auf einem historisch niedrigen Niveau liegt“ und „Polarisierung und Parteilichkeit ein historisch hohes Niveau erreicht haben“, so die Eurasia Group. Diese Spaltung wird sich im Vorfeld der anstehenden Wahlen noch verschärfen.

Dieses Foto, das am 21. Januar veröffentlicht wurde, zeigt israelische Streitkräfte im Gazastreifen.
Die internen politischen Spaltungen in den USA haben die Politik gegenüber Verbündeten und Partnern maßgeblich beeinflusst. Dies zeigt sich exemplarisch an der US-Politik gegenüber der Ukraine und Israel, da der Konflikt in der Ukraine nun schon im dritten Jahr andauert und ein Ende nicht absehbar ist und sich die Spannungen im Nahen Osten wohl kaum bald entspannen werden.
...bis hin zu den "Funken" der Spannung
Der Bericht stellte fest: „Kiew hat durch die politische Unterstützung und die Hilfen der USA für die Ukraine einen schweren Schlag erlitten. Die Amerikaner sind in diesem Konflikt zunehmend gespalten, und viele republikanische Abgeordnete lehnen weitere Hilfen aktiv ab. Selbst wenn der Kongress zusätzliche Militärhilfe für 2024 beschließt, dürfte dies die letzte bedeutende Zuweisung an Kiew aus Washington sein. Sollte Donald Trump gewinnen, wird er die Hilfen drastisch kürzen. Gewinnt Präsident Joe Biden, wird es weiterhin schwierig bleiben, Hilfen zu erhalten, es sei denn, die Demokraten kontrollieren sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat.“
„Die US-Unterstützung für die Ukraine stößt im US-Kongress auf zunehmenden Widerstand, was das transatlantische Bündnis belastet.“ Sollte Biden die Wahl verlieren, könnte Kiew rücksichtslose Maßnahmen ergreifen, um vor dem Amtsantritt des nächsten US-Präsidenten noch so viel wie möglich zu erreichen – was zu Einschränkungen der Hilfsleistungen führen könnte. Umgekehrt könnte die Erwartung, dass die US-Hilfe für die Ukraine bis 2025 ausläuft, Russland zu einem Konflikt anstacheln“, heißt es in dem Bericht der Eurasia Group weiter.
Im Nahen Osten könnten die prominente Unterstützung Israels durch Ex-Präsident Donald Trump und seine Bereitschaft zu einem Angriff auf den Iran die regionalen Spannungen weiter verschärfen. Laut Einschätzung der Eurasia Group herrscht im Nahen Osten kein Frieden mehr, und dieser ist unwahrscheinlich von Dauer. „Es existiert ein Netzwerk von Abschreckungsbeziehungen – auf der einen Seite Israel und die USA, auf der anderen Seite der Iran und seine Stellvertretertruppen sowie die Golfstaaten, die als ‚dritte Partei‘ den Konflikt im Gazastreifen bisher einigermaßen eingedämmt haben. Kein Land wünscht sich einen regionalen Krieg“, analysiert der Bericht und argumentiert, dass die Beteiligung so vieler Parteien inhärente Risiken birgt. Daher könnten die aktuellen Kämpfe im Gazastreifen nur die erste Phase eines umfassenderen Konflikts sein, der für 2024 erwartet wird. Als Eskalationsrisiko wird im Bericht die Möglichkeit eines israelischen Angriffs auf die Hisbollah im Libanon hervorgehoben, der eine Reaktion mehrerer pro-iranischer Parteien auslösen könnte.
Die wirtschaftlichen Aussichten sind nicht rosig.
Laut einer Einschätzung der Eurasia Group steht die Welt im Jahr 2024 neben politischer und sicherheitspolitischer Instabilität vor vielen weiteren Herausforderungen.
Zu den größten wirtschaftlichen Risiken zählt die ausbleibende, starke Erholung der chinesischen Wirtschaft. Als entscheidender Wachstumsmotor hätte eine schwache Erholung der chinesischen Wirtschaft erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Laut dem Bericht steht der Erholungsprozess der chinesischen Wirtschaft jedoch vor vier großen Herausforderungen.
Erstens schwächt sich der Wachstumstrend nach dem Ende der chinesischen „Null-Covid-Politik“ ab. Die Impulse der Wiedereröffnung im Jahr 2023 werden mit dem nachlassenden Wachstum und der steigenden Arbeitslosigkeit verschwinden. Zweitens bleibt der Immobilienmarkt, eine tragende Säule der chinesischen Wirtschaft, sehr schwach und zeigt keine Anzeichen einer deutlichen Erholung. Drittens schwächeln Chinas wichtige Exportmärkte, insbesondere die USA und Europa, weiterhin, was zu einer sinkenden Nachfrage und erheblichen Auswirkungen auf die chinesischen Exporte führt. Viertens hat China bisher keine ausreichend überzeugenden Konjunkturmaßnahmen umgesetzt, um Investoren anzulocken.
Nicht nur China, sondern die gesamte Weltwirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen. Ein Bericht der Eurasia Group kommt zu dem Schluss: „Der globale Inflationsschock, der 2021 begann, wird auch 2024 weiterhin erhebliche wirtschaftliche und politische Belastungen verursachen. Hohe Zinsen aufgrund der Inflation werden das weltweite Wachstum bremsen.“ Viele Länder haben jedoch alle Hebel in Bewegung gesetzt und einige Maßnahmen sogar überstrapaziert, was potenzielle Risiken im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich birgt.
Darüber hinaus werden Handelsspannungen Länder dazu veranlassen, protektionistische Maßnahmen zu ergreifen, die den Fluss kritischer Mineralien unterbrechen, die Preisvolatilität erhöhen und globale Lieferketten umgestalten. Zu diesen Mineralien gehören unter anderem essentielle Rohstoffe für die Halbleiterindustrie und die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge.
Darüber hinaus hebt die Eurasia Group als ein Risiko den Höhepunkt des Klimaphänomens El Niño in der ersten Hälfte des Jahres 2024 hervor, der zu extremen Wetterbedingungen führen wird, die wiederum Nahrungsmittelknappheit, zunehmenden Wasserstress, logistische Störungen, Krankheitsausbrüche, Brennstoffmigration und politische Instabilität zur Folge haben.
All diese Risiken bedeuten, dass die Welt im Jahr 2024 mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert sein wird.
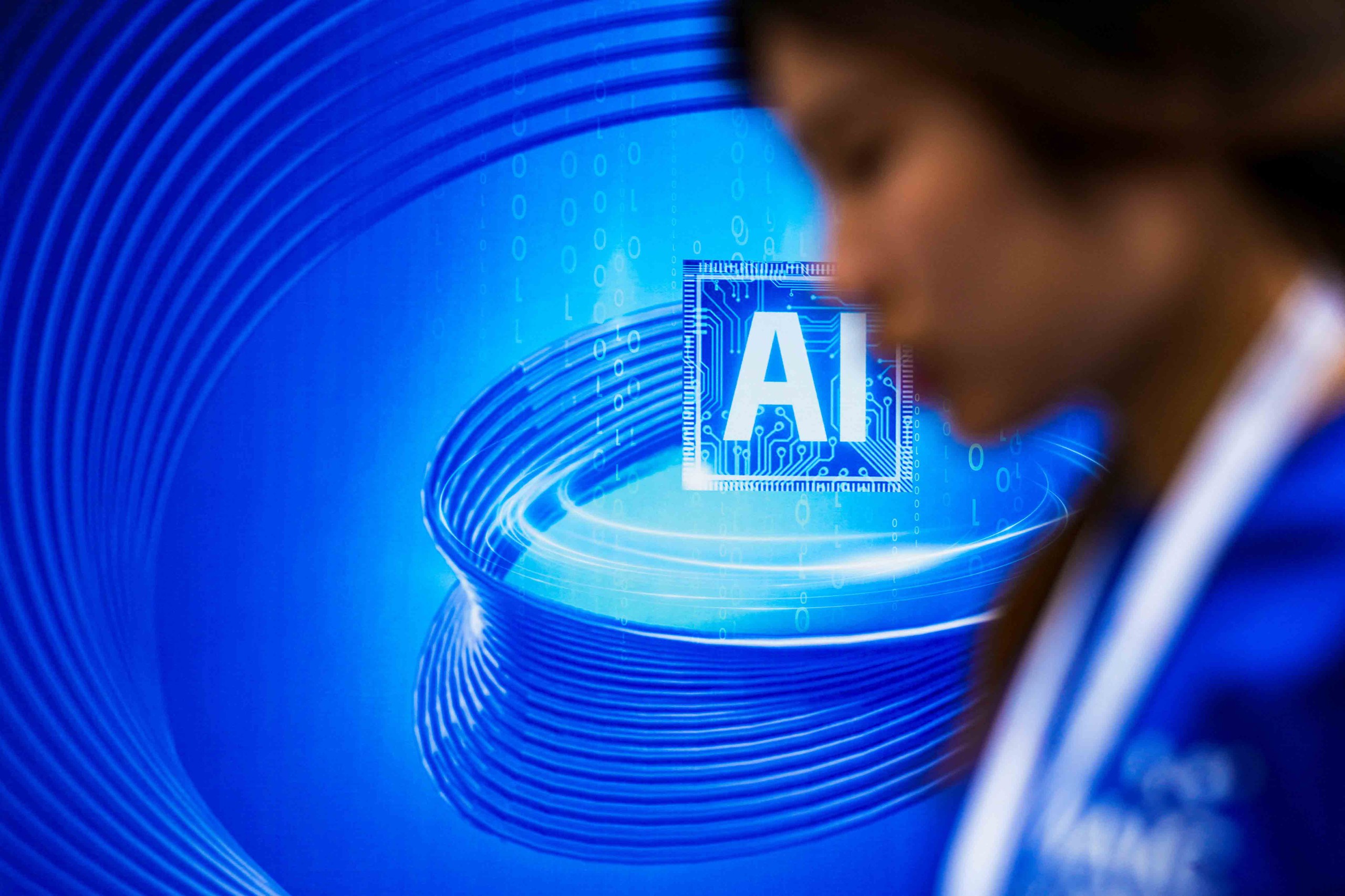
Die KI wird sich auch 2024 weiterhin stark entwickeln.
Bedenken hinsichtlich künstlicher Intelligenz (KI)
Dem Bericht zufolge werden Lücken in der KI-Governance bis 2024 deutlich werden, da KI-Modelle und -Werkzeuge dann weitaus leistungsfähiger sein werden und sich der Kontrolle der Regierungen entziehen.
Im vergangenen Jahr erlebte die Welt eine ambitionierte KI-Welle, die Regierungen dazu veranlasste, Strategien und Vorschläge für die gemeinsame Entwicklung neuer KI-Standards zu verkünden. Viele der weltweit führenden Unternehmen verpflichteten sich zu freiwilligen Standards für die KI-Entwicklung. Die USA, China und die meisten G20-Mitglieder unterzeichneten die Bletchley-Erklärung zur KI-Sicherheit. Das Weiße Haus erließ eine Exekutivverordnung zur KI. Auch die EU einigte sich auf ein KI-Gesetz…
Die Fortschritte im Bereich der KI entwickeln sich jedoch schneller als die Kontrollmaßnahmen. Zudem führen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern über Kontrollrichtlinien zu Einschränkungen bei der effektiven Kontrolle. Darüber hinaus könnte der KI-Wettlauf Staaten und Technologiekonzerne dazu verleiten, Vorschriften zum Zwecke des kommerziellen Gewinns zu umgehen. Gleichzeitig sind die Schattenseiten und potenziellen Risiken der KI allzu deutlich. Daher birgt KI trotz Kontrollmaßnahmen und vielversprechender Vorteile weiterhin erhebliche Risiken für die Welt.
Quellenlink


![[Foto] Präsident Luong Cuong empfängt den Sprecher des jordanischen Repräsentantenhauses, Mazen Turki El Qadi](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F02%2F03%2F1770112220330_ndo_br_1-3704-jpg.webp&w=3840&q=75)



































































































Kommentar (0)