
Durch die Dunkelheit „Kammersinfonie“
Man kann sagen, dass die Musik von D. Schostakowitsch ein Spiegel ist, der die Widersprüche der Zeit widerspiegelt, zwischen der Dunkelheit der Unterdrückung und dem Licht des menschlichen Willens, zwischen einer spöttischen Haltung und einem unbezwingbaren Geist.
Professor David Fanning, ein Musikforscher, der sich auf die beiden Komponisten Carl Nielsen und Dmitri Schostakowitsch spezialisiert hat, sagte: „Zwischen dem widersprüchlichen Druck der Regierungsforderungen, der Ausdauer der meisten seiner Kollegen und seinen persönlichen Vorstellungen vom Dienst an der Menschheit und der Öffentlichkeit gelang es ihm, eine musikalische Sprache von immenser emotionaler Kraft zu schaffen.“

Dmitri Schostakowitsch wurde am 25. September 1906 in St. Petersburg in eine bürgerliche Familie geboren; sein Vater war Chemiker, seine Mutter eine talentierte Pianistin. Schon früh mit dem Klavier vertraut und der Komposition zugewandt, gewann er den zweiten Preis beim ersten Chopin-Wettbewerb, vollendete seine 1. Sinfonie direkt nach seinem Abschluss am Konservatorium im Jahr 1926 und wurde vom Publikum als erster talentierter Komponist der Nachrevolutionszeit gefeiert.
Schostakowitsch fühlte sich der Generation zugehörig, die dank des Sieges der Revolution aufgewachsen war, und identifizierte sich instinktiv mit der Romantik der neuen Ära, der er angehörte. Mit einer beeindruckenden Sammlung an Auszeichnungen innerhalb und außerhalb der (ehemaligen) Sowjetunion galt er als „eine der prägendsten musikalischen Stimmen des 20. Jahrhunderts“ und hinterließ ein immenses kompositorisches Erbe.

Die Kammersinfonie (Op. 110a), die Musikdirektor Olivier Ochanine für das Konzert auswählte, ist ein Werk voller Traurigkeit, ein Selbstporträt in Klang, ein Bekenntnis von Schostakowitschs eigenem Schmerz und seiner völligen Erschöpfung, in dem er Krankheit, Einsamkeit und Qualen in sich trägt.
Die Geschichte besagt, dass Dmitri Schostakowitsch im Alter von 54 Jahren in die bombardierte Stadt Dresden reiste, um Musik für einen Film zu komponieren, der die schrecklichen Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs schilderte. Doch anstatt seinen ursprünglichen Zweck zu verfolgen, schuf er eines der tiefgründigsten und eindringlichsten Werke seiner Karriere: das „Streichquartett Nr. 8 in c-Moll“, das später von Rudolf Barschai für Streicher als „Kammersinfonie op. 110a“ transkribiert wurde.

Offiziell den „Opfern von Faschismus und Krieg“ gewidmet, ist das Werk in Wahrheit ein Denkmal für den Komponisten selbst. Der DSCH-Akkord (vier Töne D–Es–C–H), abgeleitet von seinen deutschen Initialen (D. Sch), hallt wider und wiederholt sich im gesamten Stück wie ein in jeden Takt eingravierter Code des Egos.
Die einzigartige Signatur, die er oft benutzte, um einige dieser Werke zu signieren, wenn er in der „Kammersinfonie“ auftrat, wurde implizit als schmerzhafte Bestätigung von „Ich bin immer noch hier“ inmitten einer Gemeinschaft verstanden, die die persönliche Farbe jedes Mitglieds auslöschen wollte.
Das Publikum scheint sich auf einer düsteren und schmerzhaften Reise durch die innere Welt des Komponisten zu bewegen, erfüllt von chaotischen Bewegungen. Von der Schwermut des einleitenden Largos bis zum verzerrten Rhythmus und der eindringlichen Wiederholung, die im zweiten Satz – Allegro Molto – den Schrecken des Krieges heraufbeschwört. Vom geisterhaften Walzer, der einem Tanz der Geister in den Ruinen des dritten Satzes gleicht, bis zur nachdenklichen Trauerfeier im vierten Satz. Und schließlich endet es mit dem schwachen Atemzug in der zerbrechlichen Stille des letzten Satzes, wie eine traurige und klagende Regung beim Nachdenken über Erinnerungen, das Ego und die Grenzen der Belastbarkeit eines jeden Menschen.

Die Erkundung seiner inneren Dunkelheit war für die meisten Zuschauer im Hoan-Kiem-Theater keine leichte Erfahrung. Die Melancholie und Verwirrung der „Kammersinfonie“ zu durchleben, war der subtilste Weg, die komplexe Innenwelt des Komponisten zu berühren. Umso ergreifender war es, als sie im strahlenden Licht des folgenden Werkes erstrahlten und erkannten, wie schön dieses Licht im Vergleich zu dem eben durchlebten dunklen Abgrund war. Dies war wohl auch die Absicht des französischen Dirigenten Olivier Ochanine, als er die „unerzählte Geschichte“ Schostakowitschs mit einem heiteren Werk, dem Konzert Nr. 1 für Klavier, Trompete und Streicher, abschloss.
So reist das SSO in die Vergangenheit, und wir begegnen in den letzten Lebensjahren eines jungen Schostakowitsch, der voller Leben und Intelligenz, aber auch seltsam sarkastisch und extravagant war. Im Konzert Nr. 1 für Klavier, Trompete und Streicher sind Klavier und Trompete nicht nur zwei Instrumente, sondern zwei Stimmen im Dialog – zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen Angst und Freiheit. Die Trompete scheint zu höhnen, arrogant über Tragödien zu lachen. Das Klavier hingegen weint und singt zugleich ein Lied voller Glauben an jeden Menschen.
Und begrüßen Sie das Licht mit „Konzert Nr. 1“.
Zu Lebzeiten Schostakowitschs Leben, seine Ideologie, seine politischen Ansichten und einige seiner Werke wurden unterschiedlich bewertet. Doch niemand kann leugnen, dass er ein großer Komponist war.
Anhand der Augen vieler berühmter Kritiker lässt sich in den Sinfonien der Einfluss von Mussogrsky, Tschaikowsky und in gewissem Maße auch Rachmaninow auf Schostakowitsch in der epischen Form und den kraftvollen Orchesterarrangements erkennen.
Doch im Bereich der Konzerte, insbesondere der Klavierkonzerte, versuchte Schostakowitsch, sich so weit wie möglich von den großen russischen Vorbildern zu entfernen. Vergleicht man Schostakowitschs Klavierkonzert Nr. 1 mit ähnlichen Werken seiner Zeitgenossen, lässt sich kaum sagen, dass sie demselben Genre angehören.

Während Rachmaninow, Tschaikowsky oder Brahms versuchten, die Klavierkonzerte zu so etwas wie einer Sinfonie mit Soloklavier auszubauen, machte Schostakowitsch aus seinem Werk etwas völlig Neues, Satirisches und Witziges, Kompaktes und Schönes.
Man sagt, Schostakowitsch habe ursprünglich ein Trompetenkonzert für Alexander Schmidt, den Solotrompeter der Leningrader Philharmonie, komponieren wollen, doch da er die technischen Herausforderungen als zu schwierig empfand, beschloss er, Klavier hinzuzufügen und daraus ein Konzert für zwei Instrumente mit einem nur aus Streichern bestehenden Orchester zu machen – was für Schostakowitsch recht ungewöhnlich war.
Das Werk zeigt auch eine ungewöhnliche Seite seiner Musik, indem es Unterhaltung, Spaß und Witz bietet und zu einem der beliebtesten Konzerte der Gegenwart wurde.
Das 1933 komponierte Klavierkonzert Nr. 1 ist eines von Schostakowitschs brillantesten und kühnsten Werken – ein satirisches Konzert, durchwoben von jugendlichem Elan, scharfem Witz und unerwarteten Momenten tiefgründiger Schönheit.
Das für Klavier, Trompete und Streicher geschriebene Werk ist beinahe ein Doppelkonzert: Die Trompete übernimmt die Rollen des Kommentators, des Spaßmachers und des Provokateurs und liefert sich mit dem Klavier geistreiche und unerwartete Wortgefechte. Die mitreißende, spielerische Energie des Werkes spiegelt den jungen Schostakowitsch wider – einen virtuosen Interpreten und zugleich einen schelmischen Satiriker.
Die vier Sätze des Werkes sind ein Wirbelwind aus Stil und Gefühl, der von den verspielten Fanfaren und dem pointierten Dialog zweier Instrumente im ersten Satz zu den warmen und zarten Klavierklängen des zweiten Satzes übergeht. Kurze, geheimnisvolle Pausen unterbrechen die beiden Welten im dritten Satz mit üppigen Harmonien, und der letzte Satz mündet in ein verschmitztes Lächeln und ein schelmisches Augenzwinkern.
Die Aufgabe, dieses Konzert in der Hauptstadt dem Publikum zu präsentieren, übernehmen zwei Künstler: der Klaviersolist Luu Duc Anh und der Trompetensolist Daiki Yamanoi. Luu Duc Anh zählt zu den führenden Pianisten Vietnams und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Er besuchte renommierte Musikhochschulen, erhielt nationale und internationale Auszeichnungen, spielte in angesehenen Orchestern und war Juror bei renommierten Wettbewerben.
„Konzert Nr. 1“ berührte die Herzen des Publikums dank der virtuosen Darbietung und der emotionalen Tiefe dieses geliebten Gesichts.

An seiner Seite fungiert Daiki Yamanoi, stellvertretender Trompeter des Sun Symphony Orchestra, als Partner und Jongleur, der in jedem musikalischen Dialog Witz und Lyrik miteinander verwebt.
Gemeinsam erhellen sie Schostakowitschs paradoxe Welt – in der Lachen und Verzweiflung Hand in Hand gehen und Satire zum wahrhaftigsten Ausdruck der Botschaften des Autors wird.
Das Konzert „Schostakowitsch – Unbekannte Geschichten“ begann mit „Michail Glinkas Walzerfantasie“, einem Tanz der Träume, einem klaren, romantischen und leichten Raum. Glinka, der Pionier der russischen Musik, legte mit sanfter, zerbrechlicher Schönheit den Grundstein für den Abend, bevor Schostakowitschs musikalische Welt die Zerbrechlichkeit dieses Traums angesichts der Last der Geschichte offenbarte. Beide Komponisten, in zwei verschiedenen Schaffensperioden, machten den Walzer zu einem Symbol des menschlichen Lebens – anmutig und eindringlich, aber auch potenziell unbezwingbar und voller Vitalität.
Quelle: https://nhandan.vn/bang-qua-bong-toi-de-don-chao-anh-sang-post923587.html


![[Foto] Generalsekretär To Lam und der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, nehmen an der Feier zum 80. Jahrestag des traditionellen Tages des vietnamesischen Inspektionssektors teil.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)






















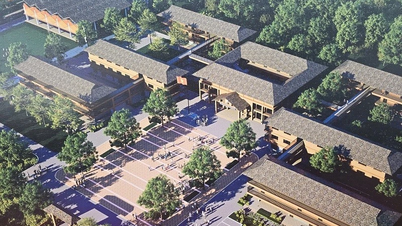







































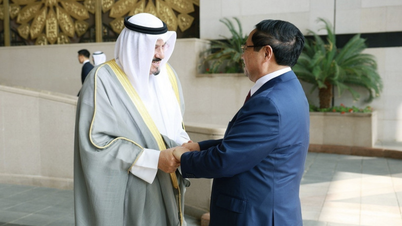





































Kommentar (0)