Es wird als Rettungsmaßnahme für einen Sektor angesehen, der einst als Symbol der industriellen Macht des alten Kontinents galt und rund 300.000 Menschen beschäftigte.

Die Stahlwerke, die einst das „Herz“ der industriellen Revolution in Europa bildeten, sind nicht mehr so leistungsfähig wie früher und stehen vor beispiellosen Herausforderungen.
Neben dem Wettbewerbsdruck steht die europäische Stahlindustrie auch vor der Herausforderung, ökologische Entwicklung und Produktionskosten in Einklang zu bringen. Aus diesen Gründen befinden sich die Stahlunternehmen in einer schweren Krise. Allein im Jahr 2024 werden mehr als 18.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.
Die europäische Stahlindustrie, die in 20 Mitgliedstaaten 300.000 Menschen direkt beschäftigt, sieht sich laut Analysten mit einer globalen Überkapazität von bis zu 700 Millionen Tonnen konfrontiert. Obwohl die Stahlwerke in Europa über eine Produktionskapazität von 135 Millionen Tonnen pro Jahr verfügen, arbeiten sie aufgrund der sinkenden Nachfrage derzeit nur mit 70 % Auslastung.
Als erster Grund werden die hohen Energiepreise genannt, die durch den Stopp der Gaslieferungen aus Russland verursacht wurden. Dies hat den Metallhütten, die enorm energieintensiv sind, einen schweren Schlag versetzt.
Der zweite Grund liegt in den billigen Stahlprodukten, die aus China, Indien und vielen anderen Ländern exportiert werden und den Weltmarkt überschwemmen.
Aktuelle Zahlen belegen, dass China mehr als 50 % der weltweiten Stahlproduktion ausmacht. Überkapazitäten und starke Exporte haben die Handelsspannungen verschärft und Länder gezwungen, ihre Abwehrmaßnahmen, wie beispielsweise Antidumpinguntersuchungen, zu verstärken.
Die größte Hürde für die europäische Stahlindustrie ist tatsächlich der Technologiewandel. Der „Green Deal“ der Europäischen Union (EU) mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen bis 2050 auf null zu reduzieren, setzt die Stahlhersteller enorm unter Druck, auf sauberere Technologien umzusteigen.
Dies erfordert jedoch enorme Investitionskosten. Schätzungen zufolge kann der Bau eines großtechnischen Werks zur Herstellung von grünem Stahl Milliarden von Euro kosten. Zudem wird grüner Stahl voraussichtlich 30 bis 100 % teurer sein als konventioneller Stahl. Gleichzeitig produzieren Wettbewerber dank niedriger Energiekosten und emissionsintensiver Technologien weiterhin Stahl zu niedrigen Preisen. Dies benachteiligt europäische Hersteller auf dem Weltmarkt erheblich.
Zum Schutz dieser wichtigen Branche ergreift die EU Maßnahmen an vielen Fronten, darunter den Aufbau strenger Handelsschutzbarrieren, die Verschärfung der Quoten und die Beschränkung des Marktzugangs für Stahl aus Nicht-EU-Ländern auf lediglich 10 %. Insbesondere wird der Zollsatz für Lieferungen, die die Quote überschreiten, von 25 % auf 50 % verdoppelt.
„Dies ist die stärkste Schutzklausel“, die jemals für die europäische Stahlindustrie vorgeschlagen wurde“, sagte Stéphane Séjourné, EU-Kommissar für Wohlstand und Industriestrategie.
Die EU-Kommission hat zudem staatliche Soforthilfepakete genehmigt, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, Stahlunternehmen finanziell bei der Bewältigung der hohen Energiepreise zu unterstützen. Deutschland, Frankreich und Spanien spielen dabei eine Vorreiterrolle, indem sie Kapital bereitstellen, um den Betrieb der Werke aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze zu sichern.
Bemerkenswert ist, dass die EU nicht nur alte Technologien schützt, sondern eine technologische Revolution anstrebt. Der Plan für einen „Grünen Stahlpakt“ bildet das Herzstück dieser Strategie.
Laut Kommentatoren hängt der Erfolg der EU jedoch nicht nur von der richtigen Politik ab, sondern auch von der Fähigkeit, das Energieproblem zu lösen, enormes Kapital zu mobilisieren und einen Konsens innerhalb des Blocks aufrechtzuerhalten.
Dies ist eine existenzielle Herausforderung: Kann Europa sowohl das „Herz“ der industriellen Revolution bewahren als auch die Revolution bei der Bewältigung des globalen Klimawandels anführen?
(Laut EU News, Politico)
Quelle: https://hanoimoi.vn/chau-au-tim-cach-giai-cuu-nganh-thep-718937.html






![[Foto] Dan-Berg-Ginseng, ein kostbares Geschenk der Natur an das Kinh-Bac-Land](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F30%2F1764493588163_ndo_br_anh-longform-jpg.webp&w=3840&q=75)

























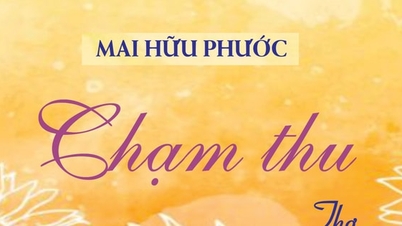






























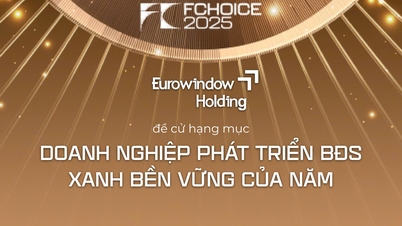




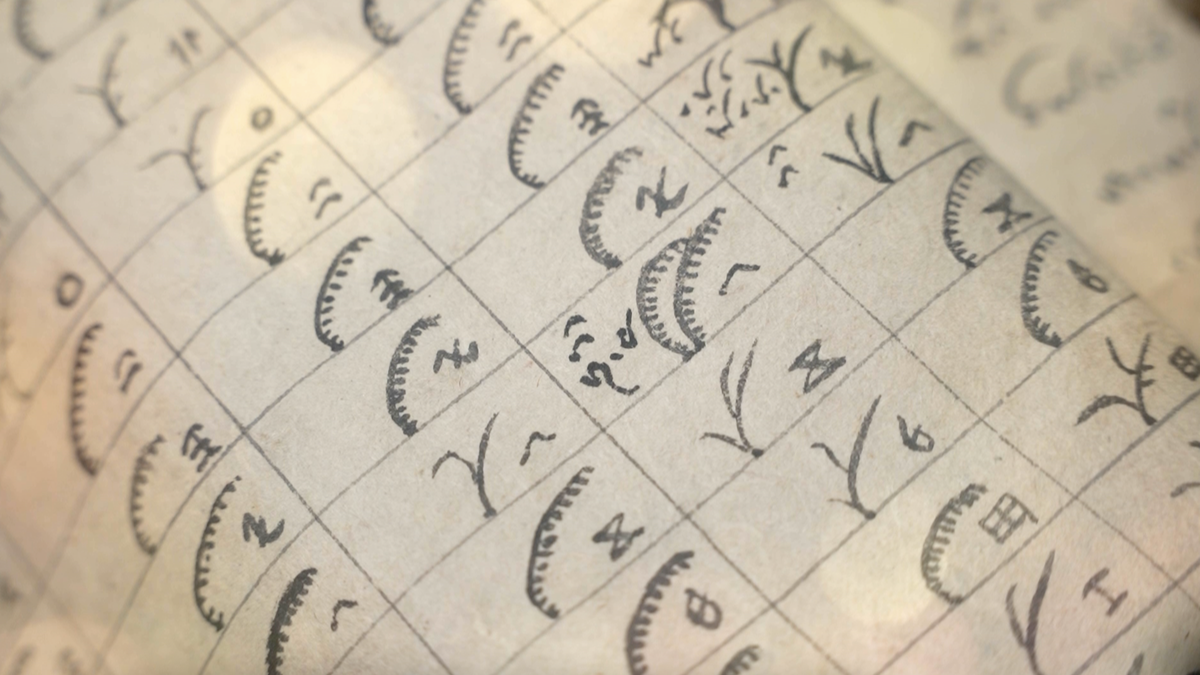












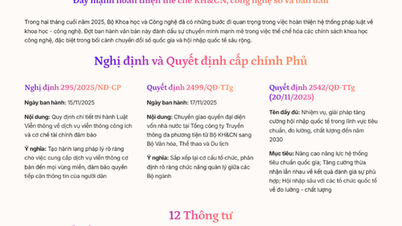




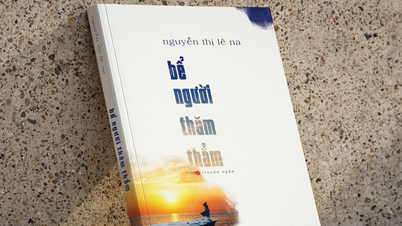



















Kommentar (0)