Milliarden von Vögeln unternehmen jedes Jahr diese gewaltigen Wanderungen und fliegen Tausende von Kilometern, um ihre Zielorte zu erreichen. Einige Arten, wie die Küstenseeschwalbe ( Sterna paradisaea ), legen in ihrem Leben sogar eine Strecke zurück, die der Entfernung von der Erde zum Mond und zurück entspricht.
Die Frage ist, wie können diese winzigen Lebewesen auf solch epischen Reisen so präzise navigieren?
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Vögel über ein komplexes Spektrum an Sinnen zur Navigation verfügen, von denen einige bekannt sind, viele aber für den Menschen weiterhin ein Rätsel bleiben.
Die Richtungssinne
Sehen und Riechen sind zwei grundlegende Orientierungshilfen, die Vögel nutzen. Vögel, die bereits einmal gewandert sind, können sich vertraute Orientierungspunkte wie Flüsse und Gebirgsketten einprägen.
Im Gegensatz dazu haben Zugvögel, die über Wasser ziehen, weniger Orientierungspunkte. In diesen Fällen verlassen sie sich stärker auf ihren Geruchssinn. Eine Studie ergab, dass Scopoli-Seevögel ( Calonectris diomedea ) bei eingeschränktem Geruchssinn zwar noch über Land fliegen konnten, aber über Wasser die Orientierung verloren.
Vögel nutzen möglicherweise auch Sonne und Sterne als „Leitlinien“. Tagsüber fliegende Vögel verwenden einen „Sonnenkompass“, indem sie ihre Wahrnehmung der Sonnenposition am Himmel mit ihrer inneren Wahrnehmung der Tageszeit auf der Grundlage ihres zirkadianen Rhythmus kombinieren.
Durch die Kombination dieser beiden Informationen können Vögel, wie eine lebende Sonnenuhr, bestimmen, in welche Richtung sie fliegen.
Untersuchungen zeigen, dass die Störung des zirkadianen Rhythmus von Vögeln durch künstliches Licht sie daran hindert, sich genau zu orientieren, was die Bedeutung des Sonnenkompasses für tagaktive Zugvögel verdeutlicht.
Da die meisten Vögel nachts ziehen, ist der Sonnenstand für sie kaum von Nutzen. In diesem Fall orientieren sie sich an der Position und Rotation der Sterne. Sie nutzen diesen Sternenkompass, indem sie die Position der Sterne um den Himmelspol, den Polaris – jenen Stern, den die Menschen seit Jahrtausenden zur Navigation verwenden – kennenlernen.

Das Erdmagnetfeld: Das geheimnisvolle Gefühl
Was aber, wenn der Himmel bewölkt ist und der Vogel weder die Sonne noch die Sterne oder andere Orientierungspunkte sehen kann? Genau dann kommen die erstaunlichen Sinne des Vogels zum Einsatz.
Vögel können sich auch ohne Sonne oder Sterne orientieren, unter anderem dank eines Sinnes namens Magnetorezeption. Dieser Sinn ermöglicht es ihnen, das Magnetfeld der Erde wahrzunehmen.
Diese besondere Fähigkeit mag wie Science-Fiction klingen, aber Untersuchungen zeigen, dass Eingriffe in Magnetfelder einen großen Einfluss auf Vögel haben; so wurde beispielsweise in einer Studie festgestellt, dass die Veränderung der Magnetfelder um Tauben deren Fähigkeit, den Weg nach Hause zu finden, beeinträchtigte.
Es ist zwar bekannt, dass Vögel Magnetfelder wahrnehmen können, doch wie genau sie das tun, ist Wissenschaftlern noch immer ein Rätsel. Professor Peter Hore von der Universität Oxford vermutet, dass Vögel eine Art chemische Reaktion nutzen müssen, deren Ergebnis von der Stärke und Richtung des Erdmagnetfelds abhängt.
Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie diese chemische Reaktion abläuft, doch Professor Hore vermutet, dass sie auf ein Molekül namens Cryptochrom zurückzuführen ist, das in der Netzhaut des Vogels vorkommt. Forscher haben im Labor bestätigt, dass isoliertes Cryptochrom auf Magnetfelder reagiert und dass diese Reaktion blaues Licht erfordert, welches nachweislich für die Fähigkeit von Vögeln, Magnetfelder wahrzunehmen, unerlässlich ist.
Die Forscher sind sich jedoch noch immer nicht sicher, wie empfindlich Kryptochrome auf die Wahrnehmung kleiner Veränderungen des Erdmagnetfelds reagieren. „Wir wissen sehr wenig über die Funktionsweise dieses Kompasses“, sagt Professor Hore. „Wir wissen nicht einmal, wie viele Kryptochrommoleküle sich in der Netzhaut des Vogels befinden.“
Einige Forschungen deuten zudem auf einen magnetischen Wahrnehmungsmechanismus im Schnabel des Vogels hin. Der obere Teil des Schnabels besitzt Rezeptoren, die mit Magnetit, einem eisenhaltigen Mineral, interagieren. Diese Rezeptoren sind über wichtige neuronale Verbindungen mit dem Gehirn verbunden, was darauf hindeutet, dass Vögel sie möglicherweise als eine weitere Methode zur Messung der Stärke von Magnetfeldern nutzen.
Neben der Wahrnehmung von Magnetfeldern können Vögel auch Informationen über die Richtung gewinnen, indem sie polarisiertes Licht detektieren, eine Art von Licht, dessen Wellen in einer bestimmten Ausrichtungsebene schwingen.
Sonnenlicht wird beim Durchgang durch die Erdatmosphäre auf vorhersehbare Weise polarisiert. Mithilfe spezieller Zellen in ihrer Netzhaut können Vögel diese Muster wahrnehmen und so Informationen über die Position der Sonne gewinnen, selbst bei Bewölkung.
Die einzelnen Teile zusammensetzen
So wie wir tagsüber unsere Augen benutzen, nachts aber unsere Hände, um uns in einem schwach beleuchteten Raum zurechtzufinden, nutzen Vögel zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Sinne.
Vögel können ihre Kompasssignale zur Navigation nutzen. Jedes Signal hat dabei eine unterschiedliche Bedeutung; beispielsweise ist die Magnetfeldwahrnehmung bei Gewittern oder Sonnenmaxima weniger hilfreich, da beides das Erdmagnetfeld stören kann.
Und all diese Strategien werden maßgeblich durch die Genetik der Vögel begünstigt. Vögel erben ihre Zuggewohnheiten von ihren Eltern. Die zurückgelegte Strecke und Richtung jeder Art wird weitgehend durch die Genetik bestimmt.
Zu den Schutzmaßnahmen gehört die Umsiedlung in andere Lebensräume, doch diese Bemühungen waren bisher erfolglos, da die Tiere so gut navigieren können, dass sie nach der Umsiedlung oft in ihre alten Lebensräume zurückkehren.
Deshalb arbeiten Forscher weiterhin daran, genau zu verstehen, welche Gene für das Zugverhalten von Vögeln verantwortlich sind, denn das Verständnis dieser Systeme ist für den zukünftigen Vogelschutz unerlässlich.
Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/giai-ma-kha-nang-dac-biet-xac-dinh-phuong-huong-cua-cac-loai-chim-di-cu-20250620020130525.htm




![[Foto] Eröffnung der 14. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762310995216_a5-bnd-5742-5255-jpg.webp)








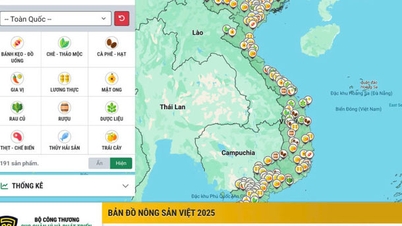





![[Video] Nicht allein – Tag der Online-Sicherheit](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762347906381_sequence-0100-00-17-02still001-jpg.webp)


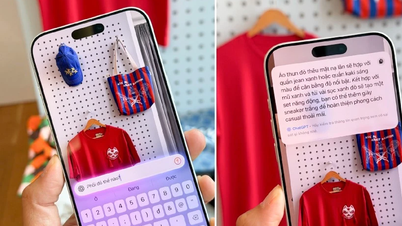












![[Foto] Panorama des Patriotischen Wettbewerbskongresses der Zeitung Nhan Dan für den Zeitraum 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)
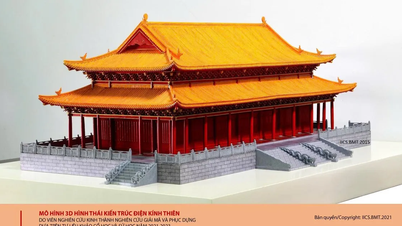


































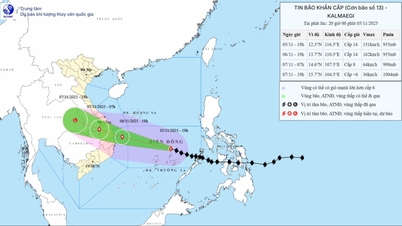











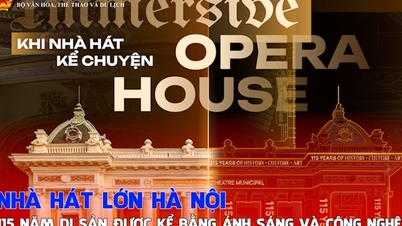










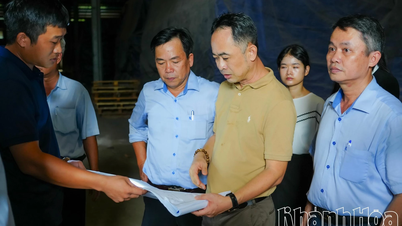














Kommentar (0)