
Dieser Trend spiegelt sich in den USA wider, die hohe Zölle auf chinesische Waren erheben und Gesetze wie den CHIPS Act und den Science Act erlassen haben, deren erklärtes Ziel die Reindustrialisierung ist, sowie in den Bemühungen, Schlüsseltechnologien zu kontrollieren. Auch die Europäische Union (EU) bildet mit ihrer Politik der strategischen Autonomie, die auf dem Europäischen Green Deal basiert, und Maßnahmen zum Schutz ihres Binnenmarktes keine Ausnahme. Indien erhebt seit 2018 ebenfalls Zölle auf importierte Solarmodule, um den Zustrom ähnlicher Produkte aus China zu verhindern.
Nichttarifäre Maßnahmen oder technische Handelshemmnisse, wie beispielsweise sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen, werden immer häufiger eingesetzt. Bis 2022 werden über 70 % des Welthandels technischen Handelshemmnissen unterliegen. Durch die Festlegung spezifischer Vorschriften hinsichtlich der Art des Produkts oder der Produktionsmethode schaffen diese Maßnahmen faktisch Handelshemmnisse für Produkte, die den neuen Regeln nicht entsprechen. Die EU hat eine solche Politik zum Schutz ihres heimischen Agrarsektors konsequent verfolgt; 90 % des Agrarhandels unterliegen diesen Bedingungen. Die restriktiven Maßnahmen stellen eine Ausnahme vom Meistbegünstigungsprinzip dar und stehen im Widerspruch zum Multilateralismus, für den sich die Welthandelsorganisation (WTO) einsetzt.
China ist vom zunehmenden Protektionismus besonders stark betroffen. Der Beitritt zur WTO im Jahr 2001 ging mit einem Exportwachstum einher, da das Land von deutlich reduzierten Zöllen auf seine Exporte (im Rahmen der Meistbegünstigungsklausel) profitierte. Seit der Finanzkrise von 2008 ist die asiatische Wirtschaftsmacht jedoch ins Visier der WTO-Mitglieder geraten. 2019 waren 45 % der weltweiten Importe von temporären protektionistischen Maßnahmen im Zusammenhang mit China betroffen, gegenüber 14 % im Jahr 2001. Dieser Anteil ist aufgrund der Handelsspannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, die sich seit der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump (2017–2021) verschärft haben, weiter gestiegen.
Das vergangene Jahrzehnt war auch von einem Wandel in der Handelspolitik geprägt. Die klassischen Begründungen für den Schutz der heimischen Industrie wurden durch politische und, allgemeiner gefasst, geopolitische Argumente ersetzt. Trumps erste Amtszeit als Präsident ist ein Paradebeispiel dafür und verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen Handelspolitik und Wahlprogramm. Er baute eine Medienkampagne auf dem Slogan „America First“ auf, um die Präsidentschaftswahl 2017–2021 zu gewinnen, und wurde bei der jüngsten US-Präsidentschaftswahl mit dem Slogan „Make America Great Again“ wiedergewählt.
Schließlich lässt sich feststellen, dass Länder zunehmend auf unkonventionelle Instrumente zurückgreifen, die auf den ersten Blick nicht protektionistisch erscheinen, aber eine sehr starke protektionistische Wirkung haben. So ermöglicht beispielsweise der im Juli 2022 von der US-Regierung verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) US-Haushalten und -Unternehmen, von Subventionen für den Konsum und die Produktion von Elektrofahrzeugen zu profitieren. Unter dem Deckmantel der Förderung der Elektroautoindustrie sieht das Gesetz jedoch öffentliche Subventionen mit inländischen Vorzugsregelungen vor. Auch die EU hat sich mit neuen Handelsinstrumenten ausgestattet, die es ihr ermöglichen, als Reaktion auf externen Druck Maßnahmen zur Stärkung interner protektionistischer Politiken zu ergreifen.
Chancen und Herausforderungen sind eng miteinander verknüpft.
Protektionistische Maßnahmen haben zu einer grundlegenden Umstrukturierung der globalen Lieferketten geführt. Unternehmen verlagern ihren Fokus von der Kostenoptimierung hin zur Gewährleistung der Produktsicherheit. Weltweit lassen sich drei Haupttrends beobachten: die Verlagerung der Produktion zu vertrauenswürdigen Partnern (Friendshoring), die Verlagerung der Produktion näher an den Verbrauchermarkt (Nearshoring) und die Rückverlagerung von Produktionslinien ins Inland (Reshoring).
Diese gezielte Neuausrichtung des Handels aus Sicherheitsgründen führt zunehmend zu einer Logik der Nähe, sowohl geografisch als auch wertmäßig – eine Möglichkeit, den Konzepten des Nearshoring oder Friendshoring Gestalt zu verleihen. Tatsächlich wollen die USA im Rahmen des USMCA-Abkommens (United States-Canada-Mexico Agreement) enger zusammenarbeiten und Wertschöpfungsketten auf dem US-amerikanischen Festland aufbauen. In Asien priorisieren die USA, im Sinne der Globalisierung unter Freunden, den Handel mit ihren Verbündeten – Japan, Südkorea und Taiwan (China) – insbesondere den Austausch von Schlüsseltechnologien wie der neuesten Chipgeneration.
Der Trend zur Deglobalisierung birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Positiv ist, dass er die Sicherheit der Lieferketten stärkt, die heimische Industrieentwicklung fördert und die Abhängigkeit von einzelnen Bezugsquellen verringert. Die negativen Auswirkungen lassen sich jedoch nicht leugnen: steigende Produktionskosten, höhere Inflation und geringere Wirtschaftlichkeit aufgrund des Verlusts von Spezialisierung und Skaleneffekten.
Laut Isabelle Job-Bazille, Leiterin der Wirtschaftsforschung bei Crédit Agricole in Frankreich, deuten jüngste Ereignisse zwar auf einen verstärkten protektionistischen Trend hin, doch die Umsetzung protektionistischer Maßnahmen gestaltet sich angesichts der Verflechtung internationaler Wertschöpfungsketten für Regierungen zunehmend schwieriger und unsicherer. Daher lässt sich schwer vorhersagen, ob die Volkswirtschaften, die protektionistische Maßnahmen ergreifen, letztendlich höhere Zusatzkosten tragen müssen als die ursprünglich anvisierten Volkswirtschaften.
Eine aktuelle Studie der US-Ökonomen Mary Amiti, Stephen Redding und David Weinstein ergab beispielsweise, dass die Gewinnmargen von Unternehmen, die in die USA exportierten, im Jahr 2018 während der protektionistischen Maßnahmen der Trump-Regierung unverändert blieben, da die gesamten Zollerhöhungen an den Verkaufspreis weitergegeben wurden. Folglich waren es US-Verbraucher und US-Unternehmen, die für ihre Produktion benötigte Güter importierten, die die protektionistischen Zölle zahlten, deren Kosten auf bis zu vier Milliarden US-Dollar pro Monat geschätzt wurden.
Die unter Präsident Trump eingeführten protektionistischen Maßnahmen in Form von Zöllen haben die Preise für Waren aus China in die USA erhöht. Leidtragende dieser Preiserhöhung sind die inländischen Verbraucher und importierenden Unternehmen, nicht etwa Unternehmen oder exportierende Länder. Dies verdeutlicht die mögliche Unvereinbarkeit der Ziele von Regierungen und Unternehmen. Geopolitik ist zwar Sache der Regierungen, ihre Umsetzung in wirtschaftliche Beziehungen hängt jedoch vom Verhalten von Unternehmen, häufig multinationalen Konzernen, ab.
Mit Blick auf die Zukunft ist zu erwarten, dass sich der protektionistische Trend in den kommenden Jahren fortsetzt und verstärkt. Im Zeitraum 2024–2025 werden protektionistische Maßnahmen und die Umstrukturierung der Lieferketten weiter voranschreiten. Bis 2026–2030 dürfte sich eine multipolare Handelsordnung mit regionalen Lieferketten und einem neuen Gleichgewicht in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen herausbilden. In diesem Kontext müssen die Länder geeignete nationale Industriestrategien entwickeln, ihre Handelsbeziehungen diversifizieren und massiv in Technologie und Humankapital investieren.
Entscheidend ist es, ein Gleichgewicht zwischen Protektionismus und Offenheit, zwischen Sicherheit und Effizienz zu finden. Für Unternehmen ist dies ein wichtiger Zeitpunkt, um ihre Strategien anzupassen. Es gilt, Lieferketten zu diversifizieren, Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben und den Inlandsmarkt als Schutzwall gegen externe Schwankungen auszubauen.
Der Trend zur Deglobalisierung und zum Handelsprotektionismus bedeutet nicht das Ende der internationalen Zusammenarbeit. Vielmehr erlebt die Welt den Übergang zu einem neuen Modell, das Integration und Autonomie, Effizienz und Sicherheit in Einklang bringt. Die Herausforderung für die internationale Gemeinschaft besteht darin, diesen Übergang effektiv zu gestalten, unnötige Konflikte zu vermeiden und eine faire und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung für alle Beteiligten zu gewährleisten.
Abschließender Artikel: Vietnams Position auf dem Weltmarkt stärken
Quelle: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/trien-vong-tang-truong-tu-mot-the-gioi-bien-dong-bai-4-xu-huong-len-ngi-cua-chu-nghia-bao-ho-va-phi-toan-cau-hoa/20241206102115459






![[Foto] Abschluss der 14. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762404919012_a1-bnd-5975-5183-jpg.webp)

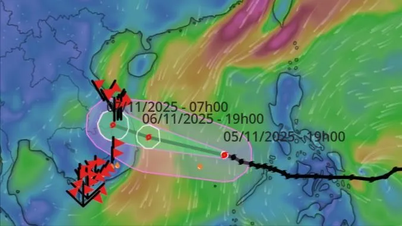









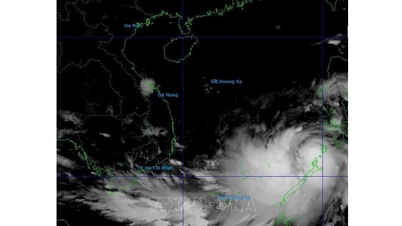


















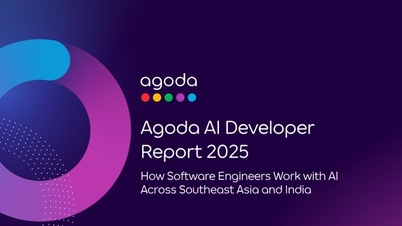







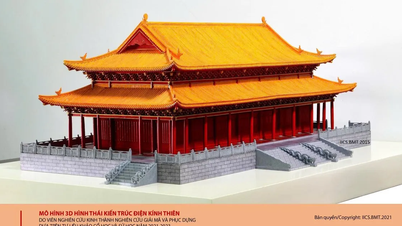





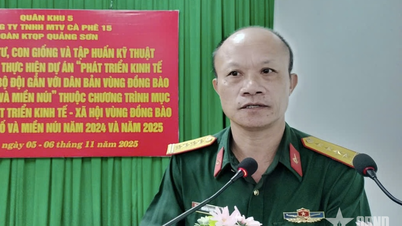






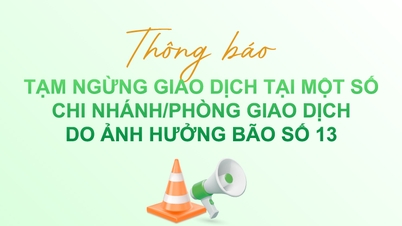

















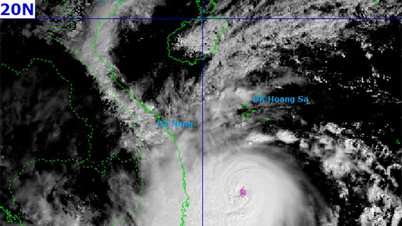













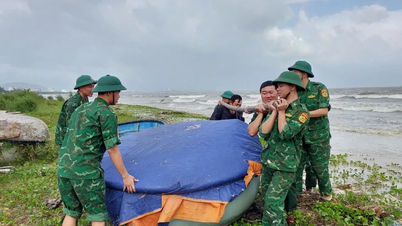






















Kommentar (0)