Forscher haben mindestens drei Wachstumsszenarien entwickelt, die zeigen, dass dies zwar machbar ist, aber einen hohen Aufwand erfordert. Laut einem Forschungsteam der School of Economics and Public Management (National Economics University) ist die „Wachstumswelle“ das geeignetste Szenario. Dabei erreicht das BIP im Zeitraum 2031–2035 mit etwa 11–12 % pro Jahr seinen Höchststand. Das Prinzip dieses Szenarios lautet: „Umfassende Vorbereitung, gezielte Beschleunigung und Effizienzoptimierung“.
Der Zeitraum von heute bis 2030 wird als Vorbereitungsphase bezeichnet, in der das BIP-Wachstum jährlich bei etwa 8–10 % liegen wird. Der Zeitraum von 2031 bis 2035 wird als Beschleunigungsphase bezeichnet, in der das Wachstum 11–12 % erreichen kann. In den nächsten zehn Jahren wird die Wachstumsrate schrittweise sinken, von etwa 8–9 % in den ersten fünf Jahren und 6,5–7,5 % in den letzten fünf Jahren.
Das zweite Szenario lautet „Starker Start – solide Konsolidierung und Aufrechterhaltung der Stabilität“. Phase 1 (2025–2029) weist eine jährliche Wachstumsrate von 11 %, Phase 2 (2030–2037) eine jährliche BIP-Wachstumsrate von 9 % und Phase 3 (2038–2045) eine jährliche BIP-Wachstumsrate von etwa 7–8 % auf. Das Modell des schnellen Starts kann dabei helfen, die anfängliche Dynamik für schnelles Wachstum zu nutzen, erzeugt aber auch großen Druck und führt leicht zu einem „Burnout“ – einer Überlastung der Ressourcen, der Infrastruktur und des Managementapparats –, da in kurzer Zeit viele Aufgaben gleichzeitig bewältigt werden müssen.
Im verbleibenden Szenario lautet die Designlogik „Den Höhepunkt halten – sanfte Landung“, unterteilt in drei Phasen von jeweils sieben Jahren. In den ersten sieben Jahren beträgt das BIP-Wachstum 11 % pro Jahr, in den darauffolgenden sieben Jahren 8,5–9 % und in den letzten sieben Jahren 6,5–7,5 %. Die Vorbereitungszeit ist lang und der Druck gleichmäßig verteilt. Doch die Aufrechterhaltung der Wachstumsdynamik über einen sehr langen Zeitraum von bis zu sieben Jahren ist eine große Herausforderung. Das eigentliche Problem ist jedoch die Qualität des Wachstums, die sich in der Lebensqualität und den praktischen Vorteilen für die Menschen widerspiegelt und die Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung stellt.
Die sinkende Verbrauchernachfrage in wichtigen Märkten wie den USA und der Europäischen Union (EU) könnte die Exporte – einen wichtigen Wachstumsmotor – beeinträchtigen. Handelsspannungen und hohe Zinsen in den USA und vielen großen Volkswirtschaften haben die globalen Kapitalkosten verteuert und damit die Kapitalströme nach Vietnam beeinträchtigt. Wechselkursschwankungen, insbesondere beim US-Dollar, könnten die Kosten für Rohstoffimporte erhöhen und sich negativ auf die Auslandsverschuldung auswirken.
Bis Ende Mai stieg der durchschnittliche Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,21 %. Dies zeigt, dass die Inflation zwar noch unter Kontrolle ist, wir uns aber nicht darauf ausruhen dürfen, da es weiterhin zahlreiche Risikofaktoren gibt, die die Inflation in der zweiten Jahreshälfte erhöhen können (Schwankungen der Energie- und Rohstoffpreise aufgrund geopolitischer Konflikte; Anpassung der Preise für öffentliche Dienstleistungen (Gesundheitswesen, Bildung, Strom) gemäß dem Fahrplan usw.). Und natürlich können Wachstumserfolge bei steigender Inflation nicht dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen wie gewünscht zu verbessern.
Unabhängig vom gewählten Szenario gilt in diesem Zusammenhang weiterhin, negative Schwankungen zu minimieren und die Interessen der Bevölkerung besser vor externen Risiken zu schützen. Da die Wirtschaft nach wie vor auf Kapital und Arbeit als Hauptwachstumstreiber angewiesen ist, ist es äußerst wichtig, Szenarien zu identifizieren, um den einzuschlagenden Weg, die bevorstehenden Herausforderungen und die künftigen Chancen klar zu erkennen.
Quelle: https://www.sggp.org.vn/xac-dinh-kich-ban-tang-truong-post798807.html








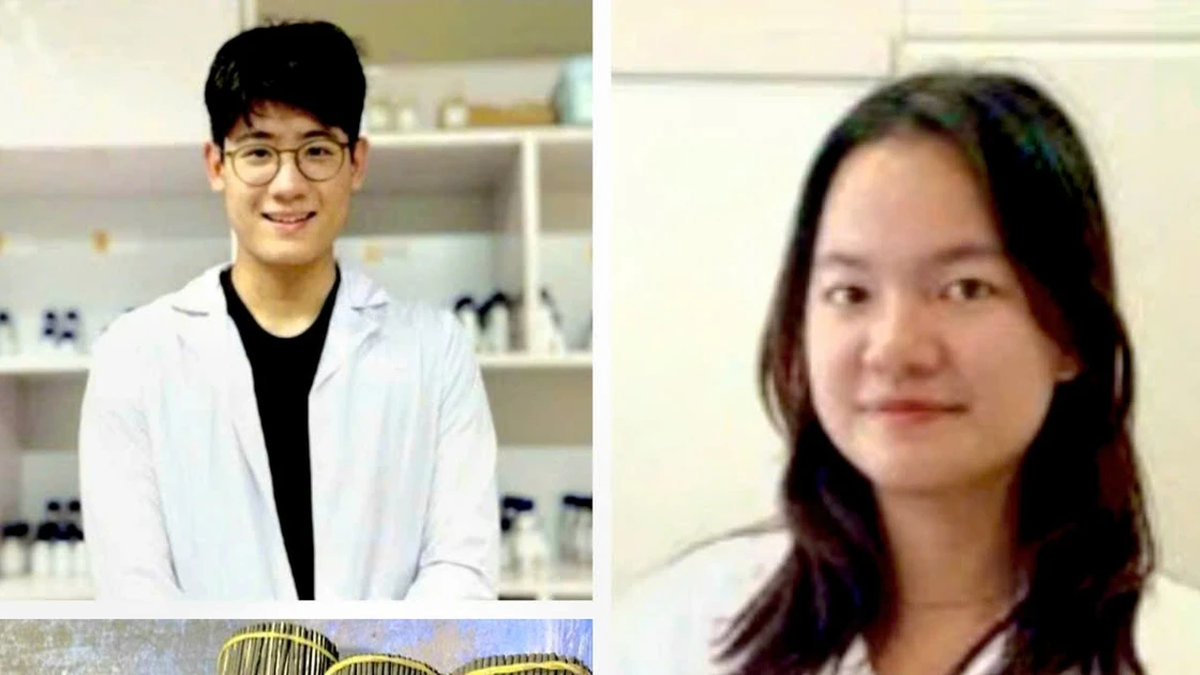



















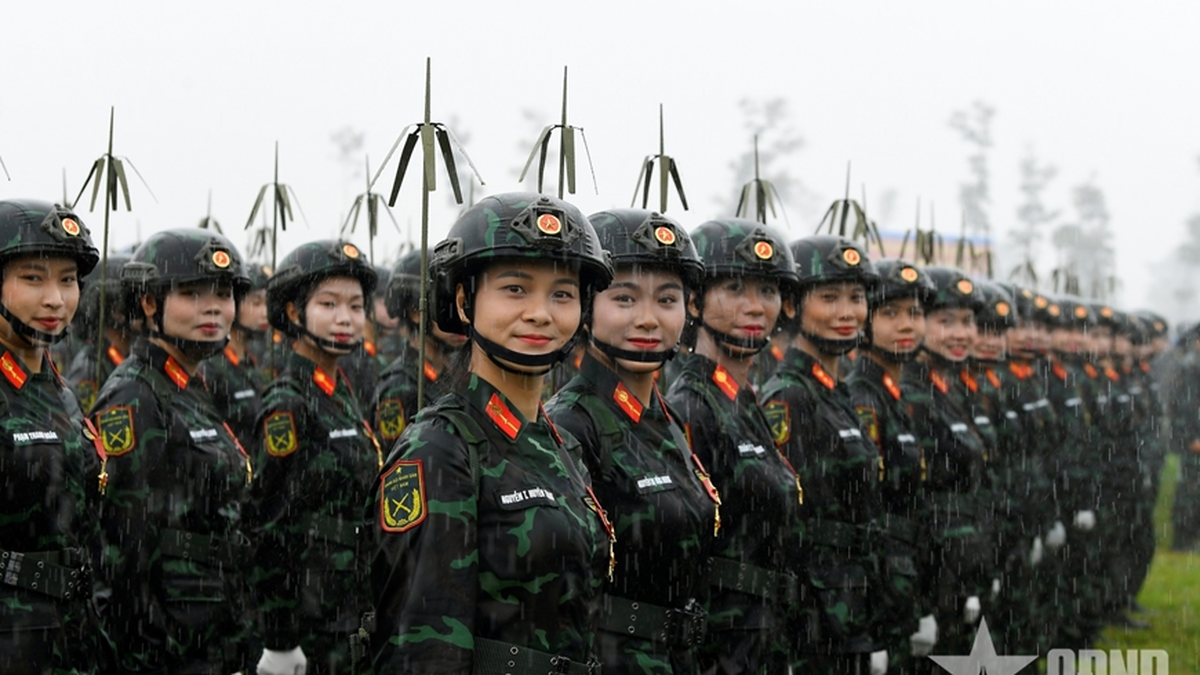



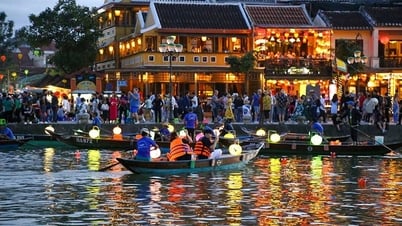




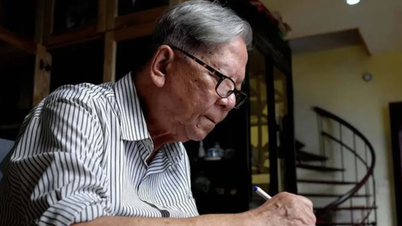
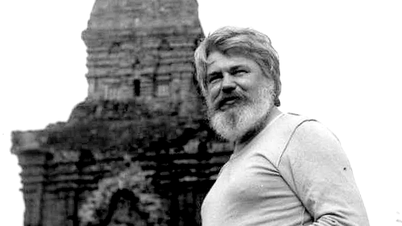





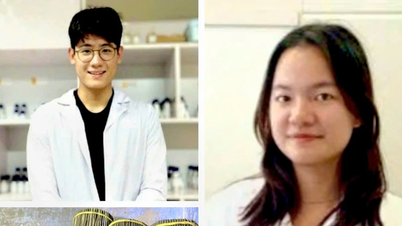























![[Foto] Partei- und Staatsführer besuchen das Mausoleum von Präsident Ho Chi Minh und opfern Weihrauch zum Gedenken an Helden und Märtyrer](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/17/ca4f4b61522f4945b3715b12ee1ac46c)






























Kommentar (0)