Überlebensschild von hinten
In der Natur besitzen viele Tiere kontrastierende, runde Flecken auf ihrem Körper, die wie Augen aussehen. Wissenschaftler nennen diese „falsche Augen“ oder Ocellen.
Von zarten Schmetterlingsflügeln über Fische bis hin zu Säugetieren wie Tigern spielen Ocellen eine entscheidende Rolle in Überlebensstrategien. Sie dienen vor allem dazu, Raubtiere zu täuschen, einzuschüchtern oder Angriffe abzuwehren. Es handelt sich um eine äußerst effektive Form der Überraschungs- oder Ablenkungstarnung.

Nahaufnahme des weißen Flecks hinter dem Ohr eines Tigers, den Wissenschaftler als „falsches Auge“ bezeichnen (Foto: Getty).
Bei Tigern sind die beiden weißen Flecken hinter den Ohren ein typisches Beispiel für Ocelli-Flecken. Wenn der Tiger den Kopf senkt, um sich auszuruhen, Beute zu jagen oder sich mit angelegten Ohren zu entspannen, sind diese beiden weißen Flecken deutlich sichtbar.
Von hinten erzeugen sie eine starke optische Täuschung, die potenzielle Fressfeinde (wie einen anderen Tiger oder opportunistische Raubtiere) dazu bringt, zu glauben, sie würden direkt von einem Paar großer, wachsamer Augen beobachtet.
Dieses Überraschungsmoment und das Gefühl, beobachtet zu werden, reichen möglicherweise aus, um einen potenziellen Angreifer von hinten zum Rückzug, Weggehen oder zumindest zum Zögern zu bewegen und dem Tiger so die Möglichkeit zur Reaktion zu geben.
Tatsächlich ist diese „Täuschungsmanöver“ so effektiv, dass sie sogar von Menschen übernommen wurde. Bewohner dichter Wälder wie der Sundarbans (Indien), dem Lebensraum der Tiger, tragen beim Betreten des Waldes Masken mit aufgesetzten Augen im Hinterkopf.
Dies ist keine Anekdote, sondern ein Überlebenstipp, der auf dem Verständnis des Verhaltens von Raubtieren beruht, die dazu neigen, eine direkte Konfrontation zu vermeiden, wenn sie glauben, entdeckt worden zu sein.

Die Bewohner der Sundarbans (Indien) fürchten Angriffe von Bengalischen Tigern und tragen deshalb Masken hinter dem Hals als Schutzvorrichtung. Sie glauben, dass dies jedes Mal, wenn sie den Wald betreten, dazu beitragen wird, die wilden Tiger abzuwehren (Foto: Getty).
Kommunikationsmethoden
Die Funktion dieser weißen Flecken beschränkt sich nicht auf die Verteidigung. Sie sind auch ein wichtiges Instrument der innerartlichen Kommunikation bei Tigern, insbesondere bei sozialen Interaktionen und Mutter-Kind-Beziehungen.
Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, den Jungtieren zu helfen, ihre Mütter wiederzufinden. In der dichten Waldumgebung mit ihrer dichten Vegetation und der eingeschränkten Sicht ist der ständige Sichtkontakt von größter Bedeutung.
Die kontrastreichen weißen Flecken auf dem dunkleren Fell der Ohrklappen fungieren als kleine „Leuchttürme“ und helfen den Jungen, ihre Mutter leicht zu finden und ihr zu folgen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen wie in der Dämmerung oder wenn sie sich schnell durch Büsche bewegen.

Der weiße Fleck hinter dem Ohr hilft dem Tigerjungen, seine Mutter wiederzufinden (Foto: Getty).
Darüber hinaus sind Tigerohren extrem flexibel und spielen eine wichtige Rolle beim Ausdruck von Emotionen und Absichten. Unterschiedliche Ohrpositionen – aufrecht bei Neugier, angelegt bei Aggression oder Angst und leicht gedreht zum Lauschen – sind allesamt wichtige visuelle Signale.
Die weißen Punkte verdeutlichen diese Bewegungen und Positionen.
Wenn ein Tiger Aggression zeigt, indem er seine Ohren anlegt, werden die weißen Flecken sichtbar, was das visuelle Signal noch verstärkt und die Botschaft für andere Tiger auch aus der Ferne deutlicher erkennbar macht.
Dies hilft, unnötige Konflikte zu vermeiden oder die Dominanz effektiv zu etablieren.
Aus Millionen von Jahren der Evolution entstanden
Das Vorhandensein des weißen Flecks hinter dem Ohr des Tigers ist keine zufällige Anordnung, sondern das Ergebnis natürlicher Selektion, die Millionen von Jahren angedauert hat.
Tiger mit klaren „falschen Augen“ können sich besser gegen Raubtiere verteidigen und mit Artgenossen kommunizieren und haben eine höhere Überlebens- und Fortpflanzungschance. Dadurch wird das Gen für dieses Merkmal vererbt und tritt in der Population häufiger auf.
Interessanterweise harmoniert dieses Paar weißer Flecken perfekt mit dem gesamten Tarnfell des Tigers.
Während das leuchtend orangefarbene Fell mit schwarzen Streifen, das dem menschlichen Auge sehr auffällig erscheint, über drei Farbkanäle (Trichromasie) verfügt, ist es für ihre Hauptbeutetiere wie Hirsche, Elche und Wildschweine ein perfekter Tarnumhang.

Das menschliche Auge kann Rot, Grün und Blau verarbeiten, daher erscheint uns ein Tiger orange (rechts). Hirsche, Elche und Wildschweine hingegen können nur Grün und Blau wahrnehmen, weshalb sie farbenblind sind (links) (Foto: Getty).
Diese Arten besitzen typischerweise nur zwei Farbwahrnehmungskanäle (Dichromasie), wodurch die orange Farbe des Tigers fast mit dem Grün der Blätter und der Dunkelheit des Waldes verschmilzt und ihn zu einem wahren "Geisterwesen" macht.
Tiger sind also in der Lage, sich bei der Jagd vollständig zu verstecken und verfügen zudem über spezielle Signale, die bei Bedarf zur Verteidigung oder Kommunikation aktiviert werden.
Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/tac-dung-dac-biet-cua-cham-trang-tren-tai-ho-con-nguoi-cung-phai-bat-chuoc-20250603225326228.htm


![[Foto] Panorama des Patriotischen Wettbewerbskongresses der Zeitung Nhan Dan für den Zeitraum 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)
![[Foto] Jugendliche in Ho-Chi-Minh-Stadt engagieren sich für eine sauberere Umwelt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762233574890_550816358-1108586934787014-6430522970717297480-n-1-jpg.webp)
![[Foto] Genosse Nguyen Duy Ngoc bekleidet das Amt des Sekretärs des Parteikomitees von Hanoi.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762234472658_a1-bnd-5518-8538-jpg.webp)
![[Foto] Die Straße, die Dong Nai mit Ho-Chi-Minh-Stadt verbindet, ist nach 5 Jahren Bauzeit immer noch nicht fertiggestellt.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762241675985_ndo_br_dji-20251104104418-0635-d-resize-1295-jpg.webp)

![[Foto] Ca Mau kämpft mit der höchsten Flut des Jahres; Prognosen zufolge wird die Alarmstufe 3 überschritten.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762235371445_ndo_br_trieu-cuong-2-6486-jpg.webp)













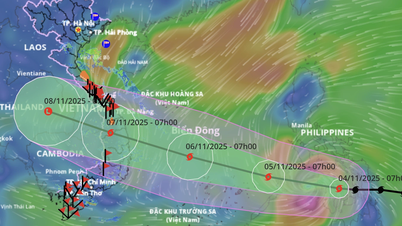


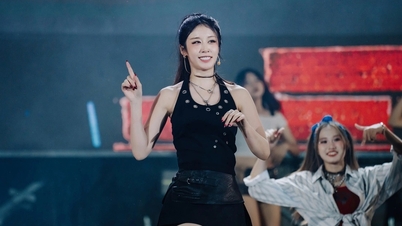





















































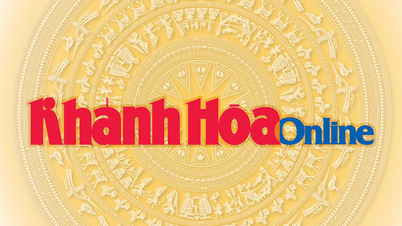



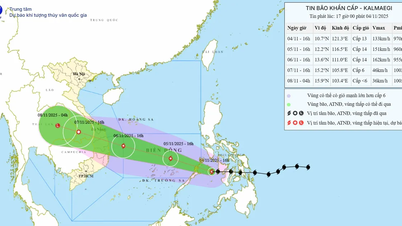


















Kommentar (0)