Das transatlantische Bündnis ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler westlicher Sicherheit und Prosperität. Die im Rahmen der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Partnerschaft dient nicht nur der Förderung der kollektiven Verteidigung durch die NATO, sondern auch der Stärkung gemeinsamer demokratischer Werte und der wirtschaftlichen Interdependenz vieler Nationen.
 |
| Der Artikel „Der Trump-Effekt: Neukalibrierung der transatlantischen Allianz“ wurde am 2. März auf Modern Diplomacy veröffentlicht. (Screenshot) |
Instabilität in der Folge
In dem oben genannten Artikel behauptet Dr. John Calabrese, dass Präsident Donald Trumps „America First“-Ideologie seit langem eine Strategie signalisiert, die Washingtons Interessen in den Vordergrund stellt, selbst auf Kosten langjähriger Allianzen. Während dieser Ansatz bisher auf die Innenpolitik beschränkt war, prägt er nun auch die US-Außenpolitik. Mit dem dritten Jahr des Ukraine-Konflikts zeigen sich zunehmend unterschiedliche Ansätze zwischen den USA und der EU in der Krisenbewältigung.
Dr. John Calabrese wies darauf hin, dass die Aussagen von Präsident Donald Trump zum Russland-Ukraine-Konflikt im Widerspruch zu der seit dem Zweiten Weltkrieg vorherrschenden Ansicht stünden, dass die Sicherheit Amerikas an die Stabilität Europas gebunden sei. Dies zeige einen „erdbebenartigen“ Wandel in der Außenpolitik Washingtons – eine Realität, die die Führer des „alten Kontinents“ immer weniger ignorieren könnten.
Präsident Trump machte Kiew für den Beginn des Konflikts verantwortlich, bezeichnete seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj als „Diktator“ und warnte, dass das Land schlimme Folgen zu tragen habe, wenn kein Frieden erreicht werde.
Herr Trump schickte eine Delegation nach Saudi-Arabien, um ohne Beteiligung der Ukraine oder Europas mit russischen Beamten zu verhandeln und Moskau Zugeständnisse anzubieten.
Darüber hinaus schlug der US-Präsident ein Abkommen vor, wonach Washington im Gegenzug für Hilfeleistungen einen Teil der ukrainischen Seltenen Erden und anderer Bodenschätze erhalten würde. Diese Maßnahmen haben das Vertrauen Europas in das amerikanische Engagement für die Sicherheitsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg ernsthaft untergraben.
Darüber hinaus tadelte Vizepräsident JD Vance in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 die europäischen Demokratien für ihr „Abweichen von gemeinsamen Werten“. Dieser Schritt unterstrich erneut eine klare Wende in der US-Politik, insbesondere im Hinblick auf das transatlantische Bündnis.
Die Geschichte der transatlantischen Partnerschaft ist gewiss nicht ohne Krisen. Von der Suezkrise 1956 über die Nuklearstrategiedebatte der 1960er Jahre und die Pattsituation um die Euroraketen in den 1980er Jahren bis hin zum Kosovo-Konflikt 1999 und dem US-geführten Irakkrieg 2003 sind transatlantische Spannungen nichts Neues.
Dr. John Calabrese betonte jedoch, dass frühere Streitigkeiten zwar schwerwiegend gewesen seien, sich aber hauptsächlich auf politische Differenzen bezogen hätten und beigelegt werden könnten. Im Gegensatz dazu signalisieren die aktuellen Ansätze der Trump-Regierung einen tiefgreifenden Wandel hin zu einer zunehmend fragmentierten Weltordnung , in der Macht gemeinsame Werte überlagern kann.
 |
| Während eines hitzigen Treffens im Weißen Haus am 28. Februar machte US-Präsident Donald Trump Kiew für den Beginn des Konflikts verantwortlich. (Quelle: AFP) |
Test für den „alten Kontinent“
Die europäischen Staats- und Regierungschefs bemühen sich, sich an die derzeit unbeständige Lage anzupassen. Einige fordern laut Dr. John Calabrese eine größere strategische Autonomie, um den Unsicherheiten entgegenzuwirken, die durch die unberechenbare Politik Washingtons entstehen.
Diese geopolitische Unsicherheit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Europa versucht, seine Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Die USA unterhalten eine bedeutende Militärpräsenz in Europa und sind mit rund 100.000 Soldaten in mehreren Ländern, insbesondere in Deutschland, stationiert.
Ein aktueller Bericht schätzt, dass der Kontinent zusätzliche 300.000 Soldaten und 262 Milliarden Dollar Investitionen benötigen würde, um Washingtons Rolle als Sicherheitsgarant vollständig zu ersetzen. Man kann davon ausgehen, dass Europa auch in naher Zukunft noch stark auf den US-Sicherheitsschirm angewiesen sein wird.
Doch selbst wenn Europa seine Verteidigungspolitik stärken will, sehe es sich mit wirtschaftlichem Gegenwind konfrontiert, so der Experte. Die Einführung von Vergeltungszöllen als Reaktion auf den US-Protektionismus brächte möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile, da viele europäische Länder sowohl als Exportmarkt als auch als Lieferant wichtiger Güter weiterhin stark von Washington abhängig seien.
Die Gefahr von Inflation und Handelskrieg verkompliziert die wirtschaftliche Lage der Region zusätzlich. Ein EU-weiter Konsens über solche Wirtschaftsmaßnahmen dürfte ebenfalls nicht einfach sein, und einseitige Maßnahmen könnten die internen Spaltungen innerhalb der Union vertiefen.
Während die Trump-Regierung mit Russland über eine Beendigung des Ukraine-Konflikts verhandelt, greift Europa weiterhin zu härteren Maßnahmen. Der Europäische Rat hat die 16. Runde wirtschaftlicher und personeller Sanktionen gegen Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft beschlossen.
Kurzfristig erwägen Großbritannien und Frankreich im Falle eines Waffenstillstands die Entsendung von Truppen als Teil einer Friedenstruppe in die Ukraine. Die Wirksamkeit einer solchen Initiative ohne US-Unterstützung bleibt jedoch abzuwarten, und es ist unklar, ob Washington dazu bereit ist.
Vor allem aber, so Dr. John Calabrese, würden diese diplomatischen Schritte zusammen mit Trumps umstrittenem Ansatz den wachsenden „Phasenunterschied“ in den Beziehungen zwischen den USA und Europa noch deutlicher machen und die Besorgnis auf dem „alten Kontinent“ hinsichtlich des Engagements Washingtons verstärken.
 |
| Die USA unterhalten derzeit eine bedeutende Militärmacht in Europa. Rund 100.000 Soldaten sind in vielen Ländern stationiert. (Quelle: CNN) |
Parallel dazu verstärkt Europa seine Bemühungen, seine Verteidigungsfähigkeit zu stärken. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine „Ausnahmeregelung für Verteidigungsinvestitionen“ vorgeschlagen, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen würde, Militärprojekte zu finanzieren, ohne die EU-Haushaltsgrenzen zu verletzen.
Allerdings bleibt die Durchführbarkeit solcher Maßnahmen angesichts der Fragmentierung der europäischen Verteidigungsindustrie und der Herausforderungen bei der Harmonisierung der nationalen militärischen Fähigkeiten fraglich.
In wirtschaftlicher Hinsicht versuchen EU-Vertreter in Washington, einen Handelskrieg abzuwenden, haben dabei aber offenbar kaum Fortschritte erzielt.
Ein für den 26. Februar geplantes Treffen zwischen der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, und dem US-Außenminister Marco Rubio wurde mit der Begründung „Terminprobleme“ abrupt abgesagt.
Die Tatsache, dass Europa sich nicht mehr so stark auf die USA verlassen kann wie früher, hat den „alten Kontinent“ dazu gezwungen, sowohl in der Verteidigungs- als auch in der Wirtschaftspolitik unabhängigere Wege zu suchen.
Dr. John Calabrese erwähnte in seinem Artikel das Konzept der Risikominderung. Dieses Konzept wurde ursprünglich von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen der EU und China eingeführt und kann nun auch auf die Beziehungen zu den USA angewendet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Risikominderung nicht den Abbruch der Beziehungen bedeutet, sondern vielmehr die Diversifizierung der Verteidigungsressourcen und der Wirtschaftspartner, die Verringerung der Abhängigkeit vom US-Markt, die Stärkung der Zusammenarbeit mit Ländern im Indopazifik und Investitionen in die heimische Verteidigungstechnologie.
Obwohl die Notwendigkeit der Risikominderung ein strategisches Gebot ist, bleibt der Weg dahin holprig und steinig. Interne Spaltungen, finanzieller Druck und die Trägheit der europäischen Bürokratien lassen große Zweifel an der Möglichkeit einer umfassenden Transformation in naher Zukunft aufkommen.
Brechen oder umformen
Laut Dr. John Calabrese könnte sich das amerikanisch-europäische Bündnis letztlich einem Gleichgewicht annähern, mit einem weniger abhängigen Europa. Sollten die USA ihren Isolationismus fortsetzen, könnte Europa gezwungen sein, eine eigenständige Außenpolitik zu entwickeln, nicht nur um seine eigenen Interessen zu schützen, sondern auch um die Stabilität der Weltordnung zu sichern.
Sollte das transatlantische Bündnis jedoch zunehmend gespalten werden, insbesondere im Umgang mit China und Russland, könnten rivalisierende Mächte dieses strategische Vakuum ausnutzen. Dies zwingt die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu, eine widerstandsfähige und diversifizierte Außenpolitik zu entwickeln.
Darüber hinaus, betonte Dr. John Calabrese, stelle die Unterstützung rechtsextremer nationalistischer Bewegungen in Europa durch die Trump-Regierung eine ideologische Herausforderung für die liberale demokratische Ordnung dar.
Dieser Riss ist nicht nur ein strategisches Problem, sondern berührt auch die Identität Europas als Bastion der Demokratie, des sozialen Wohlstands und der transnationalen Zusammenarbeit.
Angesichts dieser ideologischen Einmischung wird Europa sein Bekenntnis zu demokratischen Werten wahrscheinlich verstärken, auch wenn strategische Überlegungen den Kontinent dazu drängen, nach mehr Autonomie zu streben.
 |
| Obwohl eine vollständige Trennung zwischen den USA und Europa aufgrund der engen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bindungen unwahrscheinlich ist, könnte sich das Bündnis dennoch in Richtung eines Gleichgewichtszustands mit einem weniger abhängigen Europa bewegen. (Quelle: Voxeurop) |
Die langfristige Zukunft der transatlantischen Beziehungen bleibt ungewiss. Sollten künftige US-Regierungen ihre Politik anpassen und ihr Bekenntnis zu traditionellen Bündnissen bekräftigen, bleibt die Möglichkeit einer Versöhnung bestehen. Hält hingegen der Trend zu strategischem Rückzug und einseitigen Zwangsmaßnahmen an, werden sich die Beziehungen zwischen den USA und Europa allmählich in Richtung größerer Autonomie und geringerer gegenseitiger Abhängigkeit entwickeln. Die Nachhaltigkeit des Bündnisses hängt dabei von Europas Fähigkeit ab, sich an ein verändertes geopolitisches Umfeld anzupassen und gleichzeitig seine Grundwerte zu wahren.
Kurz gesagt: Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen befindet sich an einem kritischen Punkt. Die aktuellen Turbulenzen sind nicht nur auf politische Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen, sondern spiegeln auch einen tiefgreifenden strategischen Wandel wider. Wenn Washington weiterhin seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt, wird Europa gezwungen sein, einen unabhängigen Weg zu finden, auch wenn dieser mit Herausforderungen verbunden ist. Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen wird von der Anpassungsfähigkeit des „alten Kontinents“ und der Ausrichtung der Vereinigten Staaten abhängen – ob sie weiterhin zusammenarbeiten oder sich schrittweise voneinander entfernen.
(*) Dr. John Calabrese ist Dozent für Internationale Beziehungen an der American University in Washington, D.C. Er ist außerdem Herausgeber des Middle East Journal und Senior Fellow am Middle East Institute (MEI). Zuvor leitete Dr. Calabrese das Middle East-Asia Project (MAP) des MEI.
[Anzeige_2]
Quelle: https://baoquocte.vn/hieu-ung-tu-nuoc-my-tai-dinh-hinh-lien-minh-xuyen-dai-tay-duong-306215.html


























![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)















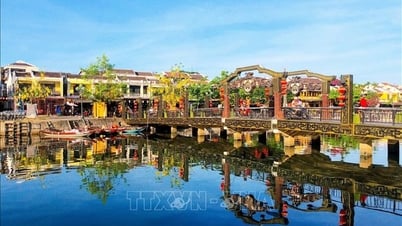



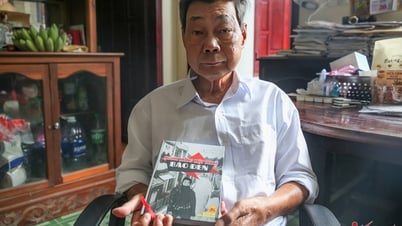





























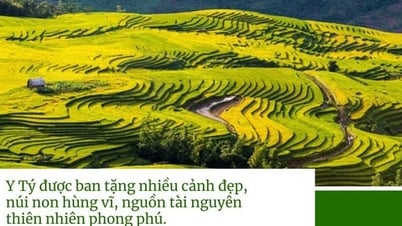
























Kommentar (0)