Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine: Vertrauen undpolitische Bedingungen behindern die Verhandlungen
Die Verhandlungsinitiative des russischen Präsidenten Putin und der erste Dialogkanal zwischen Russland und der Ukraine nach drei Jahren am 16. Mai in der Türkei werden von Analysten als eine der möglichen Möglichkeiten zur Beendigung des langwierigen Krieges angesehen. Angesichts der aktuellen Lage – der festgefahrenen Lage im Krieg, der zunehmenden Erschöpfung der Ressourcen aller Seiten und der Sorge, der Konflikt könne sich auf das übrige Europa ausweiten – ist jeder Friedensvorschlag eine ernsthafte Überlegung wert.
Aus Moskauer Sicht ist ein umfassender Friedensvertrag und nicht ein vorübergehender Waffenstillstand der einzige Weg, um einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten. Ein Waffenstillstand könnte zwar ein notwendiger Schritt sein, doch Russland argumentiert, dass er ohne eine klare politische Lösung lediglich zu einem „Einfrieren“ des Konflikts führen und eine fragile Ruhepause vor neuen Konfrontationsrunden schaffen werde.
Man kann erkennen, dass Moskau seine diplomatische Strategie im Rahmen der klassischen Außenpolitik gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf bilateralen oder multilateralen Verhandlungen liegt, die auf dem Prinzip der Anerkennung der aktuellen geopolitischen Realitäten beruhen. Aus russischer Sicht sind die größten Hindernisse für eine Wiederaufnahme des Dialogs die mangelnde Legitimität der Regierung in Kiew sowie die Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit der Ukraine, angesichts des Einflusses westlicher Mächte wirksam zu verhandeln.
Ein Argument, das Russland oft vorbringt, ist das Versagen des Westens, insbesondere Berlins und Paris, bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Moskau sagt, es habe gewisse Zugeständnisse für den Frieden gemacht, auch wenn diese Entscheidungen im Inland nicht leicht gefallen seien. Viele westliche Länder sind jedoch im Gegenteil der Ansicht, dass Russland seinen Verpflichtungen nicht vollständig nachgekommen sei, was zum Scheitern des Verhandlungsprozesses geführt habe.
Russland hat nun seine Verhandlungsbereitschaft im Rahmen der in Istanbul für 2022 erzielten Vereinbarungen bekräftigt. Dieser Fahrplan wurde laut Moskau von Kiew unter dem Druck seiner westlichen Partner aufgegeben. Bei allen neuen Verhandlungen, so das Argument, müssten die „Realitäten vor Ort“ berücksichtigt werden, also die Veränderungen in den Kontrollzonen und Machtstrukturen nach mehr als drei Jahren Konflikt. Allerdings bleibt die Durchführbarkeit dieses Ansatzes umstritten, da er einen Konsens seitens der Ukraine und ihrer westlichen Sponsoren erfordern würde, die weiterhin fest auf ihrer Haltung beharren, dass jedes Abkommen die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine respektieren müsse.
Das Ukraine-Problem und die Grenzen des strategischen Denkens Europas
Viele Meinungen besagen, dass die Ukraine-Krise eine tiefe Instabilität in der Sicherheits- und politischen Struktur Europas zeige und zugleich die verwirrte Mentalität eines Teils der politischen Elite der Region widerspiegele. Einige Länder hoffen offenbar noch immer auf eine mögliche „Rückkehr zur Normalität vor dem Krieg“, betrachten den Konflikt jedoch weiterhin durch die Brille der russischen Bedrohung. Doch selbst im Westen, insbesondere innerhalb der neuen US-Regierung, herrscht Skepsis gegenüber dem derzeitigen Ansatz und seiner langfristigen Wirksamkeit.
Von Moskauer Seite wird argumentiert, dass sowohl Kiew als auch seine westlichen Partner für das Scheitern der Gespräche im April 2022 verantwortlich seien – ein Wendepunkt, der den Konflikt in eine Eskalationsphase trieb. Wenn die Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen weiterhin scheitern, könnte es dieser Ansicht nach in jeder neuen Gesprächsrunde nicht mehr darum gehen, eine ausgewogene Einigung zu erzielen, sondern vielmehr darum, die von der siegreichen Seite durchgesetzten Bedingungen zu erfüllen.
Darüber hinaus werden die strategischen und wirtschaftlichen Kosten des Krieges nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die großen europäischen Volkswirtschaften immer deutlicher. Das Fehlen eines glaubwürdigen Friedensprozesses könnte für die Europäische Union und die NATO selbst zu einer „Belastung“ werden, da eine anhaltende Sanktionspolitik die Lieferketten schwächt, die Verteidigungskosten erhöht und innenpolitischen Druck erzeugt.
Darüber hinaus sind viele Fragen zum Inhalt der Wiederaufrüstungspolitik europäischer Mächte wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien noch immer unbeantwortet. Einerseits bekennen sie sich zur Unterstützung der Ukraine und zur Stärkung der Abschreckung, andererseits ist die öffentliche Meinung im Land vorsichtig, ja sogar skeptisch, was eine Verlagerung der Verteidigungspolitik von der „Konfliktverhütung“ hin zur „Akzeptanz einer langfristigen Konfrontation“ angeht.
Von US-Seite gibt es Anzeichen dafür, dass Washington eine Form der Sicherheitskooperation nach dem Vorbild des NATO-Russland-Rats wiederbeleben möchte, der in der Vergangenheit als strategischer Dialogkanal fungierte. Eine Rückkehr zum alten Modell ohne Anpassung an die neuen geopolitischen Realitäten dürfte jedoch nicht ausreichen, um die gegenwärtigen Spannungen abzubauen. Manche Beobachter fragen sich: Wiederholt der Westen alte Fehler, indem er zu viel in symbolische Sicherheitsstrukturen investiert, während ihm eine stabile gesellschaftspolitische Grundlage für deren Unterstützung fehlt?
Unabhängig vom Szenario des Russland-Ukraine-Konflikts steht Europa derzeit vor einer Reihe strategischer Herausforderungen, wie es sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr gegeben hat. Eines der größten Risiken besteht darin, dass es seitens der politischen Führung an klaren Vorgaben mangelt, was dazu geführt hat, dass viele Entscheidungen eher reaktiv als proaktiv getroffen wurden.
Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht auch die wachsende Kluft zwischen Eliten und einfachen Menschen in Europa. Angesichts steigender Militärausgaben, einer Belastung des Lebensstandards durch die Inflation und der zunehmenden Erwähnung einer „Kriegswirtschaft“ äußern Wähler in europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien ihre deutliche Skepsis gegenüber den aktuellen Strategien. Die sinkende Popularität von Politikern wie Emmanuel Macron, Friedrich Merz oder Keir Starmer zeigt, dass die Menschen zunehmend nicht mehr bereit sind, soziale Stabilität gegen geopolitische Prioritäten einzutauschen.
Es ist klar, dass die Prinzipien, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Stabilisierung Europas beigetragen haben – etwa Verteilungsgerechtigkeit, Sicherheitsgarantien und sozialer Konsens – durch den Druck der Wiederaufrüstung, der Verteidigungsausgaben und einer Vertrauenskrise in der Öffentlichkeit auf eine harte Probe gestellt werden. Die Frage ist: Können die europäischen Regierungen eine nachhaltige und realistische Sicherheitsstrategie entwickeln, die den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen ihrer eigenen Bürger nicht aufs Spiel setzt? Nur mit Zugeständnissen und dem Aufbau strategischen Vertrauens seitens Russlands, der Ukraine und der westlichen Länder wird sich die Tür zum Frieden in der Ukraine wirklich öffnen.
Hung Anh (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/hoa-binh-theo-dieu-kien-khi-ban-dam-phan-tro-thanh-chien-truong-ngoai-giao-249110.htm





![[Foto] Topspieler treffen sich bei der Nhan Dan Newspaper National Table Tennis Championship 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/23/9ad5f6f4faf146b08335e5c446edb107)


























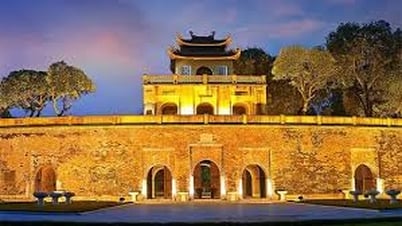






























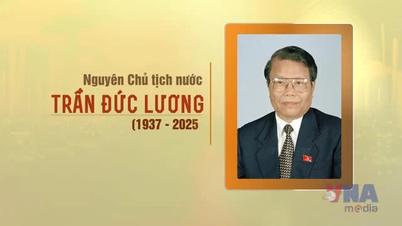










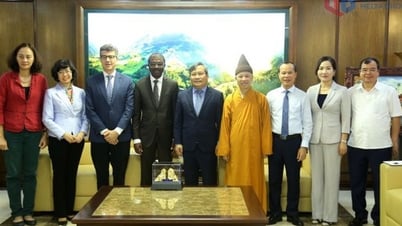














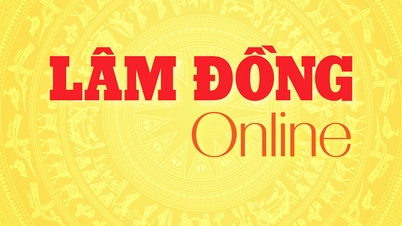








Kommentar (0)