
Le Quang Liem ist ein typisches Beispiel für asiatische Intelligenz am Schachbrett – Foto: FIDE
Asiaten dominieren zunehmend das Schachspiel.
Tatsächlich befinden sich, mit Ausnahme von Magnus Carlsen an der Spitze – einem Genie, das als Jahrhunderttalent im Schach gilt –, die meisten der 25 stärksten Spieler der Welt in den Händen von Asiaten oder Menschen asiatischer Herkunft.
Es gibt fünf Inder, drei Chinesen, zwei Usbeken und einen Vietnamesen. Und wenn wir den Begriff „Asiaten“ mit einbeziehen, wird die Liste noch länger.
Das ist Anish Giri – die Nummer 5 der Weltrangliste, mit indisch-japanischen Wurzeln – oder die Nummer 2 der Welt, Hikaru Nakamura – ein Amerikaner japanischer Abstammung. Ganz zu schweigen von den osteuropäischen Spielern zentralasiatischer Herkunft aus dem ehemaligen Ostblock.
Im Bereich der populären Sportarten dominieren die Westler dank fortschrittlicher Technologie und Wissenschaft sowie körperlicher Vorteile nahezu vollständig.
Schach – der intellektuelle Sport – bildet jedoch eine Ausnahme. Und im chinesischen Schach und Go dominieren die Asiaten natürlich noch stärker.
Insgesamt sind Asiaten im Schach besser als Westler. Und das ist ein interessantes Thema der Sportwissenschaft.
Moderne wissenschaftliche Forschungen legen nahe, dass eine plausiblere Erklärung eher in der Kognitionswissenschaft, dem kulturellen Umfeld und mentalen Sporttrainingsmodellen liegt als in genetischen Faktoren.
Neurowissenschaftler sagen, es gebe keine Beweise dafür, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe über ein bestimmtes Gen verfügt, das sie besser im Schach macht.
Eine in PLOS ONE veröffentlichte Studie (Autorengruppe Zhang, 2024) zeigt jedoch, dass kulturelle Unterschiede Unterschiede in der Gehirnstruktur prägen können.

Japanisch-amerikanischer Schachspieler Nakamura – Foto: FIDE
Diese Arbeit dokumentiert einen Zusammenhang zwischen der Betonung von Gedächtnis und Disziplin in ostasiatischen Kulturen und der Entwicklung des präfrontalen Cortex, eines Bereichs, der am Arbeitsgedächtnis und der Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Konzentration beteiligt ist.
Die Schlussfolgerung des Forschungsteams behauptet keine angeborene Überlegenheit, stellt aber fest, dass „langfristige kulturelle Erfahrungen die kognitive Funktion beeinflussen können“.
In östlichen Ländern liegt der Fokus auf formaler Bildung, die viel Auswendiglernen, Sorgfalt und Ordnung erfordert.
Dies sind sehr wichtige Fähigkeiten in intellektuellen Schachspielen, die Geduld, langfristiges Rechnen und intensive Konzentration über viele Stunden erfordern.
Kultur, die sich zum Schachspielen eignet
Ein anderer Ansatz stammt aus der Sportwissenschaft und der professionellen Psychologie. Seit den 1980er Jahren weist Professor Adriaan de Groot (Niederlande), der die Grundlagen für die Erforschung des Denkvermögens von Schachspielern legte, darauf hin, dass der Unterschied zwischen Großmeistern nicht in ihrem übermenschlichen Gedächtnis liegt, sondern in ihrer Fähigkeit, Muster zu erkennen.
Gute Spieler merken sich Positionen in „Einheiten“ basierend auf ihrer Erfahrung, was ihnen hilft, Informationen um ein Vielfaches schneller zu verarbeiten als der Durchschnittsmensch.
Das berühmte CHREST-Modell, das von Professor Gerard Gobet (Frankreich) und seinen Kollegen entwickelt wurde, untermauert diese Aussage weiterhin.
Die frühe Auseinandersetzung asiatischer Kinder mit dem Schachspiel und seiner hohen Wiederholungsdichte begünstigt die Ausbildung dichter Mustererkennungsnetzwerke – ein Faktor, der als „praktische Spezialität“ dieser Region betrachtet werden kann.
Parallel dazu spielt das ostasiatische Bildungssystem eine wichtige Rolle. Eine 2025 in Frontiers in Psychology veröffentlichte Studie analysierte die Unterschiede im Schachunterricht in Asien und Europa und stellte fest, dass Schach in vielen ostasiatischen Ländern stärker in den Schulunterricht integriert ist, unter Beteiligung von Lehrern und Eltern.
Das Forschungsteam stellte fest, dass „Schüler in ostasiatischen Ländern ein deutlich höheres Maß an sozialer Unterstützung und Übungshäufigkeit aufweisen“, was ein nachhaltiges Umfeld für die Entwicklung von Denk- und taktischen Fähigkeiten schafft.
Darüber hinaus achten Wissenschaftler auch auf den „Imitationseffekt“. Eine Studie von Egor Lappo und Marcus Feldman (Stanford University) aus dem Jahr 2023 zeigte, dass sich Schachstrategien in der Gemeinschaft tendenziell nach dem Modell „Erfolg erzeugt Nachahmung“ verbreiten: Spieler lernen in der Regel von Meistern, die in der Gesellschaft hohes Ansehen genießen.

Le Quang Liem (links) konfrontiert den Chinesen Dinh Lap Nhan – Fotoarchiv
In asiatischen Kulturen, in denen Schach als ein hoher intellektueller Wert angesehen wird, trägt dies zur Bildung dichterer Generationenfolge bei als in anderen Regionen.
Der Aspekt des professionellen Sporttrainings darf nicht außer Acht gelassen werden. In China, Japan oder Indien werden junge Spieler nach einem ähnlichen Modell wie Hochleistungssportler trainiert.
Zahlreiche sportwissenschaftliche Studien im Schach zeigen, dass Faktoren wie Ernährung, Stresstoleranz, Schlafqualität und kognitives Reflextraining systematisch angewendet werden.
Eine solide Trainingsbasis und eine hohe Teilnehmerzahl erhöhen die Wahrscheinlichkeit, herausragende Talente hervorzubringen. Dadurch wird die Generation asiatischer Spieler immer jünger und ihre Leistungen immer beeindruckender.
All dies führt zu einer wichtigen Schlussfolgerung: Asiaten sind nicht aufgrund ihrer Gene gut im Schach, sondern aufgrund des richtigen kulturellen Umfelds, des richtigen Trainingssystems und der Kognitionswissenschaft.
Schach ist ein Denksport, der langfristiges Lernen erfordert, und die ostasiatische Gesellschaft – mit ihrer Tradition der Förderung von akademischen Leistungen, Ausdauer, Disziplin und schulischen Erfolgen – schafft günstige Bedingungen dafür, dass Kinder früh damit in Berührung kommen und es weit bringen.
Quelle: https://tuoitre.vn/vi-sao-nguoi-chau-a-gioi-choi-co-20251116081650187.htm


![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh trifft sich mit Vertretern herausragender Lehrer](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)



![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt Vizepräsident der Luxshare-ICT-Gruppe (China)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)












![[Video] Vietnamesische Sportler vereinen sich, überwinden Schwierigkeiten und erreichen neue Höhen, um den 14. Nationalen Parteitag zu begrüßen.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/16/1763280150645_nganh-the-thao-9690-jpg.webp)












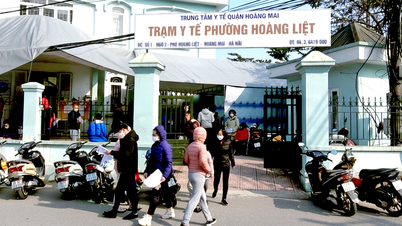















































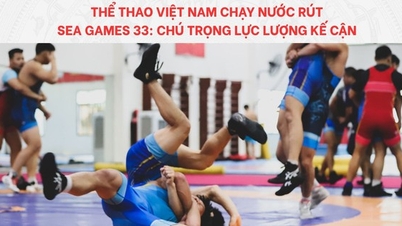


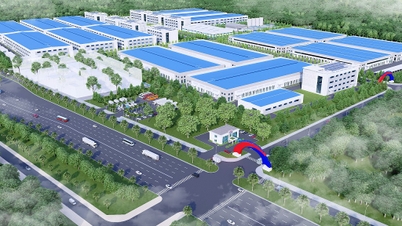
























Kommentar (0)