Am 12. März versprach Nate Franklin, Vorsitzender der US-amerikanischen Pacifico Energy (PE) Group, während eines Treffens und einer Arbeitssitzung mit Premierminister Pham Minh Chinh , die Investitionen von PE in die vietnamesische Energiebranche weiter auszuweiten. Dazu gehört auch ein mehrere Milliarden Dollar schwerer Investitionsplan für Offshore-Windkraft in Binh Thuan , der neue fortschrittliche Lösungen zur Gewährleistung der Energiesicherheit bringen soll.
Offshore-Windenergie hat sich zu einer der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen weltweit entwickelt, insbesondere in Ländern mit günstigen Windverhältnissen. Im Folgenden werden die Erfahrungen einiger führender Länder mit der Entwicklung der Offshore-Windenergie in diesem Bereich beschrieben.
Dänemark
Dänemark ist mit dem Start des Vindeby-Projekts – dem ersten Offshore-Windpark der Welt – im Jahr 1991 ein Pionier in der Offshore-Windenergie .
Ein wissenschaftlicher und transparenter Ausschreibungsmechanismus ist ein Highlight der dänischen Investitionspolitik im Bereich Offshore-Windenergie. Die dänische Regierung organisiert Ausschreibungen und stellt so die Auswahl der Investoren mit dem besten Preis sicher, ohne dabei die Projektqualität zu beeinträchtigen.
 |
| Vindeby (Dänemark) war der erste Offshore-Windpark der Welt, der 1991 gebaut wurde. Foto: Project Management Institute. |
Die Wirksamkeit der finanziellen Förderung und der Preismechanismen hat ein günstiges Umfeld für die Umsetzung von Offshore-Windkraftprojekten in Dänemark geschaffen. Bisher nutzte Dänemark den Einspeisetarif (FIT), um die Strompreise für Windkraftprojekte zu stützen. Aktuell nutzt das Land den Differenzvertrag (CfD), um stabile Gewinne für Investoren zu gewährleisten. Das schnelle Umweltgenehmigungs- und Lizenzierungssystem trägt dazu bei, Projekthürden abzubauen.
Dänemark baut mithilfe einer klaren Meeresraumplanung gezielt Offshore-Windkraftanlagen in bestimmten Regionen und vermeidet so Konflikte mit anderen Branchen wie Fischerei und Schifffahrt. Das von Dänemark aufgebaute Smart-Grid-System ermöglicht die Vernetzung mit Nachbarländern wie Deutschland, Norwegen und Schweden, um die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu optimieren. Das Land setzt das Projekt „Energy Islands“ um, bei dem künstliche Inseln in der Nordsee zu einem Zentrum für die Sammlung und Verteilung von Offshore-Windenergie werden.
Dänemark hat parallel zur Entwicklung der Offshore-Windenergie auch seine heimische Industrie und Lieferkette ausgebaut. Das nordische Land investiert massiv in Forschung und Entwicklung (F&E), was zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung von Windkraftanlagen beiträgt. Die Lieferkette für Windkraftanlagen ist gut entwickelt – von der Herstellung von Turbinen, Rotorblättern und Fundamenten bis hin zu Installation und Wartung. International ist Dänemark als Heimat von Vestas und Ørsted bekannt, zwei weltweit führenden Unternehmen der Windkraftbranche.
Bis 2023 wird Dänemarks Offshore-Windkapazität rund 2,3 GW erreichen. Bis 2030 ist ein Ausbau auf 12 GW geplant. Das Land strebt bis 2050 eine CO2-freie Wirtschaft an, in der Windenergie eine zentrale Rolle spielt.
Vereinigtes Königreich
Großbritannien war jahrelang das Land mit der weltweit größten Offshore-Windkraftkapazität, bevor es von China überholt wurde. Dank einer gut durchdachten Entwicklungsstrategie ist Großbritannien nicht nur eines der führenden Länder im Bereich der Offshore-Windkraft, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Förderung des globalen Marktes für erneuerbare Energien.
Die herausragende Offshore-Windenergiepolitik Großbritanniens ist das Differenzkontraktsystem (CfD). Dieses System sichert Investoren stabile Strompreise und schützt sie vor Marktpreisschwankungen. CfD-Auktionen haben dazu beigetragen, die Kosten für Offshore-Windenergie deutlich zu senken – von 140 £/MWh im Jahr 2015 auf unter 40 £/MWh im Jahr 2022.
 |
| Der britische Windpark Dogger Bank soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2026 mit einer Leistung von 3,6 GW der größte Offshore-Windpark der Welt sein. Foto: Doggerbank.com. |
Die britische Regierung verfügt über die Crown Estate, die Seerechte für Windkraftprojekte plant und vergibt. Der effiziente Betrieb verkürzt die Genehmigungsdauer und gewährleistet gleichzeitig die Vereinbarkeit mit maritimen Aktivitäten, der Fischerei und dem Umweltschutz.
Das britische Stromübertragungssystem ist gut ausgebaut und verfügt über ein zentral angeschlossenes Offshore-Netzsystem, das die Stromübertragung von Offshore-Windparks zum Festland optimiert.
Das Projekt North Sea Wind Power Hub wird untersucht, um das britische Stromnetz mit anderen europäischen Ländern zu verbinden.
Die britische Regierung verlangt für Offshore-Windkraftprojekte einen hohen Anteil lokaler Produktion. Hull hat sich zu einem Zentrum für die Herstellung von Rotorblättern für Siemens Gamesa entwickelt, während Häfen wie Teesside und Able Marine die Installation und Inbetriebnahme übernehmen.
Großbritannien ist derzeit Vorreiter bei der schwimmenden Windkrafttechnologie und ermöglicht die Entwicklung von Offshore-Windparks in tiefen Gewässern. Das ScotWind-Projekt mit einer Kapazität von über 20 GW wird Großbritannien zu einem globalen Zentrum für schwimmende Windkraft machen.
Bis 2023 wird Großbritannien über mehr als 14 GW Offshore-Windkapazität verfügen, was rund 30 % der weltweiten Offshore-Windkapazität entspricht. Bis 2030 strebt das Land 50 GW an, davon mindestens 5 GW schwimmende Windkraftanlagen.
China
Als das Land mit dem schnellsten Wachstum im Bereich der Offshore-Windenergie in den letzten Jahren hat China Großbritannien überholt und ist nun das Land mit der größten Offshore-Windenergiekapazität der Welt.
Der Vorzugspreismechanismus ist ein einzigartiges Merkmal der chinesischen Offshore-Windenergie-Entwicklungspolitik. Das Land mit einer Milliarde Einwohnern nutzt einen attraktiven Einspeisetarif (FIT), um Investitionen in Offshore-Windenergie zu fördern. Der FIT-Preis wird schrittweise gesenkt, um Unternehmen bei der Kosten- und Technologieoptimierung zu unterstützen. Darüber hinaus bieten staatliche Banken in China grüne Kreditpakete mit Vorzugszinsen an, um Unternehmen der Windenergiebranche zu unterstützen. Die Regierung fördert zudem öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), um Investitionskapital anzuziehen.
 |
| China ist das Land mit der weltweit größten Offshore-Windkraftkapazität. Foto: Dialogue Earth. |
Die Umsetzung einer klaren Meeresraumplanung hilft China, die Standorte von Windparks zu optimieren, ohne den Seeverkehr und die Fischerei zu beeinträchtigen. Investitionen in den Bau von Offshore-Hochspannungsnetzen tragen dazu bei, die Windenergie in das nationale Stromnetz zu integrieren. Darüber hinaus wurden Energiespeichersysteme entwickelt, um auch bei schwachem Wind eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Häfen wurden modernisiert, um die Installation und Wartung von Offshore-Windparks zu ermöglichen.
China verfügt über führende Unternehmen der Windkraftbranche wie Goldwind, MingYang, Envision und Shanghai Electric, was dazu beiträgt, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu verringern. China hat zudem die inländische Produktion von Fundamenten, Kabeln und Montagesystemen angekurbelt, was zu Kostensenkungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt. Chinesische Unternehmen exportieren Windturbinen und Windkrafttechnologie nach Südostasien, Europa und Lateinamerika. China testet schwimmende Windkraftanlagen mit dem Ziel, diese in Gebieten mit einer Wassertiefe von mehr als 50 Metern einzusetzen.
Bis 2023 wird Chinas gesamte Offshore-Windkapazität 30 GW übersteigen und damit fast 50 % der weltweiten Kapazität ausmachen. Bis 2030 wird China voraussichtlich eine Offshore-Windkapazität von 100 GW erreichen, um den Bedarf seiner riesigen Volkswirtschaft an erneuerbarer Energie zu decken.





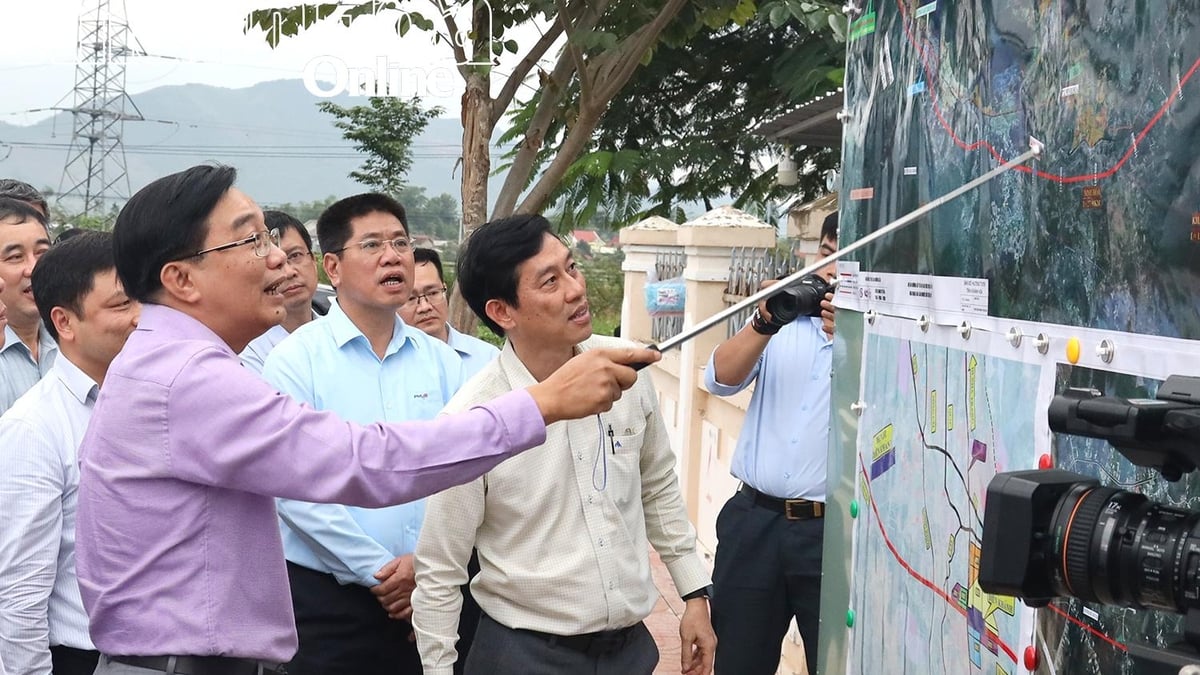


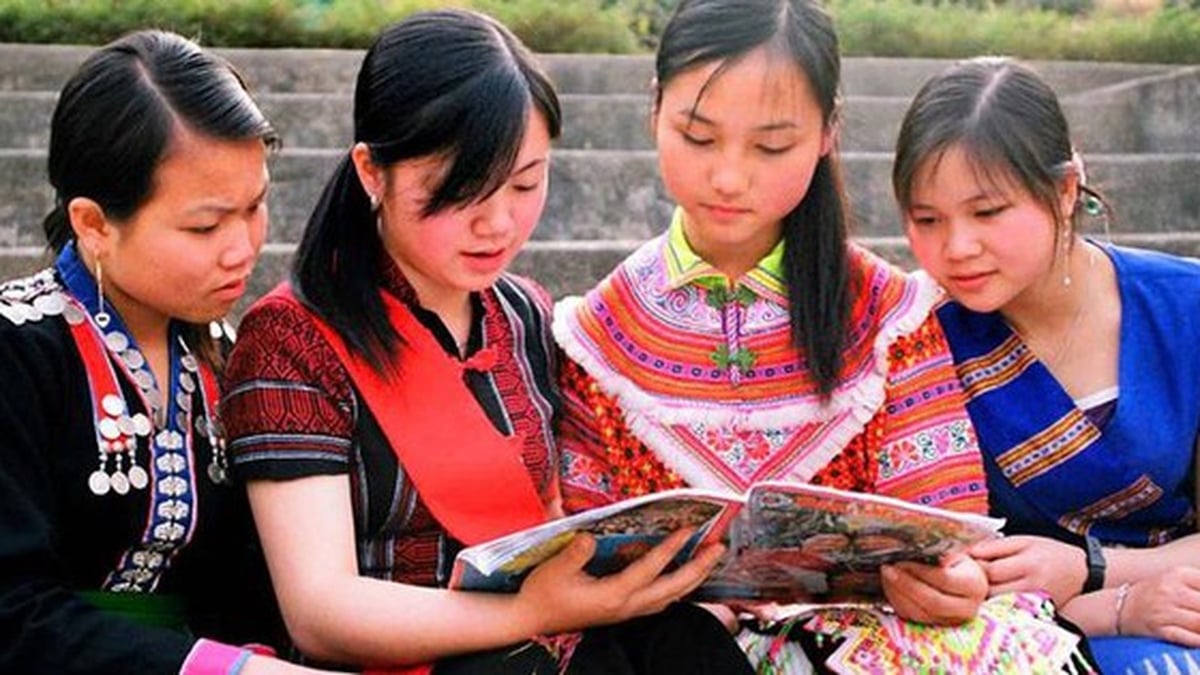


















![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)














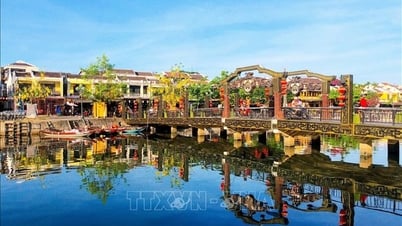



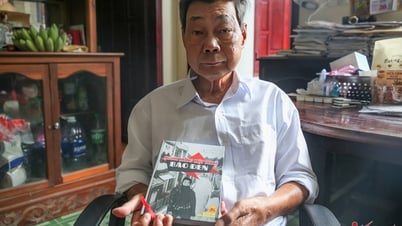





























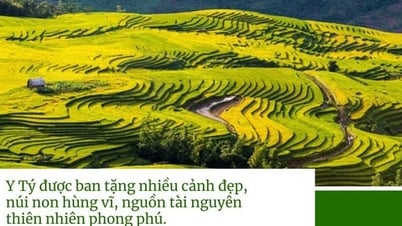
























Kommentar (0)