
Die Kandidatin Khanh Linh (Nguyen Thai Binh Gymnasium) und ihre Freundinnen besprachen die Englischprüfung nach der Wahlfachprüfung. Khanh Linh bemerkte, dass die Prüfung aufgrund ihrer langen Struktur und der vielen neuen Fachbegriffe relativ schwierig gewesen sei. – Foto: NGUYEN KHANG
Nach der Abiturprüfung 2025 hielt das Ministerium für Bildung und Ausbildung eine Pressekonferenz ab, um über die erfolgreichen Ergebnisse der Prüfung zu informieren und eine Bewertung der Prüfung abzugeben: „Die Prüfung wurde entwickelt, um Kompetenzen zu bewerten und integriert dabei viele verwandte Kenntnisse. Die Prüfung ist Teil des allgemeinen Bildungsprogramms und zeichnet sich durch eine gute Differenzierung aus.“
In Bildungsforen, sozialen Netzwerken und Zeitungen wurden jedoch zahlreiche Reaktionen auf die diesjährige Prüfung dokumentiert. Besonders in den Fächern Mathematik, Literatur und Englisch, die für viele durchschnittliche Gymnasiasten eine Überforderung darstellten.
Der Test entspricht nicht den Standards des allgemeinen Publikums?
Es ist unbestreitbar, dass die Abiturprüfung 2025 im Vergleich zu früher viele Verbesserungen aufweist, insbesondere die Ausrichtung auf eine eingehende Bewertung der allgemeinen Kompetenzen und der fachspezifischen Kompetenzen gemäß dem allgemeinen Bildungsprogramm 2018.
Die „Standardabweichung“ im Vergleich zum durchschnittlichen Gymnasiasten in den drei Fächern Mathematik, Literatur und Englisch ist jedoch hoch. Die Hauptgründe hierfür sind:
Erstens ist die Prüfung hinsichtlich der Bewertungsniveaus unausgewogen. Fächer, die die meisten Kandidaten als schwierig empfinden, weisen eine Tendenz zu Anwendungsfragen (schwierige Fragen) auf, während Fragen auf dem Niveau des Erkennens und Verstehens (einfache und mittelschwere Fragen) fehlen.
Dies erschwert es durchschnittlichen Schülern, eine Grundlage für den Test zu schaffen. Diese Art der Testgestaltung eignet sich eher für das Ziel der Hochschulzulassung als für das Ziel der Leistungsbewertung im Rahmen des Schulabschlusses.
Zweitens sind Sprache, Inhalt und Fragestellung der Testfragen bei längeren, komplexen und teils technischen Texten wenig benutzerfreundlich, da die Fragen oft zirkulär und abstrakt formuliert sind. Die Bearbeitung der Fragen wird dadurch zu einer Herausforderung für das Leseverständnis und prüft nicht mehr nur das erworbene Wissen, sondern vor allem die im Lernprozess entwickelten Fähigkeiten der Schüler.
Drittens wird bei der Erstellung der Prüfungsfragen die Methode der Fragengenerierung aus der Matrix so angewendet, dass sie dem Sinn und Zweck der Prüfungsmatrix widerspricht. Die Matrix soll eigentlich die Struktur der Prüfung vorgeben, doch die Software generiert die Fragen zufällig, ohne ihnen detaillierte Spezifikationen zuzuordnen. Dies führt zu Prüfungsfragen, die hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades unausgewogen und inhaltlich unausgewogen sind.
Insbesondere basiert die Prüfung nach wie vor hauptsächlich auf der traditionellen Methode und der Erfahrung des Expertenteams, ohne auf einen standardisierten Fragenpool zurückzugreifen. Es fehlen Standarddaten zu Schwierigkeitsgrad und Trennschärfe der Fragen sowie groß angelegte Tests, wodurch die Prüfung subjektiv und fachübergreifend inkonsistent ausfällt.
Mangelnde Synchronisierung zwischen dem Lernkontext und der Lehrpraxis

Die diesjährige Abschlussprüfung stößt auf geteilte Meinungen. Im Bild: Kandidaten bei der Abiturprüfung 2025 in Ho-Chi-Minh-Stadt – Foto: Thanh Hiep
Eine tiefgreifende, aber sehr wichtige Ursache ist die fehlende Synchronisierung zwischen dem tatsächlichen Kontext der Schüler und der Art und Weise, wie Lehre und Leistungsbeurteilung organisiert sind.
Der Jahrgang 2025 ist der erste, der dem allgemeinen Bildungsprogramm von 2018 folgt und gleichzeitig die Gruppe, die in den Klassenstufen 9 und 10 – zwei prägenden Jahren – am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffen war. Der anhaltende Online-Unterricht hat die Qualität des Wissenserwerbs, die Kompetenzen und die Lernpsychologie erheblich beeinträchtigt.
Das neue Programm fordert zwar die Entwicklung von Denk- und Problemlösungsfähigkeiten, doch in vielen Regionen konzentrieren sich die Lehrmethoden weiterhin auf das Üben von Aufgaben, das Auswendiglernen und Wiederholen. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht ausreichend in integrierten Prüfungsstrategien, dem Umgang mit offenen Fragestellungen, der Datenanalyse und der Argumentationsführung geschult.
Bei Prüfungen, die auf die Feststellung von Kompetenzen abzielen, verfallen die Schüler in einen passiven Zustand, verlieren die Orientierung und verfügen nicht über genügend akademische Mittel, um die Prüfung zu bestehen.

Die Schüler der Nguyen Van Troi High School (Stadt Nha Trang) diskutierten angeregt nach der Mathematikprüfung – Foto: TRAN HOAI
Im Sinne des allgemeinen Bildungsprogramms von 2018 dienen Lehrbücher dazu, „Anforderungen“ festzulegen – also die Mindestkompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten, die Studierende nach einer bestimmten Studienzeit beherrschen müssen.
Grundsätzlich sollte die Abschlussprüfung auf diesen Anforderungen basieren, um eine einheitliche und angemessene Bewertung zu gewährleisten. Tatsächlich enthält die Prüfung von 2025 – insbesondere in den drei oben genannten Fächern – viele Fragen, die über den Umfang und das Niveau der Darstellung in den Lehrbüchern hinausgehen.
Komplexe Fragestellungen, eine ungewohnte Sprache und hohe Anwendungsanforderungen treten häufig auf und machen es den Studierenden unmöglich, sich im Lernstoff zurechtzufinden, selbst wenn sie die Lehrbücher systematisch und aktiv studiert haben. Die Kluft zwischen Lehrbuchinhalt und Prüfungsfragen lässt sich mit folgendem Vergleich veranschaulichen: „Ein Himmel, ein Abgrund“.
Die Diskrepanz zwischen Lehre, Lernen und Prüfung führt nicht nur zu passivem Lernen, sondern beeinträchtigt auch ein grundlegendes Prinzip der Allgemeinbildung: die Entwicklung der Fähigkeit zum Selbststudium. Wenn Lehrbücher keine verlässliche Grundlage für das Selbststudium bieten, sind Schüler gezwungen, sich auf Übungstests, zusätzlichen Unterricht oder intuitives Auswendiglernen zu verlassen.
Dies desorientiert, zerstört das Selbstvertrauen und die Lernmotivation – und untergräbt damit das im Programm von 2018 vorgesehene Ziel des Selbststudiums. Dies hat zur Folge, dass die Motivation und Fähigkeit der Schüler zum Selbststudium verloren gehen.
Wenn Prüfungen nicht mehr der universelle Standard sind
Eine Abschlussprüfung mit zu schwierigen Fragen führt nicht nur zu schlechten Noten, sondern hat schwerwiegende Folgen auf vielen Ebenen.
Zunächst einmal verlieren Studierende die Orientierung und Motivation zum Lernen, insbesondere diejenigen, die keine universitäre Ausrichtung haben und lediglich einen Abschluss benötigen, um ins Berufsleben einzusteigen oder einen Beruf zu erlernen. Für sie ist eine schwierige Prüfung keine positive Herausforderung, sondern ein Ausschlusskriterium.
Schulen und Lehrer geraten in eine schwierige Lage, wenn die Ergebnisse den Lehr- und Lernprozess nicht genau widerspiegeln. Dies führt leicht zu Skepsis und Enttäuschung und kann sogar diejenigen entmutigen, die versuchen, innovative Methoden einzuführen.
Die Gesellschaft kann leicht das Vertrauen in die vom Bildungsministerium festgelegten Prüfungen verlieren – die eines der Instrumente zur Gewährleistung von Fairness, Standardisierung und Ausrichtung der Bildung darstellen. Wenn die Prüfung nicht mehr das tatsächliche Leistungsspektrum misst, sondern zu einer Art „Rekrutierung der Besten“ wird, wird die Philosophie der Allgemeinbildung für die Mehrheit ins Gegenteil verkehrt.
Es ist notwendig, den Standard und die Universalität der Prüfung wiederherzustellen.
Die Abiturprüfung muss nicht nur hinsichtlich der Testmethoden, sondern auch der zugrundeliegenden Philosophie angepasst werden. Um Fairness und eine angemessene Ausrichtung zu gewährleisten, ist es notwendig, einen standardisierten Fragenpool zu erstellen, den Prozess der Fragengenerierung anhand der Vorgaben streng zu kontrollieren und insbesondere die Teststruktur an das durchschnittliche Niveau von Abiturientinnen und -schülern anzupassen.
Gleichzeitig muss eine Abstimmung zwischen Programm, Lehre und Bewertung erfolgen. Wenn die Prüfung die Entwicklung von Kompetenzen erfordert, müssen die Studierenden lernen, diese Kompetenzen zu beherrschen, und nicht nur auswendig zu lernen und Tricks anzuwenden.
Quelle: https://tuoitre.vn/de-thi-tot-nghiep-thpt-nen-dong-bo-giua-chuong-trinh-day-hoc-danh-gia-20250628115524719.htm










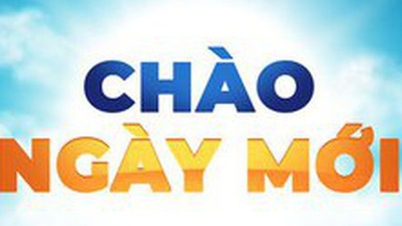













































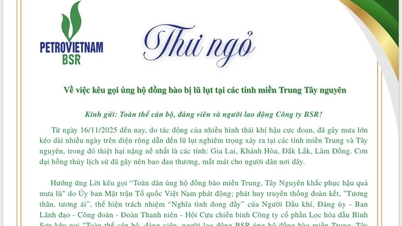















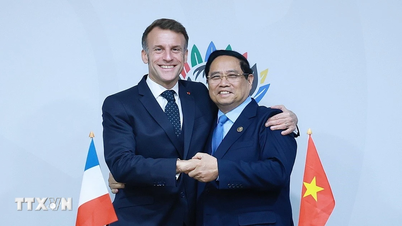































Kommentar (0)