
Durian in den westlichen Provinzen - Foto: MAU TRUONG
In den letzten Jahren hat die Landwirtschaft wichtige Fortschritte bei der Anbindung der Produktion an den Markt gemacht. Viele Landwirte sind jedoch immer noch nicht ausreichend informiert und richten ihre Produktion nach vorübergehenden Preissignalen. Bei einem Marktrückgang erleiden die Landwirte erhebliche Verluste.
Die Frage bleibt: „Was soll dieses Jahr gepflanzt und was angebaut werden?“
„Was soll dieses Jahr gepflanzt und angebaut werden?“, fragen sich viele Bauern. Die meisten setzen immer noch auf ihre Reisfelder, Gärten und Fischteiche. Sie hören auf Preisinformationen von Händlern, Bekannten oder aus sozialen Netzwerken und entscheiden dann nach Gefühl, was sie produzieren.
Wenn Durian, Kaffee, Drachenfrucht, Orangen, Zuckerrohr oder Tra-Fisch gute Preise erzielen, beeilen sich die Menschen, diese Früchte anzubauen und zu züchten. Wenn sich der Markt erholt, reduzieren sie die Ernte, „hängen die Teiche auf“ und geben die Felder auf.
Der Teufelskreis „Pflanzen – Schneiden – Aufziehen – Aufhängen“ ist nicht beendet, obwohl in der Agrarbranche viel über grüne Transformation, Rohstoffflächen, Anbaugebietscodes oder Rückverfolgbarkeit gesprochen wird.
Die Provinz Hau Giang (heute Teil von Can Tho) hatte mit über 15.000 Hektar das größte Zuckerrohranbaugebiet des Landes, heute sind nur noch wenige Hektar übrig.
Die „Welshauptstadt“ exportierte einst Garnelen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, doch in einem Jahr fiel der Preis, was viele Züchter dazu veranlasste, ihre Teiche aufzugeben. Der „Traum, Garnelen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zu exportieren“ ist immer noch ein Traum.
Der Grund dafür liegt darin, dass die Landwirte nur langsam und fragmentarisch über Marktinformationen informiert werden.
In Wirklichkeit fehlt es den Landwirten an Informationen und Fähigkeiten, den Markt zu analysieren. Die meisten von ihnen stützen sich bei ihrer Produktion immer noch auf Erfahrungen und Hörensagen, nicht auf Daten oder Prognosen. Sie produzieren zwar viele Produkte, wissen aber nicht, wer sie kauft, wo und zu welchem Preis. Wenn die Preise fallen, sind es oft die Landwirte, die darunter leiden.
Gleichzeitig sind Planung und Prognosen noch immer starr und anpassungsfähig. Viele Pläne basieren noch immer auf Fläche und Produktion, ohne eng mit dem Verbrauch verknüpft zu sein. Steigen die Preise, erweitern die Bauern ihre Anbauflächen überstürzt und übertreffen damit die Planung. Sinken die Preise, geben sie ihre Anbauflächen auf. Die Anbauflächen für Durian, Orangen und Wels haben sich rasant vergrößert und übertreffen die Planungen bis 2030, während die Infrastruktur für Konservierung und Verarbeitung nicht rechtzeitig ausgebaut wurde.
Paradoxerweise werden viele Pläne einfach erstellt und liegen gelassen, ohne dass es einen Mechanismus zur Überwachung und flexiblen Anpassung gibt. Verändert sich der Markt, ändert sich der Plan nicht, und die Landwirte wissen nicht, was der Plan beinhaltet, wo er sich befindet und wann er wirksam wird.
Die Realität zeigt auch, dass die Wertschöpfungskette noch immer lückenhaft ist. Der Landwirt, das erste Glied in der Kette, ist nach wie vor das schwächste Glied. In der Pangasius-Industrie profitieren die Landwirte nur von etwa 10 bis 20 Prozent der Wertschöpfung, während 70 Prozent der Kosten auf Futtermittel und Tierarzneimittel entfallen, die größtenteils von ausländischen Unternehmen getragen werden. Bei guten Preisen profitieren die Landwirte kaum; bei fallenden Preisen tragen sie die gesamten Verluste.
Viele Verbandsmodelle wurden gegründet und zerfielen dann aufgrund fehlender verbindlicher Mechanismen und mangelnder Teilhabe an Nutzen und Risiken. Die „Krankheit“ des Überangebots ist seit vielen Jahren bekannt, doch die „Heilung“ ist noch immer unzureichend. Wir müssen den Ansatz ändern, von „was anbauen, was anbauen“ hin zu „produzieren, was der Markt braucht und Gewinn zu erzielen“.
Die Informationen, die die Landwirte erreichen, sollten wie tägliche Wettervorhersagen sein.
Es ist an der Zeit, eine „Informationstransformation“ in der Landwirtschaft einzuleiten, bei der Landwirte nicht länger raten können, sondern Entscheidungen auf der Grundlage realer Daten und realer Märkte treffen können.
Zunächst einmal brauchen wir ein transparentes und zugängliches Agrarinformationssystem. Regierung, Verbände und Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um digitale Karten der Rohstoffanbaugebiete, Preise, Jahreszeiten und Marktnachfrage zu erstellen. Die Informationen müssen regelmäßig aktualisiert und – wie tägliche Wettervorhersagen – über Smartphones, Apps und lokale Radiosender verbreitet werden.
Als nächstes müssen wir die „digitale Kompetenz“ der Landwirte verbessern. Die landwirtschaftliche Beratung darf sich nicht nur auf landwirtschaftliche Techniken beschränken, sondern muss den Menschen auch beibringen, wie sie Daten lesen, elektronische Verträge abschließen, auf E-Commerce-Plattformen verkaufen und die Herkunft ihrer eigenen Produkte zurückverfolgen können.
Wenn die Landwirte über die Informationen verfügen, können sie sich nicht mehr von Händlern oder Gerüchten leiten lassen.
Die Agrarplanung muss digitalisiert und flexibler gestaltet werden. Statt die Anbaufläche starr zu regulieren, sollten Rohstoffanbaugebiete mit Verarbeitungsanlagen verknüpft, die Produktion mit dem Verbrauch verknüpft und ein flexibler Anpassungsmechanismus bei Marktschwankungen geschaffen werden.
Ein gutes Beispiel hierfür ist das 1 Million Hektar große, qualitativ hochwertige und emissionsarme Reisfeldmodell im Rahmen des grünen Wachstums, das derzeit im Mekong-Delta umgesetzt wird. Dort können die Bauern nicht nur Reis, sondern auch Emissionszertifikate verkaufen, den Agrartourismus entwickeln und auf demselben Feld neue Werte schaffen.
Die Verknüpfungen der Wertschöpfungsketten müssen substanziell sein. Genossenschaften und Genossenschaftsverbände müssen gestärkt werden und die Fähigkeit besitzen, zu verhandeln, Verträge abzuschließen und Gewinne und Risiken zu teilen. Es muss einen Mechanismus geben, der Banken, Unternehmen und Landwirte an einen Tisch bringt, damit nicht jede Seite in eine andere Richtung geht.
Wenn Landwirte durch Technologie gestärkt und zu Unternehmern werden, sind sie nicht länger bloße Angestellte des Marktes, sondern werden zu echten Subjekten der Agrarwirtschaft. Sie können Gewinne und Verluste berechnen, Preise prognostizieren, den Verkaufszeitpunkt wählen, Exporte verknüpfen und die Früchte ihrer Arbeit nicht durch Zufall, sondern durch Verträge und rechtliche Mittel schützen.
Um eine nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen, müssen wir den Landwirten zunächst dabei helfen, den Markt besser zu verstehen. Wenn die Informationen transparent, die Planung flexibel und die Vernetzung sowie die Technologie für die Landwirte greifbar sind, ist die Ernte kein Glücksspiel mehr.
Nur Landwirte, die den Markt verstehen, wissen, wie man Daten nutzt und langfristig denkt, können auf eine moderne Landwirtschaft hoffen und selbstbewusst in die Welt hinausgehen.
Quelle: https://tuoitre.vn/dua-thong-tin-den-nong-dan-phai-cap-nhat-thuong-xuyen-nhu-du-bao-thoi-tiet-2025102210220403.htm



![[Foto] Preisverleihung des politischen Wettbewerbs zum Schutz der ideologischen Grundlagen der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761151665557_giaia-jpg.webp)
![[Foto] Da Nang: Schockkräfte schützen Leben und Eigentum der Menschen vor Naturkatastrophen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761145662726_ndo_tr_z7144555003331-7912dd3d47479764c3df11043a705f22-3095-jpg.webp)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet Sitzung zum Bau von Kernkraftwerken](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761137852450_dsc-9299-jpg.webp)














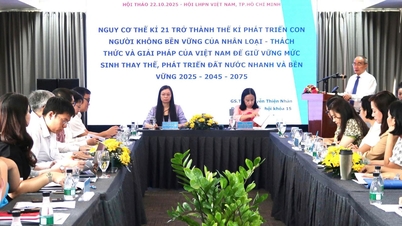













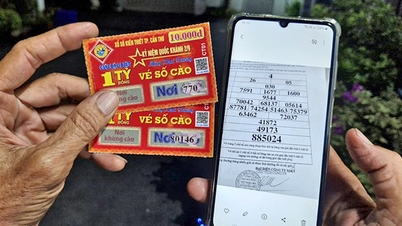























































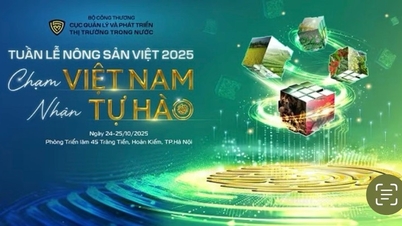










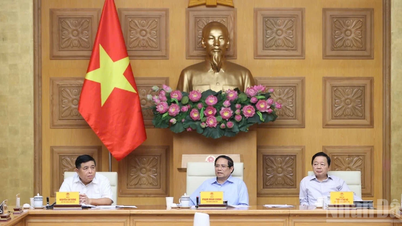






Kommentar (0)