 |
| Strategischer Wettbewerb: Der Westen setzt schwere Waffen ein, um seine „autarke“ Wirtschaft zu stärken. Ist Asien in Gefahr? (Quelle: Shutterstock) |
Seit langem gibt es Kritik an Chinas Produktionsstärke. Obwohl Asiens größte Volkswirtschaft weiterhin weltweit exportiert, wird immer wieder behauptet, steigende Arbeitskosten würden Pekings Wettbewerbsfähigkeit schwächen, während tiefe strukturelle Einschränkungen das nordostasiatische Land daran hindern würden, in fortschrittlichere Industrien vorzudringen.
Vertreter dieser Ansicht argumentieren oft, dass sich die Dominanz des Landes im verarbeitenden Gewerbe irgendwann umkehren werde – es sei nur eine Frage der Zeit.
Chinas Erfolg?
Der Experte William Bratton, Autor von „Chinas Aufstieg, Asiens Niedergang“ und ehemaliger Chefökonom und Leiter der Asien- Pazifik -Aktienanalyse der HSBC Bank, teilt diese Ansicht nicht und kommentierte in einem Analyseartikel auf asia.nikkei.com : „Das Merkwürdige ist, dass diese Argumente immer noch recht beliebt sind. Tatsächlich sind die Inputkosten trotz der Vorhersagen, Chinas Wettbewerbsfähigkeit habe abgenommen, viel höher … Gleichzeitig hat das Land in vielen fortschrittlichen Bereichen eine führende Position eingenommen.“
Das Problem besteht nun darin, dass es offenbar immer mehr empirische Belege für die Wettbewerbsstrategie Chinas und ihre Nachhaltigkeit gibt, was sich in der interventionistischen Industriepolitik zeigt, die in den Volkswirtschaften der USA und der Europäischen Union (EU) umgesetzt wird.
Besonders bemerkenswert sind die Gesetze zum Schutz der amerikanischen Industrieentwicklung. Die Regierung Joe Bidens betonte am schärfsten die Notwendigkeit, die technologische Führungsrolle, insbesondere in fortschrittlichen Bereichen, zu behaupten und amerikanischen Arbeitsplätzen Priorität einzuräumen. In vielerlei Hinsicht, so Experte William Bratton, „erscheint dieser Trend eher trumpistisch als der des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.“
Anders als die „America First“-Doktrin des ehemaligen Präsidenten Trump könnten Präsident Bidens Bemühungen zur Wiederherstellung der US-Produktion jedoch langfristig erfolgreich sein, da die Regierung sich verpflichtet, sie zu unterstützen. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass dieser ideologische Wandel angesichts der parteiübergreifenden Unterstützung so schnell rückgängig gemacht werden kann.
Die Gesetzgebung zur Stärkung der US-amerikanischen Fertigungsindustrie hat in ganz Europa Besorgnis ausgelöst, insbesondere da die Sorgen über den transatlantischen Technologie- und Fertigungswandel Realität geworden sind und europäische Unternehmen tendenziell Investitionen in den USA priorisieren, um im Land der Stars and Stripes Zugang zu großzügigen Subventionen zu erhalten.
Als Reaktion darauf versucht die EU jedoch auch, den US-Ansatz zu „imitieren“. Der Net-Zero Industry Act soll sicherstellen, dass bis 2030 mindestens 40 Prozent des Bedarfs der EU an strategischen Netto-Null-Technologien gedeckt werden.
Der Block möchte seine Industrien auch durch den CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) schützen – ein politisches Instrument, das auf alle in den EU-Markt importierten Waren eine CO2-Steuer erhebt, die auf der Intensität der Treibhausgasemissionen ihrer Produktion im Exportland basiert. Der CBAM würde somit allen europäischen Handelspartnern eine CO2-Steuer auferlegen.
Begründet wurden diese Maßnahmen mit dem gemeinsamen Wunsch der drei Weltwirtschaftsmächte, die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Produzenten zu steigern, den Besitz an Schlüsseltechnologien zu sichern und die heimische Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen. Leider ist keines dieser Ziele für das internationale Handelssystem von Vorteil.
Was ist mit dem Rest der Welt?
China, die USA und die EU müssen möglicherweise klarstellen, wer für sie verantwortlich ist: Sie neigen dazu, die Grundprinzipien offener Märkte und des freien Handels zu untergraben. Ihr klarer Fokus liegt auf der nationalen „Autarkie“ und sie sind bereit, protektionistischere Maßnahmen zu ergreifen. Dabei werden sie ohne Rücksicht auf die Folgen für ihre Handelspartner, auch in Asien, umgesetzt.
Grundsätzlich hängt die Wettbewerbsfähigkeit im verarbeitenden Gewerbe maßgeblich von der Größe ab – diese verstärkt die relative Kosteneffizienz und bestimmt die für Innovationen verfügbaren Ressourcen sowie die Fähigkeit zur Förderung einer stärkeren Spezialisierung. Fehlende inländische Größenvorteile können durch ein klassisches exportorientiertes Entwicklungsmodell kompensiert werden – wie die asiatischen Tigerstaaten erfolgreich vorgemacht haben.
Doch wenn die drei wirtschaftlichen Supermächte – die für 60 Prozent des globalen BIP und 54 Prozent der Importe verantwortlich sind – für ihre Geschäftstätigkeit „geschlossen“ sind – was bedeutet, dass der effektive Marktzugang der verbleibenden Volkswirtschaften erheblich eingeschränkt ist –, dann wäre es naiv anzunehmen, dass der Rest der Welt davon nicht betroffen sei.
Derzeit sind die asiatischen Volkswirtschaften, die sich in einem ähnlichen Stadium der industriellen Entwicklung befinden und ähnliche Industrien entwickeln, am stärksten von diesem protektionistischen Trend bedroht, darunter Japan, Südkorea und Taiwan (China). Keine dieser Volkswirtschaften verfügt über die finanzielle Schlagkraft, um mit den finanziellen Ressourcen der drei Wirtschaftssupermächte mithalten zu können.
Doch selbst weniger entwickelte Volkswirtschaften könnten in ihren Bemühungen, ihre Produktionskapazitäten auszubauen, behindert werden, da protektionistische Stimmungen den Zugang zu westlichen und chinesischen Märkten zunehmend einschränken. Die anhaltende Konzentration der globalen Produktion in China, Europa und den USA könnte langfristige wirtschaftliche und politische Folgen haben.
Der Zusammenhang zwischen dynamischen und wettbewerbsfähigen Fertigungssektoren und Wirtschaftswachstum sowie Wohlstand wird oft übersehen. Tatsächlich ist die Fertigung jedoch oft eine notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige und eigenständige Entwicklung. Am deutlichsten zeigt sich dies in Ländern, die wirtschaftliche Entwicklung anstreben.
Tatsächlich sind die negativen Folgen der Deindustrialisierung gut dokumentiert: sinkende Produktivität, stagnierende Einkommen, zunehmende Ungleichheit und verringerte Innovationsfähigkeit. Hinzu kommen die geopolitischen Risiken.
Erstens führt der Verlust der Produktionskapazitäten zu technologischer Abhängigkeit und damit zu politischem Einfluss. Länder werden zu unerwünschten technologischen Entscheidungen gezwungen, aus denen sie später nur schwer wieder aussteigen können, und haben keinen Zugang mehr zu großen Teilen der Weltwirtschaft.
Das zweite Risiko besteht darin, dass die geopolitische Bedeutung eines Landes maßgeblich von seiner Beteiligung an globalen Lieferketten abhängt. Seine Bedeutung wird also zwangsläufig abnehmen, wenn seine Rolle schrumpft.
Wenn die USA beispielsweise Erfolg haben und über ein mit Südkorea vergleichbares Potenzial im Halbleiterbereich verfügen, ist es dann realistisch anzunehmen, dass sie ein zuverlässiger Sicherheitspartner bleiben werden? – Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten, denn schließlich hat das Engagement der USA im Nahen Osten abgenommen, da die Bedeutung der Region als Energielieferant nachgelassen hat.
Eine ähnliche Dynamik ist anzunehmen, wenn die USA und die EU andere strategische Industrien in ihre Heimatländer „repatriieren“.
Asiatische Hersteller stehen aufgrund der extremen Wettbewerbsfähigkeit Chinas bereits vor einer Krise. Doch die neuen Strategien der EU und der USA lassen kaum darauf schließen, dass man ihnen als „Freunde in der Not“ vertrauen kann.
Stattdessen gerät das internationale Handelssystem zunehmend unter Druck. Der Protektionismus wird mit geopolitischen Gründen gerechtfertigt, während traditionelle Handelspartner wie Japan und Südkorea lediglich die unvermeidlichen „Opfer“ in einem andauernden Kampf der Wirtschaftsmächte sind.
Eine Möglichkeit, den Einfluss der Wirtschaftssupermächte zu umgehen, besteht jedoch darin, Freihandelsabkommen zu stärken, die die drei großen Volkswirtschaften ausschließen. So soll sichergestellt werden, dass die priorisierten internationalen Partnerschaften sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch ausgewogener sind. Das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) soll diesem Anspruch gerecht werden.
.
[Anzeige_2]
Quelle
































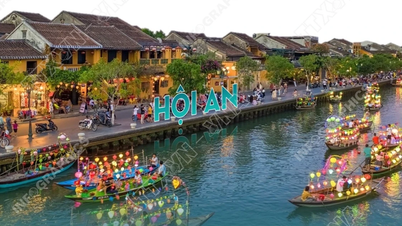


















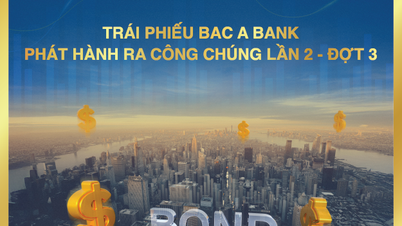









































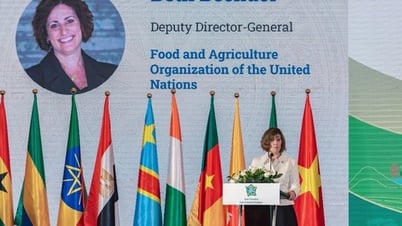







Kommentar (0)