
Landgrenzen gelten oft als dauerhaft festgelegte Linien – doch in Gebirgsregionen wie den Alpen, wo schmelzendes Eis und Permafrost die Landschaft verändern, sind die lokalen Regierungen manchmal gezwungen, Karten neu zu zeichnen.
An der schweizerisch-italienischen Grenze, direkt oberhalb des Theodulgletschers, der die Bewohner zumindest vorerst in einem gemeinsamen wirtschaftlichen Umfeld verbindet, florieren zwei Gemeinden rund um das ikonische Matterhorn dank eines stetigen Stroms von Touristen, die die wunderschönen Landschaften der Region besuchen und auf den ganzjährig schneebedeckten Hochhängen Ski fahren.
Dies trotz des Abschmelzens der Gletscher, das die Landschaft verändert hat und die lokalen Behörden gezwungen hat, die Grenze zwischen den beiden Ländern neu zu definieren.
„Der Gletscher hat sich auf der italienischen Seite zurückgezogen. An manchen Stellen ist nur noch blanker Boden zu sehen“, sagte Jérôme Perruquet, ein Bergführer aus dem Aostatal. Das Ausmaß des Gletscherrückgangs auf der Iltay-Seite mache Reparaturarbeiten notwendig, die voraussichtlich bald beginnen würden, fügte er hinzu.
„Die Schweizer Seite wird die Führung übernehmen, obwohl der größte Teil des Problems auf italienischem Territorium liegt, aber sie haben große wirtschaftliche Interessen“, sagte Herr Perruquet.
Da die Interessen beider Länder übereinstimmen, verlaufen die Verhandlungen reibungslos. Die bereits mit Baggern durchgeführten Maßnahmen zielen darauf ab, den Skibetrieb rund um den Theodul-Gletscher aufrechtzuerhalten. „Wir alle profitieren davon“, sagte ein einheimischer Bergführer, auch wenn der Gletscher dadurch „etwas Schaden nimmt“.
Die Kommission für die Aufrechterhaltung der nationalen Grenze zwischen der Schweiz und Italien tagte vom 9. bis 11. Mai dieses Jahres in Bern zu ihrer regulären Sitzung. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Anpassung der Grenze in der Region Testa Grigia/Plateau Rosa, und es wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen, wie das Bundesamt für Geodäsie (Swisstopo) mitteilte.
Swisstopo erklärte, dass die Genehmigungsverfahren für das Abkommen „derzeit sowohl in der Schweiz als auch in Italien laufen“, wisse aber nicht, wann das Abkommen verkündet oder die endgültige politische Bestätigung erteilt werde.
In den europäischen Alpenregionen verlaufen politische Grenzen häufig entlang von Gebirgspässen. Da sich diese infolge der globalen Erwärmung verschieben, müssen die Grenzen angepasst werden. „Angesichts des Klimawandels und des rapiden Abschmelzens der Schweizer Gletscher ist in Zukunft mit mehr solcher Fälle zu rechnen“, so Swisstopo.
Für den Theodulgletscher sind die Hauptattraktionen der ikonische Berg Matterhorn und die Möglichkeit zum ganzjährigen Skifahren, vom Skiort Zermatt (1.620 m) auf der Schweizer Seite und Cervinia (2.050 m) auf der italienischen Seite.
Während tiefer gelegene Skigebiete aufgrund des Klimawandels mit Schneemangel zu kämpfen haben, zieht der Theodulgletscher immer mehr Skifahrer an. Der Sommer 2022 bildet jedoch eine Ausnahme. Wegen der Gletscherschmelze werden die Skipisten erstmals für die Öffentlichkeit gesperrt und nur für die Skifahrer des Nationalteams zugänglich sein.
Die Führer weisen darauf hin, dass einige Felsen auf der Iltay-Seite „zum ersten Mal seit Jahrzehnten“ nicht mehr mit Schnee bedeckt sind. Dies bestätigt einen allgemeineren Trend: Während die größten Gletscher aufgrund des Klimawandels schrumpfen, sind viele kleinere vollständig verschwunden.
„Wir haben derzeit 1.400 Gletscher in der Schweiz, viele davon sind klein. Kleine Gletscher verschwinden als erste. Allein in den letzten 30 bis 40 Jahren haben wir rund 1.000 Gletscher verloren. Jetzt verlieren wir die, die als wichtig gelten“, erklärt Matthias Huss, Leiter des Schweizer Gletscherüberwachungsnetzes (GLAMOS) an der ETH Zürich.

Das Schmelzen des Eises geht in der Region Zermatt in der Schweiz mit dem Ausbau der städtischen Infrastruktur einher. Foto: Euractiv
Der Klimawandel geht mit dem Schmelzen des Eises einher, ebenso wie mit dem Auftauen des Permafrosts (gefrorener Boden, der als Bindemittel zwischen zerklüftetem Gestein und anderem Gesteinsmaterial wirkt). Der Permafrost schmilzt zwar langsamer, hat aber noch größere Auswirkungen auf geologische Veränderungen sowie auf die Verschiebung von Ländergrenzen.
„Wenn wir über Felsstürze und Erdrutsche sprechen, wie den, der sich kürzlich in Tirol an der schweizerisch-österreichischen Grenze ereignet hat, hängt dies mit dem Auftauen des Permafrosts zusammen. Gletscher können dies auch verursachen, jedoch in geringerem Maße“, erklärte Professor Huss.
Bis auf die höchsten Gletscher der Alpen, wie beispielsweise die des Mont Blanc, könnten bis 2100 alle Gletscher verschwunden sein, so der Professor. Das sei das Worst-Case-Szenario, aber selbst im besten Fall – etwa wenn die Staaten der Welt bis 2050 CO₂-Neutralität erreichen – „werden zwei Drittel der Alpengletscher bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein“, sagte Professor Huss.
Im Gegensatz zu den reibungslosen Verhandlungen zwischen der Schweiz und Italien könnte ein ähnlicher Streit zwischen Frankreich und Italien über die Grenzrechte am Mont-Blanc-Gebirge nicht so gut verlaufen: Die Verhandlungen zwischen Paris und Rom, die sich schon seit Jahren hinziehen, werden die Expertise von Anwälten und Fachleuten erfordern, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.
Zukünftig könnten Spannungen auch in anderen Teilen der Welt aufflammen – beispielsweise in Asien, wo Grenzstreitigkeiten im Himalaya einen Konflikt zwischen Indien und China ausgelöst haben. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs um andere Ressourcen ist eine friedliche Beilegung solcher Spannungen unwahrscheinlich.
Quellenlink



![[Foto] Lam Dong: Bilder der Schäden nach einem mutmaßlichen Seeausbruch in Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)



![[Foto] Präsident Luong Cuong empfängt US-Kriegsminister Pete Hegseth](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)






















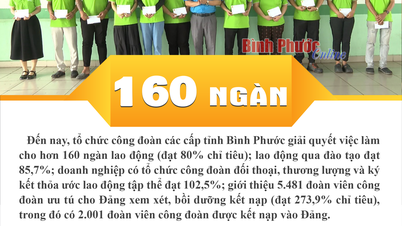































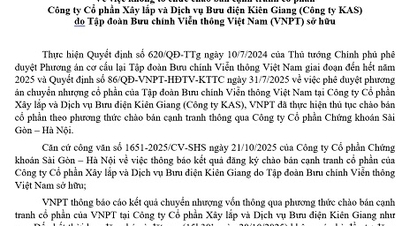







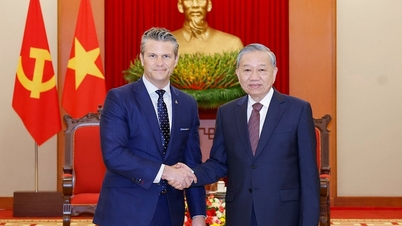










































Kommentar (0)