
Während der 40 Jahre des laufenden Modernisierungsprozesses hat sich Vietnams Integration in die Weltwirtschaft zunehmend vertieft und ausgeweitet. Dies geschah parallel zur Welle der Vierten Industriellen Revolution und der rasanten Entwicklung der digitalen Transformation, die von Daten, Technologie und digitalen Plattformen geprägt ist. Dieser Kontext fördert nicht nur Veränderungen im Wachstumsmodell, sondern macht auch eine Umstrukturierung der Wirtschaft hin zu Modernität, Inklusivität und Nachhaltigkeit dringend erforderlich. Ein zentraler Aspekt dieses Prozesses ist die Transformation der Produktivkräfte, die wiederum eine Anpassung der Produktionsverhältnisse zur Folge hat. In seinem Artikel „Digitale Transformation – eine wichtige Triebkraft für die Entwicklung der Produktivkräfte, die Perfektionierung der Produktionsverhältnisse und den Eintritt des Landes in eine neue Ära“ (1) betonte To Lam, Generalsekretär des Zentralen Exekutivkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, die entscheidende Rolle der Produktivkräfte und die Notwendigkeit, die Produktionsverhältnisse kontinuierlich an das neue Entwicklungsniveau anzupassen. Andernfalls würden die Produktionsverhältnisse zum Hindernis für die Gesamtentwicklung.
Der neue Kontext stellt theoretische Anforderungen an die weitere Erforschung und Klärung des Umfangs, Inhalts und der Interaktionsmethoden einiger traditioneller Konzepte und Kategorien wie „Produktionsmittel“, „Arbeit“ oder „Eigentum“. Gleichzeitig müssen die Rollen von Staat, Unternehmen und Arbeitnehmern in der Struktur moderner Produktionsverhältnisse neu definiert werden. Viele neue Fragen ergeben sich: Wem gehören die Daten? Wer kontrolliert die digitale Plattform? Welche Rolle und Stellung haben Arbeitnehmer und wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der digitalen Wirtschaft? Wie müssen sich Produktionsverhältnisse anpassen, wenn sich die Produktivkräfte in Struktur, Form und Funktionsweise grundlegend verändern?
Theoretische Grundlagen der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse im digitalen Zeitalter
Im Verlauf der Menschheitsgeschichte ist die gesellschaftliche Entwicklung stets mit grundlegenden Veränderungen der Produktionsweise verbunden, denen wiederum die Umstrukturierung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse zugrunde liegt. Der Marxismus – eine revolutionäre Lehre – betrachtet die Kategorien „Produktivkräfte“ und „Produktionsverhältnisse“ als zentralen Bezugspunkt zur Erklärung der historischen Dynamik. Im digitalen Zeitalter, in dem sich die Weltwirtschaft stark in Richtung Digitalisierung, Datenverarbeitung und Automatisierung verschiebt, ist die kreative und dialektische Anwendung dieses theoretischen Systems dringlich. Sie bildet eine wichtige Grundlage, um die Natur der Veränderungen in der Produktionsstruktur richtig zu erfassen und gleichzeitig die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für die gesellschaftliche Entwicklung im neuen Kontext zu steuern.
Marxistische Theorie der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse
Im theoretischen System von C. Marx spiegeln Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse die innere Struktur der Produktionsweise wider, die den entscheidenden Faktor für Wesen, Niveau und Entwicklungstendenz der Gesellschaft darstellt. Die dialektische Beziehung zwischen diesen beiden Faktoren bildet die Grundlage für die Erklärung der Entwicklung der Menschheitsgeschichte durch aufeinanderfolgende sozioökonomische Formen. Laut Marx sind Produktivkräfte die gesamte praktische Fähigkeit des Menschen, die Natur zu bewirtschaften und materiellen Reichtum zu erzeugen. Zu den Produktivkräften gehören die Produktionsmittel (Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände), die Arbeiter und der Stand der Anwendung von Wissenschaft und Technik in der Produktion. Die Arbeitsmittel gelten dabei als Maßstab für den Entwicklungsstand der Produktivkräfte in jeder historischen Epoche. Produktionsverhältnisse sind die gesamten ökonomischen Beziehungen zwischen den Menschen, die im Produktionsprozess entstehen, einschließlich der Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln, der Organisations- und Managementbeziehungen des Produktionsprozesses sowie der Produktverteilungsverhältnisse. Produktionsverhältnisse sind objektiv, unabhängig vom subjektiven Willen und die zwangsläufige Folge des Entwicklungsstands der Produktivkräfte in jeder historischen Epoche.
Gemäß dem Bewegungsgesetz der Produktionsweise spielen die Produktivkräfte eine entscheidende Rolle in den Produktionsverhältnissen. Sobald sie ein bestimmtes Entwicklungsniveau erreicht haben, machen sie die bestehenden Produktionsverhältnisse überflüssig, behindern die Produktion und führen so unweigerlich zu deren Ablösung durch neue, fortschrittlichere Produktionsverhältnisse. C. Marx sagte: „Auf einem bestimmten Entwicklungsstand geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Konflikt mit den bestehenden Produktionsverhältnissen … Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte werden diese Verhältnisse zu ihren Fesseln. Dann beginnt die Periode der gesellschaftlichen Umgestaltung“ (2) . Das Verhältnis zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ist jedoch nicht einseitig, sondern dialektisch, sowohl verbindend als auch widersprüchlich, da sie sich gegenseitig beeinflussen. In vielen Fällen können die Produktionsverhältnisse ein günstiges Umfeld, eine günstige Organisation und Verteilung für die Entwicklung der Produktivkräfte schaffen. Werden die Produktionsverhältnisse jedoch zu „Fesseln“, die die Produktivkräfte hemmen, wird die Verbesserung der Produktionsmethoden zu einer objektiven Notwendigkeit. Ein weiterer wichtiger Beitrag von Karl Marx liegt in der Betonung der Rolle der wissenschaftlich-technischen Revolution als unmittelbare Triebkraft für den Fortschritt der Produktivkräfte. In „Das Kapital“ und seinen späteren Werken entwickelte Marx eine Vision, die über die bisherigen Ansätze hinausging, indem er den Einfluss von Maschinen, Automatisierung und Arbeitsteilung in der Fabrik auf die Arbeitsproduktivität, die Klassenstruktur und die Arbeitsverhältnisse besonders berücksichtigte. Dies zeugt von der Offenheit des Marxismus und seiner Anpassungsfähigkeit an neue Produktionsformen jenseits der traditionellen Industrie.
„Evolution“ der Produktivkräfte im digitalen Zeitalter
Im digitalen Zeitalter haben sich die Produktivkräfte in Struktur, Form und Funktionsweise grundlegend gewandelt. Standen im Industriezeitalter materielle Arbeitsmittel wie Maschinen, mechanische Ketten oder elektrische Systeme im Zentrum der Produktivkräfte, so wird diese Rolle heute zunehmend von Daten, künstlicher Intelligenz, digitalen Plattformen und digitaler Technologie abgelöst. Diese neuen Faktoren verändern die Produktionsorganisation und die Arbeitsteilung weltweit.
Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften wie unbegrenzter Replikation, sofortiger Verbreitung und exponentieller Akkumulation sind Daten zu einem unverzichtbaren Input in den meisten sozioökonomischen Aktivitäten geworden. Anders als traditionelle Produktionsmittel, die knapp und begrenzt sind, sind Daten nicht nur ein Nebenprodukt des Produktions- und Konsumprozesses, sondern entwickeln sich zunehmend zu einer Kernressource, die Wettbewerbsvorteile in der globalen Wertschöpfungskette schafft. Aus marxistischer politischer Ökonomie erfordert der Aufstieg von Daten zu einem immateriellen Produktionsmittel eine Erweiterung des Begriffs „Arbeitsmittel“ und eine Überprüfung des Mechanismus der Mehrwertbildung unter den neuen Bedingungen, unter denen der Einsatz von Algorithmen, automatisierten Systemen und künstlicher Intelligenz zu einer höheren Arbeitsproduktivität als direkter Arbeit beiträgt. Parallel zu Daten schaffen Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Blockchain und digitale Plattform-Ökosysteme eine neue Form von Produktivkräften. Drei herausragende Merkmale dieser Form lassen sich wie folgt identifizieren: 1. Wissen wird zunehmend automatisiert; Maschinen ersetzen nicht mehr nur manuelle Arbeit, sondern haben die Funktionen des Denkens, Analysierens und Entscheidens teilweise übernommen; 2. Der Produktionsprozess erfolgt nach dem Mechanismus der „Plattformisierung“. Die Aktivitäten werden über digitale Zwischeninfrastrukturen (z. B. Amazon, Grab, Airbnb) organisiert. Die Akteure besitzen die physischen Produktionsmittel nicht direkt, sondern kontrollieren den Wertfluss und die Wertverteilung in der Produktionskette. 3. Das heutige Produktionsmodell ist vernetzt, dezentralisiert und flexibel und operiert über die physischen Grenzen von Fabriken, Unternehmen oder gar Ländern hinaus. Neben Daten tragen Technologieanwendungen wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Blockchain und digitale Plattformen zur Gestaltung einer neuen Form der Produktivkräfte bei.
Diese Veränderungen bringen einen tiefgreifenden Wandel der Rollen und Formen der Teilhabe von Arbeitnehmern mit sich. Während im Industriezeitalter die meisten Arbeiter lediglich repetitive Aufgaben mit Maschinen erledigten, werden sie in der digitalen Wirtschaft zu Designern, Überwachern, Analysatoren und Optimierern digitaler Systeme. Die Arbeitsleistung ist enger mit Daten, Algorithmen und Technologie verknüpft und erfordert logisches Denken, das Verständnis automatisierter Systeme und die Fähigkeit, sich an die immaterielle Produktionsumgebung anzupassen. Arbeiter interagieren heute nicht nur mit Maschinen, sondern auch mit Entscheidungssystemen, die auf Big Data und digitalen Plattformen basieren. Die „Hybridisierung“ von Mensch und Technologie in der neuen Form der Produktivkräfte schafft beispiellose Merkmale: Wertschöpfung ist ohne materielle Produktionsmittel möglich, Produktionsprozesse können außerhalb des herkömmlichen physischen Raums ablaufen, und die Arbeitsteilung erfolgt nahezu in Echtzeit, grenzüberschreitend durch Cloud-Infrastruktur und Verbindungsplattformen. Der Prozess der Entmaterialisierung der Produktivkräfte wird immer deutlicher und formt eine Produktionsorganisation, die weit über das traditionelle Konzept von Werkzeugen oder mechanischen Ketten hinausgeht.
Transformation der modernen Produktionsbeziehungen
Parallel zur Transformation der Produktivkräfte im digitalen Zeitalter unterliegen auch die Produktionsverhältnisse, die als Formen der Wirtschaftsorganisation den Entwicklungsstand der Produktivkräfte widerspiegeln, einem Strukturwandel. Kernelemente wie Eigentumsformen, Arbeitsorganisation, Vertriebsmechanismen und Managementmethoden werden durch den Aufstieg von Daten, digitalen Plattformen, künstlicher Intelligenz und grenzüberschreitenden Produktionsnetzwerken zunehmend umgestaltet. Anders als der langsame Transformationsprozess im traditionellen Industriezyklus vollzieht sich die Transformation der Produktionsverhältnisse im neuen Kontext rasant, hochkomplex und weist beispiellose Vielschichtigkeit auf.
Plattformkapital und immaterielle Kontrolle: Ein prägnantes Merkmal der heutigen Produktionsverhältnisse ist das Aufkommen und die Verbreitung des „Plattformkapitalismus“. Anstatt in materielle Produktionsmittel wie Land, Fabriken oder Rohstoffe zu investieren und diese direkt zu besitzen, konzentrieren sich Unternehmen in dieser Form auf die Beherrschung digitaler Plattformsysteme. Diese fungieren als Vermittler und organisieren die Interaktionen zwischen Nutzern, Lieferanten und Marktkräften. Kern dieses Mechanismus ist, dass die Produktionskraft nicht mehr an materielle Werkzeuge, sondern an immaterielle Faktoren wie Algorithmen und Daten gebunden ist. Daten zum Nutzerverhalten werden gesammelt und verarbeitet, um nicht nur Dienstleistungen zu personalisieren, sondern auch Trends vorherzusagen, Verhalten zu lenken und sogar die Entscheidungen von Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu beeinflussen. Nach C. Marx handelt es sich hierbei um eine erweiterte Form der Ausbeutung. Der Mehrwert stammt nicht nur aus materieller Arbeit, sondern auch aus Daten, interaktiver Zeit und menschlicher kognitiver Energie – Bereiche, die zuvor außerhalb des Analysebereichs der klassischen politischen Ökonomie lagen.
Dezentrale Produktionsnetzwerke und die Umstrukturierung der Wirtschaftsmacht: Parallel zur Entmaterialisierung wandeln sich Produktionsorganisationen im digitalen Zeitalter hin zu einem dezentralen und vernetzten Modell. Produktionsaktivitäten beschränken sich nicht mehr auf die lineare Kette einer Fabrik oder eines festen Komplexes, sondern werden in vielen funktionalen Clustern von unabhängigen Einheiten gesteuert, die jedoch über digitale Plattformen eng miteinander verbunden sind. So kann beispielsweise ein Technologieprodukt heute in den USA entwickelt, in Indien programmiert, in Vietnam hergestellt, in Thailand montiert, über TikTok global vermarktet und über Amazon vertrieben werden. Dieses neue Netzwerkmodell hat die Eigentums- und Kontrollverhältnisse in der Produktion grundlegend verändert. Die Kontrolle über den Produktionsprozess hängt nicht mehr primär vom Besitz physischer Produktionsmittel ab, sondern von der Kontrolle über Infrastruktur, Datenflüsse und Verbindungen. In dieser Struktur verfügen einige wenige globale Technologiekonzerne über einen dominanten Vorteil, da sie Märkte koordinieren, das Konsumverhalten beeinflussen und die Wertschöpfungsketten gestalten können. Im Gegensatz dazu sind die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und ihre Beschäftigten von „Black-Box-Algorithmen“ abhängig, zu denen sie keinen Zugang und keine Kontrolle haben. Hierbei handelt es sich um die Konzentration von Soft Power in einem verteilten Produktionssystem, in dem sich das Machtzentrum von der Fabrik hin zu Software, Plattformen und Datenbanken verlagert. Das Ergebnis ist die Bildung einer „digitalen Produktionsüberstruktur“, in der die Eigentümer von Plattformen und Algorithmen ein Volumen an Mehrwert aneignen können, das weit über ihre tatsächliche physische Produktionskapazität hinausgeht – eine Form der Mehrwertaneignung durch digitale Vermittlung.
Transformation der Arbeitsbeziehungen, Plattformarbeit und Algorithmen: Ein weiterer wichtiger Wandel ist die Verschiebung des Modells der Arbeitsbeziehungen von stabilen und formalen Formen hin zu flexibler, informeller und algorithmisch koordinierter Arbeit. Gig-Work, Freelance-Arbeit und Remote-Arbeit werden in vielen Branchen zunehmend zum Mainstream. Traditionelle Strukturen der Arbeitsbeziehungen, die auf langfristigen Verträgen, Mechanismen zum Schutz von Arbeitnehmerrechten und klaren Organisationsrahmen beruhen, werden durch flexible Arbeitsformen ersetzt, die weniger institutionell verankert sind und keine Kanäle für den kollektiven Dialog bieten. Obwohl von „Freiheit“ die Rede ist, werden Arbeitnehmer in Wirklichkeit durch versteckte Kriterien, Sternebewertungssysteme und Kundenfeedback streng kontrolliert, wodurch Freiheit zu einer neuen Form der Abhängigkeit wird. Dies ist eine Form der „Selbstverwaltung durch Überwachung“, in der Einzelpersonen gezwungen sind, einseitige Regeln ohne Verhandlung, ohne Erklärung und ohne Feedbackmechanismen zu befolgen. Eine große Herausforderung besteht darin, die Rechte von Arbeitnehmern in der digitalen Arbeitswelt zu schützen.
Zunehmende Ungleichheit und die Entstehung einer „neuen digitalen Klasse“: Eine tiefgreifende soziale Folge des Wandels moderner Produktionsverhältnisse ist die zunehmende soziale Polarisierung und digitale Ungleichheit. Gruppen, die sich Technologien zunutze machen, Daten kontrollieren und sich an die digitale Produktionsumgebung anpassen können, werden einen immer größeren Anteil des neu geschaffenen Mehrwerts für sich vereinnahmen. Umgekehrt laufen Arbeitnehmer, denen digitale Kompetenzen fehlen, die nicht aus- und weitergebildet werden oder die in digital benachteiligten Gebieten leben, Gefahr, an den Rand globaler Wertschöpfungsketten gedrängt zu werden. Dies birgt die Gefahr einer „digitalen Unterschicht“ – einer sozialen Gruppe, die sowohl durch digitale Plattformen ausgebeutet wird als auch nicht in vollem Umfang grundlegende soziale Rechte genießt.
Insgesamt werden die Produktionsverhältnisse im digitalen Zeitalter in eine flexiblere, dezentralere, aber gleichzeitig ungleichere Richtung umstrukturiert. In diesem Kontext behält der Marxismus mit seiner dialektischen Analyse und seinem kritischen Geist weiterhin seine Bedeutung als wichtiger Bezugsrahmen, um die neuen Widersprüche in den Produktionsverhältnissen des Daten- und Digitalzeitalters zu identifizieren und zu erklären. Vor diesem Hintergrund wird der Aufbau eines institutionellen Systems, das der neuen Produktionsstruktur gerecht wird und Fairness, Nachhaltigkeit und Kontrolle gewährleistet, zu einer strategischen Aufgabe für jedes Land.
Aktueller Stand der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse in Vietnam heute
Entwicklung der Produktivkräfte im heutigen Vietnam
In Vietnam entsteht eine neue Form der Produktivkraft, die auf der Kombination von digitaler Technologie, Daten, künstlicher Intelligenz und dem Innovationsökosystem basiert und materielle und technische Voraussetzungen schafft, die sich von früheren Perioden unterscheiden. Dieser Prozess verläuft jedoch ungleichmäßig und wird von institutionellen Faktoren, dem Markt, der Qualität der Humanressourcen und dem Entwicklungsspielraum beeinflusst.
Erstens zur digitalen Infrastruktur, der neuen materiellen Grundlage der Produktivkräfte. Waren die Produktivkräfte früher mit Fabriken, Maschinen und Anlagen verbunden, so bildet heute die digitale Infrastruktur, einschließlich Breitband-Telekommunikationsnetzen, Rechenzentren, Cloud-Computing, Edge-Computing und Hochleistungsrechnern, die materielle Grundlage. Bis Ende 2024 werden über 75 % der Bevölkerung das Internet nutzen, 74 % der Haushalte über einen Festnetz-Breitbandanschluss verfügen und alle Gemeinden/Stadtteile mit 4G-Netzabdeckung ausgestattet sein. Große Unternehmen wie VNPT, Viettel und FPT investieren massiv in 5G-Netze, Level-4-Rechenzentren und Cloud-Computing-Infrastruktur und tragen so zum Aufbau der materiellen Grundlage für die digitale Produktion bei.
Zweitens zu Daten und Plattformen – den neuen „Produktionsmitteln“ der digitalen Wirtschaft. Daten gelten aufgrund ihrer unendlichen Verfügbarkeit, der nahezu null Grenzkosten und des Potenzials für exponentielle Gewinne als das „neue Öl“ des 21. Jahrhunderts. Im Jahr 2023 verabschiedete die Nationalversammlung das Gesetz über elektronische Transaktionen (zuvor das Gesetz über elektronische Transaktionen von 2005). 2024 folgte das Datengesetz, und 2025 wurden das Gesetz über die digitale Technologiebranche sowie das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten verabschiedet – wichtige Rechtsdokumente für die digitale Transformation.
Drittens, künstliche Intelligenz und Technologie – die neue „Arbeitskraft“. In der marxistischen Theorie ist Arbeit der zentrale Faktor bei der Umwandlung von Produktionsmitteln in Produkte. Im digitalen Umfeld werden jedoch dank Algorithmen, Software und KI-Systemen immer mehr Produktionsprozesse automatisiert, wodurch die traditionelle Arbeit schrittweise durch maschinelles Lernen ersetzt wird. Vietnam hat große Anstrengungen unternommen, KI in den Bereichen Finanzen (Bankwesen), E-Commerce, Logistik und Gesundheitswesen anzuwenden. Aktuell belegt Vietnam im Index „KI-Bereitschaft der Regierung“ mit 54,48 Punkten nur Platz 59 von 193 Ländern und damit Platz 5 innerhalb der ASEAN (3). Die meisten Unternehmen befinden sich noch in der Testphase, während Dateninfrastruktur, Rechenkapazität und KI-Fachkräfte weiterhin Herausforderungen darstellen.
Viertens, zu digitalen Kenntnissen und Fähigkeiten – dem menschlichen Faktor in der Produktivität. In einer Wissensgesellschaft sind menschliches Wissen und kreative Fähigkeiten die tragenden Säulen. Arbeitnehmer benötigen heute nicht nur einfache handwerkliche Fertigkeiten, sondern müssen auch über fundierte digitale Kompetenzen verfügen, wie beispielsweise Datenanalyse, die Bedienung intelligenter Systeme, Design Thinking und plattformübergreifende Kommunikation. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums liegt der Anteil vietnamesischer Arbeitnehmer mit grundlegenden digitalen Kompetenzen noch immer unter dem ASEAN-Durchschnitt. Gleichzeitig schreitet die Integration digitaler Kompetenzen, KI und Data Science in die Lehrpläne des Bildungssystems, insbesondere der Berufs- und Hochschulbildung, nur langsam voran.
Fünftens, im Hinblick auf den digitalen Raum und die dynamischen Regionen, die neue „Geografie“ der Produktion. Im Industriezeitalter waren die Produktivkräfte mit Industrieparks und zentralisierten Fabriken verbunden. Heute hat sich der Produktionsraum auf den digitalen Raum, die Cloud und Online-Plattformen ausgeweitet, obwohl die Geografie weiterhin die Ressourcenverteilung bestimmt. Großstädte wie Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Da Nang und Bac Ninh bilden zunehmend „digitale Produktivkraftcluster“ mit einer führenden Rolle. Im Gegensatz dazu mangelt es den Regionen Nordwest, Zentral-Hochland und Südwest weiterhin an Infrastruktur, Fachkräften und Fördermaßnahmen, wodurch die Kluft zwischen den Regionen wächst.
Aktueller Stand der Produktionsbeziehungen
Im Zuge seiner sozioökonomischen Entwicklung hat Vietnam die Produktionsbeziehungen proaktiv an die Entwicklungsbedürfnisse der Produktivkräfte angepasst, insbesondere in der Phase der Innovation und Integration und vor dem tiefgreifenden Einfluss der Vierten Industriellen Revolution. Dennoch weisen die Produktionsbeziehungen weiterhin Schwächen auf, die auf drei Ebenen analysiert werden müssen: Eigentumsverhältnisse, Organisations- und Managementbeziehungen sowie Vertriebsbeziehungen.
Zunächst zur Eigentumssituation der Produktionsmittel. Vietnam verfolgt ein gemischtes Eigentumsmodell mit drei Hauptformen: öffentliches Eigentum (wobei der Staat als Eigentümer auftritt), kollektives Eigentum und privates Eigentum. Der private Sektor und der ausländisch investierte Sektor spielen dabei eine zunehmend treibende Rolle bei der Entwicklung der Produktivkräfte und der technologischen Innovation. Die Akkumulation und Konzentration von Produktionsmitteln zur Bildung großer, wertschöpfungskettenführender Unternehmen ist jedoch noch begrenzt. Gleichzeitig nimmt der öffentliche Sektor durch staatseigene Unternehmen weiterhin eine führende Position in Schlüsselindustrien ein, die Effizienz der Nutzung der Produktionsmittel (insbesondere von Land, Kapital und Ressourcen) ist jedoch nicht entsprechend hoch.
Zweitens zum Verhältnis zwischen Produktionsorganisation und Management. Der Übergang zu einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft hat ein vielfältiges Ökosystem von Produktionsorganisationen geschaffen, von Staatsbetrieben über Privatunternehmen und ausländische Direktinvestitionsunternehmen bis hin zu Genossenschaften, digitalen Plattformen und Sharing-Modellen. Die Transformation von traditionellen zu modernen, daten-, digital- und netzwerkbasierten Governance-Modellen verläuft jedoch weiterhin schleppend. Staatsbetriebe stehen vor zahlreichen Herausforderungen bei der Innovation und der Effizienzsteigerung ihrer Governance-Systeme. Dies schränkt ihre Rolle als Vorreiter und Führungskraft bei der Gestaltung und dem Ausbau nationaler, regionaler und globaler Produktions-, Liefer- und Wertschöpfungsketten ein. Der Privatsektor, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), hat nach wie vor Schwierigkeiten beim Zugang zu digitaler Infrastruktur, Datenplattformen und den notwendigen Kompetenzen, um die Produktion digital umzustrukturieren. Insbesondere die neuen Arbeitsverhältnisse im Bereich der Plattformarbeit oder der Telearbeit erfordern ein neues Governance-Modell. Dies bedingt Anpassungen des Rechtsrahmens und der Mechanismen des Arbeitsmanagements an die neue Produktionsform.
Drittens zur Verteilung der Arbeitsleistung. Vietnam wendet derzeit einen Verteilungsmechanismus an, der hauptsächlich auf einem regulierten Markt basiert. Die Einkommensunterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen, Regionen, Branchen und Berufen nehmen jedoch weiter zu. Die Mittelschicht wächst rasant, aber ein großer Teil der Erwerbsbevölkerung, insbesondere im informellen Sektor und im ländlichen Raum, profitiert noch nicht in vollem Umfang vom Wachstum. In der digitalen Wirtschaft weist das System der Leistungsverteilung noch viele Mängel auf. Persönliche Daten, eine wichtige Form digitaler Vermögenswerte, werden nicht angemessen bewertet und verteilt; Plattformarbeiter erhalten kein Mindesteinkommen und keine Sozialleistungen, die dem Wert entsprechen, den sie für digitale Plattformen schaffen.

Herausragende Merkmale und Trends bei der Umstrukturierung der Produktivkräfte und Produktionsbeziehungen in Vietnam im digitalen Zeitalter
In den letzten Jahren haben die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in Vietnam einen tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess durchlaufen, der sich deutlich in drei herausragenden Merkmalen und Haupttrends zeigt.
Erstens vollzieht sich ein Wandel in der Struktur der Produktionskräfte hin zur Digitalisierung und Wissensvermittlung. Der technologische Stand, insbesondere der digitalen Technologie, wird zu einem Schlüsselfaktor für die Arbeitsproduktivität und die nationale Wettbewerbsfähigkeit. Vietnams digitale Wirtschaft wird 2024 voraussichtlich rund 18,3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 20 % wachsen – dreimal so schnell wie das durchschnittliche BIP-Wachstum und eines der schnellsten in Südostasien. Der Online-Einzelhandel wird ein Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar erreichen, ein Plus von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr. Bargeldlose Zahlungen verzeichnen weiterhin ein Wachstum von über 50 % pro Jahr und liegen damit an der Spitze der ASEAN-Staaten (4). Digitale Wirtschaftssektoren wie E-Commerce, digitale Finanzdienstleistungen, intelligente Logistik und Finanztechnologie (Fintech) schaffen neue dynamische Wachstumsfelder.
Zweitens spiegelt sich die Umstrukturierung der Produktionsverhältnisse in einer neuen Differenzierung von Eigentum, Organisation und Vertrieb wider. Die Eigentumsformen an den Produktionsmitteln werden immer vielfältiger und umfassen neben staatlichem und privatem Eigentum auch neue Modelle wie geistiges Eigentum, Dateneigentum, Aktienbeteiligung, Sharing-Plattformen, flexible Arbeitsmodelle und unkonventionelle Organisationsformen wie Blockchain oder dezentrale autonome Organisationen (DAOs). Die Organisation der Produktion über digitale Plattformen führt zu flexibleren, kurzfristigeren und informelleren Arbeitsverhältnissen und erfordert dringend Innovationen in den Bereichen Recht, Sozialversicherung und Arbeitsmanagement.
Drittens hat die Anwendung bahnbrechender wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften wie Big Data, Künstlicher Intelligenz (KI), Cloud Computing, Biotechnologie, Robotik und Automatisierung sowie dem Internet der Dinge (IoT) zur Entstehung neuer Formen der Produktivkräfte geführt. Diese Faktoren dienen nicht nur als Produktionswerkzeuge, sondern werden zu zentralen Produktionsmitteln und dominieren sogar ganze Branchen. Insbesondere Daten, die zuvor nicht als Produktionsmittel galten, sind heute ein unverzichtbarer „Treibstoff“ der digitalen Wirtschaft. Vietnam hat eine nationale Datenstrategie verabschiedet, das Datengesetz, das Datenschutzgesetz und das Gesetz zur digitalen Technologieindustrie erlassen sowie ein nationales Datenzentrum eingerichtet und damit die strategische Bedeutung von Daten in der modernen Produktionsstruktur unterstrichen.
--------------------------------
(1) Prof. Dr. To Lam: „Digitale Transformation – eine wichtige Triebkraft für die Entwicklung der Produktivkräfte, die Perfektionierung der Produktionsverhältnisse und den Eintritt des Landes in eine neue Ära“, Electronic Communist Magazine, 25. Juli 2025, https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/chuyen-doi-so-dong-
(2) C. Marx und F. Engels: Sämtliche Werke, Truth Publishing House, 2011, Bd. 1, S. 21
(3) Hoang Giang: Vietnam belegt im globalen KI-Bereitschaftsindex den 5. Platz in der ASEAN, Regierungszeitung, 25. Juli 2025, https://baochinhphu.vn/viet-nam-xep-thu-5-trong-asean-ve-chi-so-san-sang-ai-toan-cau-102240116173427249.htm
(4) Ha Van: Vietnams digitale Wirtschaft wächst am schnellsten in der Region, Regierungszeitung, 25. Juli 2025
Quelle: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1141502/cau-truc-lai-luc-luong-san-xuat-va-chuyen-doi-quan-he-san-xuat-trong-ky-nguyen-so--tiep-can-ly-luan-mac-xit-va-ham-y-chinh-sach-%28ky-i%29.aspx






![[Foto] Cat Ba – Grünes Inselparadies](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)


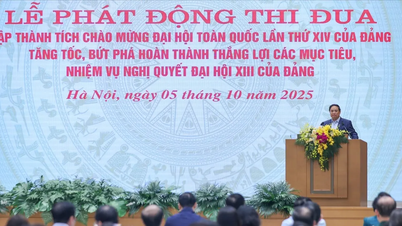












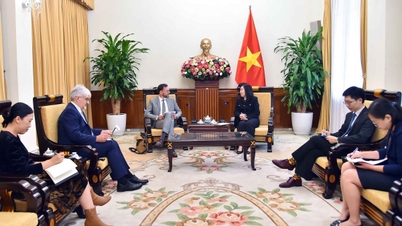





































![[VIMC 40 Tage Blitzgeschwindigkeit] Hafen Da Nang: Einheit – Blitzgeschwindigkeit – Durchbruch bis zum Ziel](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764833540882_cdn_4-12-25.jpeg)















































Kommentar (0)