Das Spiel der Giganten
Im Juni glaubte Elon Musk, dass KI bis Ende 2026 die menschliche Intelligenz übertreffen würde. Im Juli erklärte Sam Altman von OpenAI, seine Technologie werde „den Lauf der Geschichte neu gestalten“. Mark Zuckerberg träumte von „persönlicher Superintelligenz“.
Diese großen Versprechen werden durch einen unglaublichen Geldregen unterstützt. Allein im Jahr 2025 werden die fünf Tech-Giganten voraussichtlich 371 Milliarden Dollar für den Bau riesiger Rechenzentren ausgeben. Laut McKinsey könnte diese Zahl bis 2030 auf 5,2 Billionen Dollar ansteigen.
Diese schwindelerregenden Zahlen zeichnen ein rosiges Bild. Betrachtet man jedoch den Cashflow, ergibt sich ein viel komplexeres und beunruhigenderes Bild. Die KI-Revolution wird tatsächlich von einem „geschlossenen Finanzkreislauf“ angetrieben – einem Spiel, bei dem das Haus der größte Spieler ist.
Betrachten wir dieses verworrene Netz: Nvidia, der 4,5 Billionen Dollar schwere Chip-Gigant, plant, 100 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren. OpenAI kauft Cloud-Computing-Dienste von Oracle und Infrastruktur von CoreWeave. Ironischerweise gibt Oracle Dutzende Milliarden Dollar für Nvidias eigene Chips aus, um OpenAI zu betreiben, während CoreWeave ebenfalls erhebliche Mittel von Nvidia erhält. Erst kürzlich unterzeichnete OpenAI einen Vertrag zum Kauf von Chips des Nvidia-Rivalen AMD und berechtigte damit zum Erwerb von bis zu 10 % der Unternehmensanteile.
Das Geld fließt in einem Diamantenclub: Nvidia stellt Geld und Chips bereit, OpenAI entwickelt Modelle, Cloud-Unternehmen wie Oracle und CoreWeave bauen Infrastrukturen mit Nvidia-Chips auf, um OpenAI zu bedienen, und alle werden zu astronomischen Preisen bewertet.
Es handelt sich um ein autarkes Ökosystem, in dem Nachfrage und Wachstum scheinbar intern generiert werden und nicht vom realen Markt kommen.

Beobachter warnen, dass die enge Verflechtung der Technologiegiganten im KI-Rennen an die „Tech-Blase“ vor zwei Jahrzehnten erinnert (Foto: Getty).
Die Wachstumsillusion am Mausrad
Die Kernfrage, die sich namhafte Investoren wie Harris Kupperman von Praetorian Capital stellen, lautet: „Wird sich diese Investition jemals auszahlen? Ich denke, die Antwort ist: fast unmöglich.“ Er spricht unverblümt von einer „Blase“.
Die Zahlen scheinen die Skeptiker zu bestätigen. Experten von Exponential View schätzen, dass die gesamte KI-Branche bis 2025 lediglich 60 Milliarden Dollar Umsatz generieren wird – eine lächerliche Summe im Vergleich zu den Investitionen von 371 Milliarden Dollar. Bain & Co. ist sogar noch pessimistischer: Die großen Technologieunternehmen müssten jährlich zwei Billionen Dollar zusätzlich erwirtschaften, um bis 2030 mit ihren Rechenzentren die Gewinnschwelle zu erreichen. Selbst das optimistischste Szenario geht davon aus, dass ihnen jährlich bis zu 800 Milliarden Dollar fehlen werden.
Dieses Defizit offenbart den fatalen Fehler des aktuellen Modells. Anders als die Eisenbahnblase des 19. Jahrhunderts oder die Telekommunikationsblase der frühen 2000er Jahre, die eine nachhaltige Infrastruktur (Schienen, Glasfaser) hinterließen, ähneln KI-Investitionen einem „Mausrad“.
Grafikprozessoren (GPUs) – das Herzstück der KI – veralten bereits nach wenigen Jahren. Unternehmen müssen daher kontinuierlich Geld in sie investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben – eine Kostenspirale, die kein Ende nimmt.
Darüber hinaus drohen physische Hindernisse. Der Bau eines Rechenzentrums dauert zwei bis drei Jahre, der Anschluss an das Stromnetz kann jedoch bis zu acht Jahre dauern. Virginia, die „Rechenzentrumshauptstadt der Welt “, warnte, dass es „sehr schwierig“ sei, den gesamten Energiebedarf dieser Projekte zu decken.
Noch wichtiger ist, dass die tatsächliche Wirksamkeit von KI in der Wirtschaft weiterhin ein großes Fragezeichen ist. Ein McKinsey-Bericht ergab, dass fast 80 % der Unternehmen, die generative KI einsetzen, keine „signifikanten Auswirkungen auf den Gewinn“ verzeichneten. Der eher verhaltene Start von GPT-5 wirft zudem die Frage auf: Geht die Ära des „Mehr Daten machen bessere KI“ zu Ende?
Systemische Risiken durch versteckte Schulden
Die engen Beziehungen zwischen den KI-Giganten erinnern an die dunklen Zeiten der Dotcom-Blase, als sich Unternehmen durch zirkuläre Deals gegenseitig bewerteten. Gil Luria, Geschäftsführer von DA Davidson, warnt, dass diese Deals ihre Bewertungen künstlich in die Höhe treiben könnten. Sobald Investoren dies erkennen, sei ein Kurssturz unvermeidlich.
Noch gefährlicher ist, dass die finanzielle Lage zunehmend undurchsichtiger wird. Um ihren teuren Wettlauf zu finanzieren, greifen Unternehmen wie Meta, OpenAI und CoreWeave zunehmend auf private Kreditfonds zurück, oft über Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPVs). Diese Finanzinstrumente helfen ihnen, Schulden aus ihren Bilanzen zu „verstecken“, was die Risikobewertung extrem erschwert.
Dieses Risiko beschränkt sich nicht mehr nur auf das Silicon Valley. Laut Investor Paul Kedrosky greift es auch auf Privatanleger über. Private-Equity-Fonds sammeln Geld von Versicherungsgesellschaften und Immobilien-ETFs, um in Rechenzentren zu investieren. Und natürlich setzt jeder, der Aktien der sieben Tech-Giganten (Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) besitzt – die 35 % des S&P 500 ausmachen –, indirekt auf dieses Spiel.
Wenn KI nicht die erwarteten Ergebnisse liefert, „könnten die Aktienmärkte der Technologiebranche einen starken Rückgang erleben, mit negativen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft “, warnt Oxford Economics.
Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dau-tu-cheo-cac-ga-khong-lo-cong-nghe-dang-tu-thoi-phong-bong-bong-ai-20251010190538125.htm


![[Foto] Ho-Chi-Minh-Stadt erstrahlt am Vorabend des 1. Parteitags (2025–2030) in Fahnen und Blumen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)

![[Foto] Der Generalsekretär nimmt an der Parade zur Feier des 80. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Arbeiterpartei teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)


![[Foto] Eröffnung des Weltkulturfestivals in Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760113426728_ndo_br_lehoi-khaimac-jpg.webp)
































































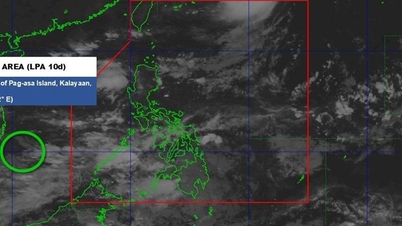



































Kommentar (0)