Während einer kürzlich stattgefundenen Investorenpräsentation zeigte Jon Gray, Vorstandsvorsitzender und Chief Operating Officer (COO) des Investmentriesen Blackstone, einen Ausschnitt aus dem Klassiker „Die Reifeprüfung“ von 1967. In der berühmten Szene erhält der junge Benjamin Braddock (gespielt von Dustin Hoffman) von einem Freund seiner Eltern einen prägnanten, aber aussagekräftigen Karrieretipp: „Ein Wort: Kunststoffe.“
In Grays Version wird das Wort „Kunststoffe“ (das die Raumfahrtökonomie der 1960er Jahre widerspiegelt) jedoch durch „Energie“ ersetzt.
Dieser subtile Wandel ist mehr als nur ein dramatischer Schritt. Er birgt eine strategische Botschaft von Hunderten von Milliarden Dollar und enthüllt, wer die wahren Gewinner und Verlierer im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) sein werden – einer Revolution, die die gesamte Weltwirtschaft in atemberaubendem Tempo umgestaltet.
Der Ratschlag, dass „Energie das neue Plastik ist“, ist mehr als nur eine clevere Metapher. Er verkörpert eine kluge Anlagestrategie, die Blackstone verfolgt, nämlich die „Schaufel-und-Spitzhacke“-Strategie.
Anstatt direkt auf risikoreiche Unternehmen im Bereich der generativen KI zu setzen, investieren sie lieber in die Grundlagen, die den Hype am Leben erhalten.
Milliarden-Dollar-Infrastrukturfieber: „Diesmal ist alles ganz anders.“
Der Wettlauf um die beste KI löst eine beispiellose Welle von Infrastrukturinvestitionen aus. Allein in diesem Jahr haben vier Tech-Giganten – Microsoft, Amazon, Google und Meta – schätzungsweise 350 Milliarden US-Dollar für den Bau von Rechenzentren weltweit zugesagt. Diese Summe erinnert an vergangene Spekulationsblasen, insbesondere an die Dotcom-Blase der späten 1990er-Jahre.
Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied.
Während der Dotcom-Ära wurden riesige Mengen an Glasfaserkabeln verlegt, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Nach dem Platzen der Blase blieben jedoch 85 % dieser Kapazität ungenutzt. Heute bauen Unternehmen nicht mehr, um die Nachfrage zu befriedigen.
Sie haben Mühe, die aktuelle Nachfrage zu decken. Amazon, Microsoft und Google räumen ein, dass die Nachfrage nach KI-Computing ihre Produktionskapazitäten übersteigt, was auf drei Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist: Chip-, Strom- und Platzmangel.
OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, ist das beste Beispiel. Mit über 700 Millionen wöchentlichen Nutzern – der schnellsten Wachstumsrate, die jemals verzeichnet wurde – lautete die Botschaft, die sie ihren Microsoft-Partnern in jedem Meeting wiederholten: „Wir brauchen mehr Rechenleistung.“
Dies stellt die Tech-Giganten vor ein Dilemma. Theoretisch wäre es im Interesse aller, die Investitionen zu drosseln, um ein kostspieliges Wettrüsten zu vermeiden. Doch in der Praxis wagt es niemand, damit aufzuhören.
Die Angst, von der Konkurrenz überholt zu werden, die Furcht, den „KI-Moment“ zu verpassen, ist zur größten Triebkraft geworden und sorgt dafür, dass dieser Hype anhält. Sie sind gezwungen, mitzumachen, sonst werden sie zur Zielscheibe der Konkurrenz.
Nvidia und OpenAI haben soeben einen Deal über 100 Milliarden Dollar zum Bau von 10 GW KI-Rechenzentren bis 2026 bekannt gegeben und festigen damit Nvidias Position als Hauptakteur der KI-Infrastruktur (Illustration: AInvest).
Die Gewinner sind nicht nur Programmierer
Wer wird also am meisten von diesem enormen Kapitalzufluss profitieren? Die Antwort dürfte viele überraschen.
Die „Hacken- und Schaufelverkäufer“:
Statt auf risikoreiche KI-Unternehmen zu setzen, verfolgt Blackstone die Strategie, in die Grundlagen zu investieren, die den Boom antreiben – in die Menschen, die während des Goldrausches „Spitzhacken und Schaufeln verkauften“.
Energie und Infrastruktur: Wie Jon Gray treffend bemerkte, ist Energie „der Kunststoff des neuen Zeitalters“. Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen an Strom. Dies eröffnet Energieunternehmen sowie Betreibern und Erbauern der Infrastruktur goldene Chancen. Blackstone hat aus einer 10-Milliarden-Dollar-Investition in das Rechenzentrumsunternehmen QTS im Jahr 2021 ein 70-Milliarden-Dollar-Imperium aufgebaut.
Fachkräfte: Der Bauboom von Rechenzentren hat eine enorme Nachfrage nach Elektrikern, Installateuren und Betriebsingenieuren geschaffen. Diese Berufe können nicht durch KI ersetzt werden und sind stark mangelhaft. Eine LinkedIn-Studie ergab sogar, dass die Öl- und Gasindustrie sowie der Bedarf an Fachkräften zu den am schnellsten wachsenden Sektoren zählen.
Chiphersteller: Nvidia ist natürlich der unbestrittene Marktführer bei GPU-Chips – dem Herzstück aller KI-Modelle. Zusammen mit Unternehmen wie Broadcom gehören sie zu den wichtigsten Anbietern von Basiskomponenten und profitieren direkt von jedem in KI-Infrastruktur investierten Dollar.
Die etablierten Giganten
Ein wichtiger Unterschied zwischen KI und der Internetrevolution liegt in der Art des Wandels. Das Internet verdrängte ganze alte Branchen (Druckereien, Videoverleih) und ersetzte sie durch neue, dominante. KI hingegen scheint eher ein evolutionärer Schritt als eine destruktive Revolution zu sein.
Bestehende, starke Unternehmen, insbesondere Technologiegiganten, sind besser in der Lage, sich an KI anzupassen und von ihr zu profitieren, als von ihr verdrängt zu werden.
Google integriert die generative KI Gemini in seine Kernsuchmaschine.
Meta nutzt KI zur Steuerung von Anzeigen und ermöglicht so eine präzisere Zielgruppenansprache.
Microsoft besitzt nicht nur einen großen Anteil an OpenAI, sondern integriert KI auch in alles von Windows bis zur Office-Suite.
Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen wie Salesforce und Adobe nutzen KI, um Aufgaben zu automatisieren und die Effizienz zu steigern, anstatt ersetzt zu werden.
Die „etablierten Akteure“ im Zeitalter der KI sind globale Technologiekonzerne, und sie treiben den Wandel selbst voran.
Während des Goldrausches war nicht derjenige der reichste Mann, der das meiste Gold ausgrub, sondern derjenige, der Spitzhacken und Schaufeln verkaufte (Illustration: Getty).
Verlierer und „veränderte“ Karrieren
Natürlich bleiben bei jedem technologischen Wandel Menschen auf der Strecke. Auch die KI bildet da keine Ausnahme, und die ersten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zeigen sich bereits.
"Neuling" in der Technologiebranche
Untersuchungen der Stanford University deuten auf einen besorgniserregenden Trend hin: Künstliche Intelligenz scheint in einigen Bürojobs die am wenigsten erfahrene Gruppe von Arbeitnehmern (22-25 Jahre) zu ersetzen.
Junior-Softwareentwickler: Dank KI-Tools wie Googles „Claude Code“ können erfahrene Programmierer produktiver arbeiten, wodurch der Bedarf an Berufsanfängern sinkt. Daten zeigen, dass die Einstellungsrate von Junior-Programmierern seit Ende 2022 deutlich hinter der von erfahrenen Fachkräften zurückbleibt.
Kundendienstmitarbeiter: Künstliche Intelligenz wird immer ausgefeilter darin, „ans Telefon zu gehen“ und Kundenfragen zu beantworten, wodurch der Bedarf an Einsteigerpersonal für diese Position sinkt.
Branchen, die „nach Regeln funktionieren“
Jon Gray betonte, dass Blackstone in „regelbasierte Unternehmen“ investiert – in denen KI die Arbeitsweise grundlegend verändern kann. Bereiche wie Buchhaltung, Schadenbearbeitung oder Marketing-Compliance-Management bergen das Potenzial, umfassend automatisiert zu werden.
Während einige Experten argumentieren, dass KI die Produktivität steigern und es Unternehmen ermöglichen wird, mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern mehr zu leisten, besteht nach wie vor das Szenario von Stellenabbau.
Kreativwirtschaft
Auch die Kreativbranche ist nicht immun. Gray nannte ein Beispiel von Blackstone selbst. Das Unternehmen produzierte zwei Versionen desselben Werbespots . Die erste, in Vancouver gedreht, kostete rund eine Million Dollar. Die zweite, intern von zwei Mitarbeitern mithilfe einer KI innerhalb weniger Stunden erstellt, kostete „deutlich weniger“.
Auch wenn die Qualität nicht vergleichbar sein mag, ist der Kostenunterschied ein Faktor, der nicht ignoriert werden kann und große Fragen für die Zukunft von Videoproduzenten, Designern und anderen kreativen Berufen aufwirft.
Trotz der Umwälzungen dürfte KI nicht die „zerstörerische Revolution“ auslösen, die das Internet war. Zwar verdrängte das Internet Printzeitungen und Videotheken, doch KI erscheint als ein unvermeidlicher evolutionärer Schritt.
Der Unterschied liegt darin, dass die etablierten Unternehmen im Internetzeitalter traditionelle Branchen waren, während es im KI-Zeitalter die globalen Technologiekonzerne sind. Und anstatt passiv darauf zu warten, abgelöst zu werden, treiben sie den Wandel aktiv voran. Google integrierte KI mit Gemini in die Suche, Microsoft beteiligte sich maßgeblich an OpenAI, Amazon entwickelte eigene Chips und ging eine Partnerschaft mit Anthropic ein, und Meta nutzt KI zur Optimierung von Werbung.
Bestehende Unternehmen werden nicht verdrängt, sondern können KI integrieren und zu einem Wachstumsmotor machen. Uber kann von Robotaxis profitieren, Salesforce nutzt KI zur Automatisierung, anstatt ersetzt zu werden.
Künstliche Intelligenz beginnt, in einigen Bürojobs die am wenigsten erfahrenen Arbeiter zu ersetzen (Illustration: Acharya Prashant).
Das KI-Wettrennen ist daher keine Wiederholung der Dotcom-Blase. Es ist ein langfristiges Spiel, das auf drei Jahrzehnten Internetdaten und der enormen Rechenleistung von GPUs basiert.
Kurzfristig mag KI schrittweise Veränderungen bewirken. Langfristig könnte ihr Einfluss jedoch weitreichend sein und den Weg für Technologien ebnen, die einst nur Science- Fiction waren, wie selbstfahrende Autos, vollautomatisierte Systeme und sogar Fortschritte im Quantencomputing.
Wie Albert Einstein sagte: „Der Zinseszins ist das achte Weltwunder.“ Künstliche Intelligenz (KI) ist der „Zinseszins“ der Technologie. Kleine Veränderungen, Tag für Tag summiert, werden Wunder bewirken. Und in diesem Wettlauf wird nicht unbedingt derjenige gewinnen, der das intelligenteste KI-Modell entwickelt, sondern vielleicht derjenige, der die nötige Energie bereitstellt, die Infrastruktur aufbaut und vor allem die Macht des Zinseszinses versteht, um sich anzupassen und zu überleben.
Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ai-dang-dot-tien-va-ai-se-hot-bac-trong-cuoc-dua-ai-20250928092257829.htm



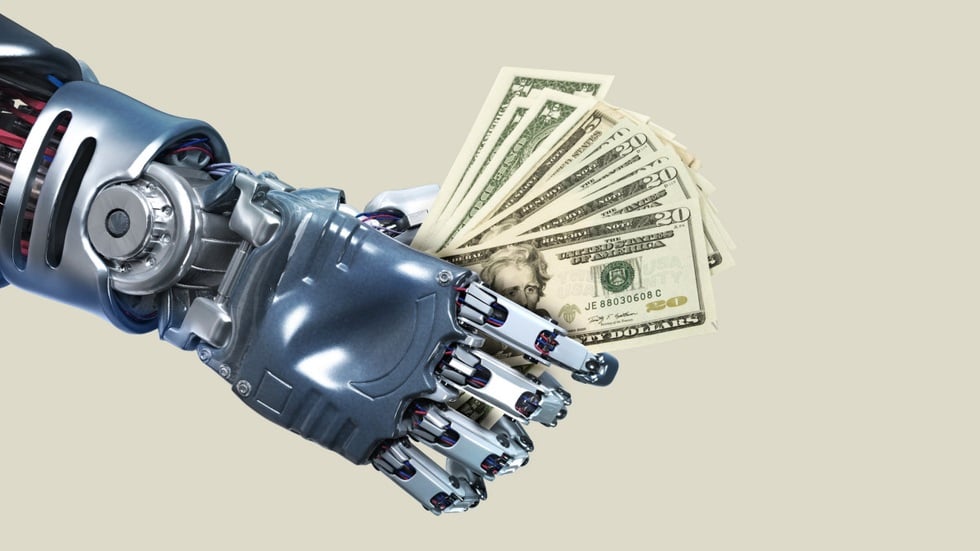


![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh trifft sich mit Vertretern herausragender Lehrer](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)
![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt Vizepräsident der Luxshare-ICT-Gruppe (China)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)


![[Foto] Panorama der Finalrunde der Community Action Awards 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763206932975_chi-7868-jpg.webp)






























































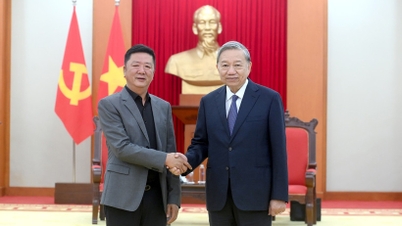







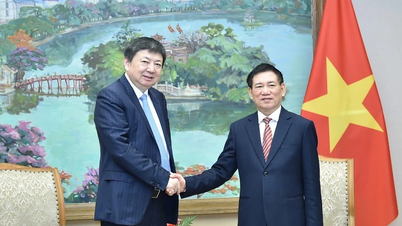





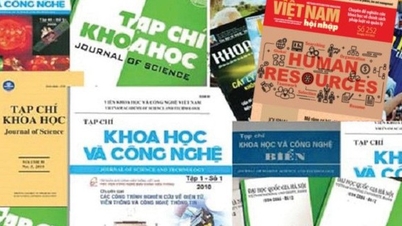
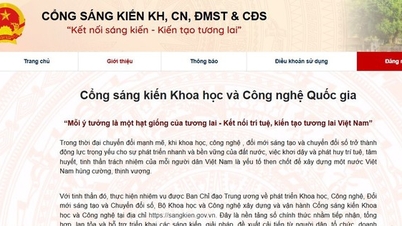




















Kommentar (0)