In den 1990er und frühen 2000er Jahren folgten die Aktienmärkte weltweit dem „Trommelschlag“ der Wall Street, während die Zentralbanken entweder dem Beispiel der US-Notenbank (Fed) folgten oder mit einem Zu- oder Abfluss von „heißem Geld“ konfrontiert waren, was den Wert der Währungen und die Preisstabilität gefährdete.
 |
| Hauptsitz der Fed in Washington, USA. (Quelle: Getty Images) |
In den großen Volkswirtschaften ist die Lage ganz anders. In den USA war in den letzten zwei Jahren die Inflation nach der Pandemie das Problem. Europa stand unter ähnlichem Druck, der durch den Konflikt in der Ukraine, der die billigen russischen Gaslieferungen unterbrach, noch verschärft wurde. In Japan ist mit einer höheren Inflation zu rechnen – ein Zeichen dafür, dass sich die schwache Wirtschaft des Landes möglicherweise erholt. In China liegt das Problem nicht darin, dass die Preise zu hoch, sondern dass sie zu niedrig sind.
Infolgedessen bewegen sich viele Zentralbanken mit unterschiedlichem Tempo oder sogar in unterschiedliche Richtungen. Die Fed hat die Zinsen bei starker Inflation erst spät angehoben, bei moderater Inflation erst spät gesenkt.
Die Europäische Zentralbank und die Bank of England sowie zahlreiche Zentralbanken der Schwellenländer haben bereits vor der Fed mit Zinssenkungen begonnen. In China hingegen versuchen die Entscheidungsträger, den schleichenden Zusammenbruch des Immobilienmarktes aufzuhalten und den Aktienmarkt zu stützen. Die Bank of Japan senkt die Zinsen nicht, sondern erhöht sie.
Wenn Zentralbanken unterschiedliche Wege einschlagen, passieren merkwürdige Dinge. So fiel beispielsweise der japanische Yen in der ersten Jahreshälfte, stieg dann im Sommer sprunghaft an und stürzte dann wieder ab, weil die Fed und die BoJ möglicherweise unterschiedliche Wege einschlugen.
Währungsschwankungen haben Folgen. Ein schwächerer Yen bedeutet höhere Gewinne für japanische Unternehmen und einen Anstieg des Nikkei. Bei einer Yen-Stärke fallen japanische Aktien im August 2024 an einem einzigen Tag um 12 Prozent.
Auf den globalen Märkten ist der Carry Trade im Volumen von 4 Billionen Yen (26,8 Milliarden Dollar) die treibende Kraft. Dabei leihen sich Anleger in Japan zu niedrigen Zinsen Geld und investieren anderswo in ertragsstarke Anlagen. Als der Yen-Anstieg diese Geschäfte unrentabel machte, zogen die Anleger schnell ihr Geld ab. Das traf alles – von US-Aktien über den mexikanischen Peso bis hin zu Bitcoin.
Die Fed sieht sich mit einem Rückgang ihres globalen Einflusses konfrontiert. Die Struktur der Weltwirtschaft hat sich verändert, und der Anteil der USA und ihrer Verbündeten ist gesunken. 1990 trugen die USA 21 Prozent zum globalen BIP bei, die Gruppe der Sieben (G7) 50 Prozent. Bis 2024 werden diese Zahlen auf 15 Prozent bzw. 30 Prozent gesunken sein.
Der US-Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung der Welt, ist aber nicht mehr so stark wie früher. Laut dem Internationalen Währungsfonds ist der Anteil des Greenbacks an den Devisenreserven der globalen Zentralbanken von 72 % im Jahr 2000 auf 58 % im Jahr 2023 gesunken. Daten der People’s Bank of China (der Zentralbank) zeigen, dass das Land mittlerweile ein Viertel seines Handels in Yuan abwickelt – vor über einem Jahrzehnt lag dieser Wert noch bei null.
Es ist keine Überraschung, dass Amerikas Attraktivität nachgelassen hat. Andere Volkswirtschaften, insbesondere China, gewinnen zunehmend an Einfluss. Tempo und Ausmaß der Zinssenkungen der Fed werden in den kommenden Monaten entscheidend sein.
Doch Chinas Konjunkturpaket könnte noch bedeutender sein. Das Ende September 2024 angekündigte Paket wird das globale BIP im nächsten Jahr um etwa 300 Milliarden Dollar steigern, und noch mehr, wenn das Finanzministerium des Landes fiskalische Anreize setzt.
[Anzeige_2]
Quelle: https://baoquocte.vn/cuc-du-tru-lien-bang-my-fed-doi-mat-voi-su-suy-giam-anh-huong-toan-cau-290748.html


![[Foto] Generalsekretär To Lam leitet die Sitzung des zentralen Lenkungsausschusses zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption, Verschwendung und Negativität](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/fb2a8712315d4213a16322588c57b975)
![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, leitet die 8. Konferenz der hauptamtlichen Abgeordneten der Nationalversammlung](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/2c21459bc38d44ffaacd679ab9a0477c)
![[Foto] Viele Straßen in Hanoi wurden durch die Auswirkungen des Sturms Bualoi überflutet](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/18b658aa0fa2495c927ade4bbe0096df)
![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt an der Zeremonie zum 80. Jahrestag des Post- und Telekommunikationssektors und zum 66. Jahrestag des Wissenschafts- und Technologiesektors teil.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/8e86b39b8fe44121a2b14a031f4cef46)

![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt den US-Botschafter in Vietnam, Marc Knapper](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/c8fd0761aa184da7814aee57d87c49b3)


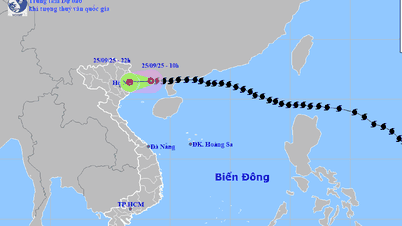

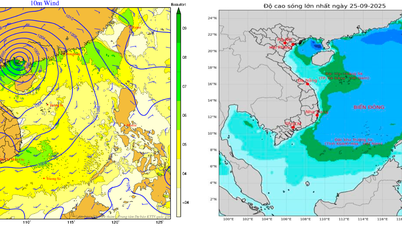
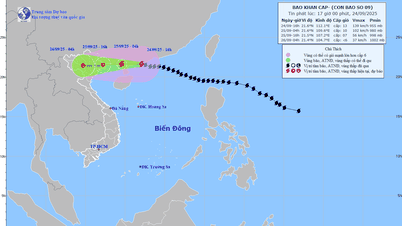
















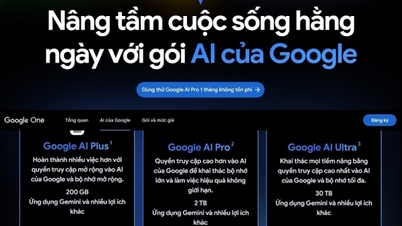




















































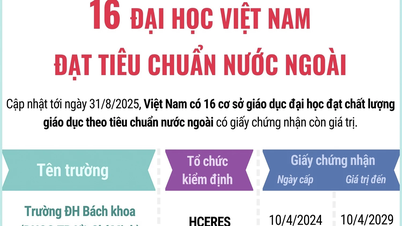





















Kommentar (0)