Unmittelbar nach Bekanntgabe der Punkteverteilung in den Prüfungsfächern durch das Ministerium für Bildung und Ausbildung hieß es in vielen Meinungen, die Punkteverteilung sei „gut“, gleichmäßig verteilt, der Durchschnittswert sei nicht zu niedrig, die Anzahl der 10er sei nicht zu hoch, was bedeute, dass die Prüfung ein Erfolg gewesen sei.
Tatsächlich zeigt ein genauerer Blick auf die einzelnen Fächer, insbesondere auf Mathematik, ein Pflichtfach, kein erfreuliches Bild und gewährleistet nicht die Fairness, die eine nationale Prüfung erfordert. In diesem Jahr lagen fast 60 % der Mathematikkandidaten unter dem Durchschnitt. Die Punkteverteilung ist deutlich verzerrt, mit einem Spitzenwert um 3,8–4,2 Punkte. Dies zeigt, dass die Prüfung für durchschnittliche Schüler sehr schwierig ist und leistungsstarke Schülergruppen nicht ausreichend differenziert.
Die Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) weisen hohe Durchschnittswerte auf, wobei die Punktzahlen im Bereich von 6 bis 8 Punkten stark streuen. Dies hat in der Öffentlichkeit Zweifel an der Konsistenz der Prüfungsgestaltung aufkommen lassen. Das Ungleichgewicht zwischen den Prüfungsfächern untergräbt die Standardisierung der Prüfung. Wenn wir weiterhin die Punktzahlen der Vorjahre als Grundlage für die Festlegung der Prüfungsrichtlinien und die Zulassungsquoten verwenden, insbesondere für jede Fächerkombination, ist das Risiko neuer Widersprüche unvermeidlich.
Obwohl die diesjährige Prüfung gemäß dem allgemeinen Bildungsprogramm von 2018 konzipiert wurde, mit dem Schwerpunkt auf Kompetenzentwicklung und weniger auf Auswendiglernen, hat die Realität viele Mängel offenbart. Der Mathematikteil enthält viele sehr lange Aufgaben, die durchschnittliche Schüler überfordern, während es im fortgeschrittenen Teil an wirklich differenzierten Aufgaben mangelt, was zu einer unausgewogenen Punkteverteilung führt: Gute Schüler erzielen leicht ungewöhnlich hohe Punktzahlen, während die Mehrheit unter dem Durchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Programm zwar neu ist, die zugrunde liegende Konzeption der Prüfungsfragen sich aber nicht wirklich verändert hat. Noch besorgniserregender ist, dass die diesjährige Punkteverteilung nicht mehr mit der der Vorjahre vergleichbar ist, viele Schulen aber weiterhin gezwungen sind, alte Daten zur Umrechnung der Zulassungspunktzahlen zu verwenden.
Die genannten Mängel werden Konsequenzen und mögliche Störungen bei der Durchführung von Hochschulzulassungen nach sich ziehen. Ohne rechtzeitige Anpassungen wird die Zulassungssaison 2025 mit erheblichen Problemen konfrontiert sein. Zunächst einmal verfügen die Hochschulen nicht über standardisierte Daten zur Erstellung einer Punkteskala, was leicht dazu führen kann, dass die einzelnen Studienplätze unterschiedlich umgerechnet werden und die Zulassungskombination verzerrt wird.
Die Diskrepanz im Schwierigkeitsgrad der Fächer kann dazu führen, dass Kandidaten mit hohen Punktzahlen in vermeintlich „einfachen“ Fächern diejenigen übertreffen, die zwar tatsächlich fähig sind, aber auf „knifflige“ Fragen stoßen – insbesondere in hart umkämpften Bereichen. Wird das virtuelle Filtersystem nicht an die neue Punkteverteilung angepasst, kann dies zu Unstimmigkeiten bei der Quotenvergabe und der Zulassungsbestätigung führen – ein Phänomen, das bereits 2022 auftrat. Hält die verzerrte Punkteverteilung langfristig ohne Korrekturmaßnahmen an, wird das Vertrauen in die Fairness der Prüfung und des Zulassungsverfahrens ernsthaft untergraben.
Um diese Folgen zu vermeiden, sollte das Ministerium für Bildung und Ausbildung die vollständigen Daten zur Notenverteilung nach Fach, Fächerkombination und Region zeitnah als offene Daten veröffentlichen. Dies dient als Grundlage für die Schulen, die Noten transparent und wissenschaftlich umzurechnen. Gleichzeitig sollten veraltete Daten nicht mehr ohne sorgfältige Analyse und Korrektur für die Umrechnung verwendet werden.
Langfristig sollte gemäß den neuen Lehrplanstandards eine nationale Kompetenzskala entwickelt werden, auf deren Grundlage geeignete Prüfungsfragen und Bewertungsskalen – computergestützte Testanwendungen – entworfen werden können, anstatt weiterhin ein zwar ansprechendes, aber letztlich bedeutungsloses Punktespektrum anzustreben. Auch das Hochschulzulassungssystem sollte schrittweise auf einen Mechanismus des Vertrauens, der Autonomie und einer differenzierten, mehrdimensionalen Beurteilung umgestellt werden, anstatt sich ausschließlich auf eine Prüfung mit zu vielen Unbekannten zu verlassen. In diesem Jahr, in dem das allgemeine Bildungsprogramm umfassend reformiert wird, muss auch die Beurteilung der studentischen Fähigkeiten neu betrachtet werden – fairer, genauer und menschlicher. Wirklich fähige Bewerber dürfen nicht ungerechtfertigt scheitern, nur weil das Beurteilungssystem lückenhaft, stark saisonabhängig und datenunzureichend ist.
Quelle: https://www.sggp.org.vn/pho-diem-bat-thuong-va-he-luy-cho-xet-tuyen-dai-hoc-post804788.html







































![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, nimmt an der VinFuture 2025 Preisverleihung teil.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F05%2F1764951162416_2628509768338816493-6995-jpg.webp&w=3840&q=75)















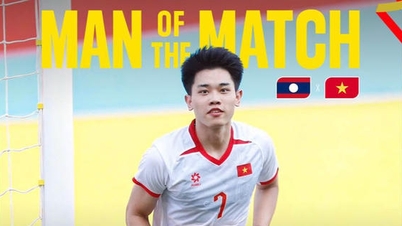













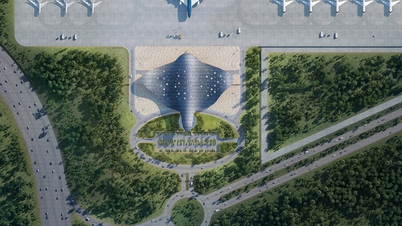




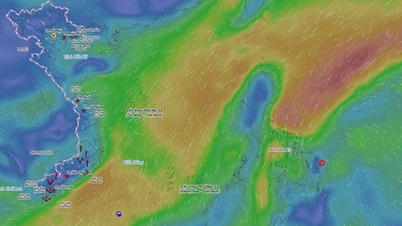



































Kommentar (0)