
Menschen kaufen in einem Supermarkt in Brüssel, Belgien, ein. (Foto: THX/TTXVN)
Am 17. Januar senkte die Europäische Kommission (EK) – das höchste Exekutivorgan der Europäischen Union (EU) – ihre Wachstumsprognose für die Eurozone im Jahr 2026. Hintergrund sind die anhaltenden Risiken aus dem internationalen Handel und geopolitische Spannungen, die die europäische Wirtschaft belasten.
Die EU-Kommission prognostiziert für die 20 Euro-Länder ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 1,2 % im Jahr 2026, gegenüber den bisherigen 1,4 %. Die stark integrierte europäische Wirtschaft bleibe weiterhin anfällig für Handelsbeschränkungen, so die Kommission. Sie betonte, dass anhaltende Unsicherheiten in der Handelspolitik die Wirtschaftstätigkeit belasten und tarifäre sowie nichttarifäre Handelshemmnisse das EU-Wachstum voraussichtlich stärker als erwartet bremsen werden. Handelsabkommen der USA mit der EU und anderen Partnern hätten die Unsicherheit jedoch verringert.
Für die 27 EU-Länder insgesamt prognostiziert die EU-Kommission ein durchschnittliches Wachstum von 1,4 % im Jahr 2026, etwas weniger als die im Mai 2025 prognostizierten 1,5 %. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis bleibt jedoch optimistisch. „Selbst in einem schwierigen Umfeld wächst die EU-Wirtschaft weiter“, sagte er.
Die EU-Kommission prognostiziert zudem, dass die Inflation in der Eurozone im Jahr 2026 1,9 % erreichen wird, gegenüber der vorherigen Prognose von 1,7 %. Für 2025 wird eine Inflation von 2,1 % erwartet, was nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 % liegt. Obwohl sich der Anstieg der Lebensmittel- und Dienstleistungspreise verlangsamt, wird dieser Trend laut EU-Kommission durch die steigende Energieinflation kompensiert.
Eine frühere Umfrage ergab, dass die Wirtschaft der Eurozone im Oktober so schnell wuchs wie seit Mai 2023 nicht mehr und beendete damit eine Phase schwachen Wachstums zu Beginn dieses Jahres. Dazu trugen ein sich beschleunigender Dienstleistungssektor und eine Verbesserung der Nachfragebedingungen bei.
Der von S&P Global erstellte Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone stieg im Oktober auf 52,5 Punkte, nach 51,2 Punkten im September 2025. Dies ist der zehnte Anstieg in Folge und ein 29-Monats-Hoch. Der PMI-Wert über 50 signalisiert zudem ein Wachstum der Produktionsaktivität in der Eurozone. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des Dienstleistungs-PMI von 51,3 auf 53 Punkte getragen – ein 17-Monats-Hoch.
Unter den Mitgliedsländern führte Spanien mit einem PMI von 56, dem besten Wert seit zehn Monaten, das Feld an, während Deutschland mit einem PMI von 53,9, dem höchsten Wert seit fast zweieinhalb Jahren, überraschend stark aufspielte. Auch Italien und Irland verzeichneten mit 53,1 bzw. 53,7 ein solides Wachstum. Frankreich blieb hingegen die einzige große Volkswirtschaft der Eurozone, die einen Rückgang verzeichnete; der PMI fiel auf ein Achtmonatstief von 47,7.
Das Wachstum im Dienstleistungssektor trug ebenfalls dazu bei, dass sich der gesamte Arbeitsmarkt auf ein 16-Monats-Hoch beschleunigte, da Dienstleistungsunternehmen ihre Neueinstellungen verstärkten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, obwohl die Hersteller weiterhin in einem noch schnelleren Tempo Stellen abbauten.
Die Wirtschaft der Eurozone verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein schnelleres Wachstum als erwartet, angetrieben von einem besser als erwarteten Wachstum in Frankreich, trotz politischer Turbulenzen in Europas zweitgrößter Volkswirtschaft.
Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im Zeitraum Juli-September gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, teilte das Statistikamt der EU mit und übertraf damit die Prognose von 0,1 Prozent, die von Analysten in einer Umfrage von Bloomberg und FactSet erwartet worden war.
Die Wirtschaft der Eurozone wurde durch überraschend gute Zahlen aus Frankreich gestützt. Trotz politischer Turbulenzen aufgrund der Staatsverschuldung und des hohen Haushaltsdefizits wuchs die französische Wirtschaft im dritten Quartal um 0,5 Prozent. Laut Herrn Colijn war diese positive Entwicklung auf gestiegene Investitionen und Exporte zurückzuführen, die unter anderem durch den starken Luft- und Raumfahrtsektor begünstigt wurden. Auch die spanische Wirtschaft wuchs im Zeitraum Juli bis September um 0,6 Prozent, allerdings langsamer als im Vorquartal mit einem beeindruckenden Wachstum von 0,8 Prozent.
Die deutsche Wirtschaft, die einer Rezession nur knapp entgangen war, stagnierte im selben Zeitraum. Auch die italienische Wirtschaft verzeichnete im Zeitraum Juli bis September kein Wachstum.
Quelle: https://vtv.vn/ec-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-nam-2026-cua-eurozone-10025111809112968.htm


![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh und seine Frau treffen die vietnamesische Gemeinde in Algerien](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/19/1763510299099_1763510015166-jpg.webp)




![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt den slowakischen Vizepremierminister und Verteidigungsminister Robert Kalinak](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763467091441_a1-bnd-8261-6981-jpg.webp)















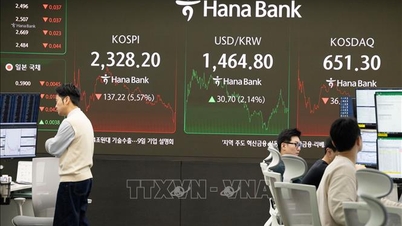























































































Kommentar (0)