
Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung
Viele Forscher sind der Ansicht, dass die nachhaltige Entwicklung der Hochschulbildung nicht von der Gestaltung des Denkens über die Hochschulbildung getrennt werden kann. Weltweit funktioniert die Hochschulbildung nach einem Modell, das lediglich gesellschaftlichen Bedürfnissen dient, und hat sich hin zu einem Modell entwickelt, das menschliche Werte betont. Diese Anpassung zielt auf eine Führung im Dienste der Gemeinschaft, auf Innovation und das universitäre Ökosystem. Dabei wird eine Führung, die den Menschen dient, zuhört, sie befähigt und fördert, als Ausgangspunkt des organisatorischen Transformationsprozesses betrachtet. Auf dieser Grundlage wird Innovation in eine ethische, umfassende und werteorientierte Richtung gefördert. Das von Ronald Barnett (1) vorgeschlagene Modell des universitären Ökosystems kann die Richtung für die Hochschulbildung zur Verbindung von Wissen, Gesellschaft und natürlicher Welt vorgeben. Die Forschung zum Ansatz einer Führung im Dienste der Gemeinschaft, von Innovation und des universitären Ökosystems bietet eine Perspektive auf die Philosophie der Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung.
Von der administrativen Führung zur Serviceführung im Bildungswesen
Das Konzept der dienenden Führung wurde erstmals in den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts von Autor Robert K. Greenleaf (2) in seinem Buch „The Servant is the Leader“ (3) als kritische Perspektive erwähnt und schlug Anpassungen des traditionellen Führungsmodells im Bildungswesen vor, das sich auf Machtkonzentration, Kontrolle und Ergebnisse statt auf menschliche Entwicklung konzentriert. Eine echte Führungskraft muss in erster Linie „dienen“, d. h. Zuhören, Einfühlungsvermögen, Fürsorge und die Entwicklung anderer stehen im Vordergrund, bevor sie Führung ausübt. Servant Leadership betont die Rolle der Führungskraft im Dienst an der Gemeinschaft und dem von ihr geführten Team. Im Bildungswesen konzentriert sich Servant Leadership darauf, Lehrende und Lernende zu unterstützen, zu befähigen und ihren Entwicklungsbedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig ein positives und nachhaltiges Lernumfeld zu schaffen.
Die Leitung von gemeinnützigen Diensten bringt dem Bildungssystem viele praktische Vorteile, wie zum Beispiel:
Erstens fördert und unterstützt dienende Führung die persönliche Entwicklung von Lernenden und Lehrenden. Durch Zuhören, Verständnis und echtes Eingehen auf die Bedürfnisse von Lehrenden und Studierenden ermöglicht dienende Führung jedem Einzelnen, sein volles Potenzial zu entfalten und gleichzeitig die emotionale Intelligenz und das Engagement innerhalb der akademischen Gemeinschaft zu stärken. Dieses Modell wirkt sich insbesondere direkt auf die berufliche Zufriedenheit und die Qualität der Arbeit der Lehrenden aus.
Zweitens schafft gemeinschaftsbasierte Führung ein positives, nachhaltiges Arbeitsumfeld und eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Flexibilität, Zusammenarbeit und Eigenverantwortung basiert. Unter der Führung effektiver gemeinschaftsbasierter Führungskräfte sind Lehrkräfte oft zufriedener mit ihrer Arbeit, was zu einer höheren Effektivität der Organisation und zur Aufrechterhaltung der Personalstabilität in Bildungseinrichtungen beiträgt.
Drittens fördert dienende Führung das Engagement, was zum Erfolg der Studierenden beiträgt. Durch die Schaffung einer sicheren, unterstützenden und kollaborativen Lernumgebung steigert dienende Führung das Engagement, die Eigenverantwortung und die intrinsische Motivation der Studierenden. Dieses Modell hat sich auch bei der psychologischen Unterstützung und psychischen Betreuung von Studierenden als wirksam erwiesen.
Viertens fördert Service Leadership die berufliche Entwicklung und steigert die Effektivität der Lehrkräfte in Lehre und Forschung. Berufliche Entwicklung, Selbstvertrauen und Teamgeist sind wichtige Ergebnisse von Service Leadership.
Die Umsetzung des Führungsmodells für gemeinnützige Arbeit im Bildungswesen ist in einigen Ländern derzeit noch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Eines der größten Hindernisse sind kulturelle und institutionelle Faktoren. Viele Bildungseinrichtungen arbeiten noch immer traditionell und konzentrieren sich auf die Zentralisierung von Macht und Kontrolle. Dies erschwert die Umstellung auf das Führungsmodell für gemeinnützige Arbeit. Um diese Hürde zu überwinden, müssen Bildungseinrichtungen geeignete Strategien entwickeln und umsetzen und gleichzeitig das Führungsmodell umfassend und flexibel an Kontext, Klassenstufe und organisatorische Gegebenheiten anpassen.
Innovation im Bildungswesen durch Neudenken von Modellen, Strukturen und Beziehungen im Bildungssystem
Innovation wird heute nicht mehr einfach als Anwendung neuer Technologien oder Methoden verstanden, sondern als kontinuierlicher Prozess der Schaffung neuer Werte durch das Überdenken von Modellen, Strukturen und Beziehungen im Bildungssystem (4) . Innovation in der Hochschulbildung umfasst: i- Lehrinnovation – aktives Lernen, Erfahrungslernen, interdisziplinäre Integration; ii- Managementinnovation – intelligentes Management entsprechend der Mission, Autonomie, Flexibilität, Datentransparenz; iii- Soziale Innovation – Universitäten, die mit der Gemeinschaft verbunden sind und soziale Probleme lösen; iv- Start-up-Innovation – Förderung des Unternehmertums, Entwicklung von Geschäftsideen aus Forschungsergebnissen, Unterstützung der Wissenskommerzialisierung, Vernetzung mit Unternehmen und Aufbau eines Innovationsökosystems in Schulen.
Bildungsinnovation durch ein Überdenken des Modells, der Struktur und der Beziehungen im Bildungssystem ist ein Ansatz, bei dem eine gemeinschaftsorientierte Führung als Katalysator fungiert und ein Umfeld für Innovationen schafft: Sie fördert Vertrauen, unterstützt das Experimentieren mit neuen Ideen, achtet auf die ethischen Aspekte von Innovationen und orientiert Innovationen von persönlichen und organisatorischen Interessen an der Förderung gemeinschaftlicher Interessen.
Das universitäre Ökosystem in das soziale Ökosystem integrieren
Das von Ronald Barnett (5) entwickelte Modell des universitären Ökosystems eröffnet einen neuen Ansatz für die Hochschulbildung des 21. Jahrhunderts. Das universitäre Ökosystem ist nicht mehr auf die Wissensvermittlung oder die Berufsausbildung beschränkt, sondern stellt sich in den Mittelpunkt der komplexen Beziehungen zwischen Menschen, Wissen und dem gesamten Ökosystem. Dies bedeutet nicht nur eine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs der Hochschule, sondern eine Neustrukturierung der Betriebsphilosophie, um sicherzustellen, dass die Hochschulen ihre gesellschaftliche Verantwortung vollumfänglich wahrnehmen und die ethischen Aspekte des gesamten Ökosystems, mit dem sie interagieren, berücksichtigen.
Der Kern des universitären Ökosystemmodells liegt im systemischen Denken und einem multidimensionalen Ansatz, bei dem verschiedene Ökosysteme stets miteinander verflochten sind und sich gegenseitig beeinflussen. Ronald Barnett hat acht Hauptökosysteme identifiziert, die universitäre Ökosysteme identifizieren und an denen sie teilhaben müssen: Wissen, Bildung, Menschen, soziale Organisation, Kultur, Wirtschaft, Politik und Natur. Bildungseinrichtungen werden nicht nur von diesen Ökosystemen beeinflusst, sondern tragen auch die Verantwortung, diese durch drei grundlegende Aufgaben wie Ausbildung, Forschung und gemeinnützige Arbeit proaktiv wiederherzustellen, zu schützen und weiterzuentwickeln.
Im Gegensatz zum Universitätsmodell, das sich auf die Leistungsstandards von Ausbildungsprogrammen oder Forschungsergebnissen konzentriert, arbeitet das Universitätsökosystem auf einer verantwortungsvollen ethischen Grundlage und legt Wert auf Integrität, Ehrlichkeit und kritischen Dialog in akademischen und administrativen Aktivitäten. Darüber hinaus ermutigt es die Schulen, Empathie und langfristige Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und der gesamten Biosphäre zu fördern und Bildung als einen Prozess der gemeinsamen Gestaltung des Lebens in Interaktion mit Natur und Gesellschaft zu betrachten (6) .
Das universitäre Ökosystem legt zudem großen Wert auf gesellschaftliches und kulturelles Engagement und ermutigt Studierende und Lehrende, sich aktiv an der Lösung lokaler sozialer, kultureller und ökologischer Probleme zu beteiligen. Dadurch wird die Universitätskultur nicht nur als „Handeln in der Welt“, sondern auch als „Handeln für die Welt“ neu gestaltet.
Aktuelle Studien zeigen die Unterschiede bei der Umsetzung des universitären Ökosystemmodells in verschiedenen Ländern. In der Türkei hat sich mancherorts ein Modell zur Schaffung organischer Verbindungen zwischen Universitäten und der lokalen natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Umgebung etabliert. In China haben einige private Hochschulen die ökologische Philosophie als Grundlage für umfassende Entwicklungs- und Innovationsstrategien gewählt. In südamerikanischen Ländern können Sprachstudenten multimediale Kunst nutzen, um das Konzept des universitären Ökosystems nachzubilden und dabei menschliche Werte, Menschenrechte und soziale Verantwortung zu betonen.
Das universitäre Ökosystem wird durch die folgenden drei Hauptsäulen gekennzeichnet: i- Systemisches Denken – Anerkennung der Schule als organisch verknüpften Teil der größeren sozial-ökologischen Systeme; ii- Mehrdimensionale Verantwortung – nicht nur gegenüber den Studierenden, sondern auch gegenüber der Gemeinschaft, der Natur und zukünftigen Generationen; iii- Pflegende Symbiose – Schaffung einer Schule als fürsorgliche Umgebung, die Lernen, Kreativität und Symbiose zwischen Menschen und zwischen Menschen und der natürlichen Welt fördert. Noch wichtiger ist, dass die Bildung und der Betrieb des universitären Ökosystems nicht durch bloße Verwaltungsvorschriften erreicht werden können, sondern einen endogenen Anpassungsprozess der Führungsphilosophie, der Organisationskultur und des akademischen Wertesystems erfordern. Insbesondere das gemeinschaftsorientierte Führungsmodell kann die Rolle eines anfänglichen Katalysators spielen, während Innovation zu einem zentralen Instrument zur Verwirklichung der Philosophie der universitären Ausbildung wird.
Probleme im Prozess der Anpassung der Führung: von der gemeinschaftsorientierten Führung bis hin zu Innovation und universitären Ökosystemen
Auf diesem Weg wird die Hochschulbildung neu ausgerichtet: vom „leistungsorientierten Management“ hin zur „Bildung fürs Leben“. Das unten dargestellte dreiphasige Modell stellt einen systemischen Ansatz dar, der Menschen, Wissen und das sozioökologische Ökosystem miteinander verbindet.
Phase 1: Servant Leadership
Bei jeder grundlegenden Transformation einer Bildungseinrichtung stehen die Menschen im Mittelpunkt. Das Modell der gemeinschaftsorientierten Führung legt das Kernprinzip fest: Führungskräfte stellen die Menschen als Subjekt des Lern- und Entwicklungsprozesses in den Mittelpunkt aller Aktivitäten. Dies ist besonders im Hochschulkontext wichtig, wo es Hochschulen gibt, die sich nur um administrative Anforderungen oder einfache Bewertungen und Rankings kümmern, was leicht zu einer Distanzierung von den tatsächlichen Bedürfnissen der Lernenden und der Gemeinschaft führen kann. Kommunalorientierte Führung trägt zum Aufbau von internem Vertrauen bei, schafft einen psychologisch sicheren Raum und fördert die Bottom-up-Beteiligung an Innovationsaktivitäten. Dies ist die Phase, in der die Grundlagen einer Organisationsphilosophie gelegt werden – in der Lernende respektiert, Lehrenden zugehört wird und der Dienst am Nächsten zur Führungsphilosophie wird.
Phase 2: Innovation
Sobald die humanistischen Grundlagen geschaffen sind, kann die Organisation in die nächste Phase eintreten: die Förderung umfassender Innovationen. Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung der Anwendung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften oder der Lehrmethoden, sondern auch um die Neupositionierung von Lernzielen, die Erweiterung interdisziplinärer und fächerübergreifender Lernräume und die Neugestaltung der Beziehungen zwischen Dozierenden, Studierenden, der Gemeinschaft und der Schule.
Das innovative Modell, das vom Community-Leadership-Modell inspiriert ist, ist oft autonomer, flexibler und ethischer. Dieses Modell ermöglicht es Einzelpersonen, Experimente zu wagen und sich für gemeinsame Werte wie soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsbildung einzusetzen. In dieser Phase beginnen Schulen, sich durch die Diversifizierung ihrer Bildungsinitiativen in Richtung Innovation zu wandeln und gleichzeitig eine klare Werteorientierung beizubehalten.
Phase 3: Universitäts-Ökosystem
Sobald eine Universität ein verantwortungsvolles Innovationsökosystem entwickelt hat, besteht der nächste Schritt darin, ein Universitätsökosystem zu werden. In dieser Phase fungiert die Universität nicht nur als Ausbildungs- oder Forschungseinrichtung, sondern auch als integraler Bestandteil eines größeren sozio-natürlichen Ökosystems.
Das universitäre Ökosystem kümmert sich um die Lebensqualität, nicht nur um akademische Leistung. Es beteiligt sich an der Lösung der großen Probleme unserer Zeit, wie sozialer Ungleichheit und Klimawandel. Dabei übernimmt das universitäre Ökosystem nicht nur Verantwortung für die Lernenden, sondern auch für die Gesellschaft und den Planeten. Dies ist das Ziel der Entwicklung einer angepassten Hochschulphilosophie – Bildung soll nicht nur die Lebensweise, sondern auch Teil des Lebens sein.
In diesen drei Phasen spiegelt jede Phase eine schrittweise Anpassung des Managementfokus hin zu humanistischen Werten, verantwortungsvoller Innovation und ökologischer Integration wider. In der Anfangsphase lautet die zentrale Philosophie „Den Menschen dienen“, d. h. die Führungskraft konzentriert sich auf die Bedürfnisse, die Entwicklung und das Glück der Organisationsmitglieder. Der wichtigste Anpassungsprozess besteht im Aufbau einer Organisationskultur, die auf Vertrauen, Konsens und Kooperation basiert. Ziel ist es, gemeinsames Vertrauen und gemeinsames Schaffen zwischen den Einzelnen zu schaffen und so den Kollektivgeist zu fördern.
Das Hochschulsystem befindet sich in einer Phase intensiverer Reformen. Die zentrale Philosophie lautet „verantwortungsvolle Innovation“ – d. h. die Förderung von Innovation parallel zu sozialer Verantwortung und Berufsethik. Der Schwerpunkt der Anpassung liegt nun auf der Umstrukturierung der Organisation, um Raum für Experimente zu schaffen und sich an die Komplexität und den schnellen Wandel des Hochschulkontexts in der Wissensökonomie anzupassen.
Die nächste Stufe ist die Entwicklung der Universität zu einer ökologischen Einheit – sie arbeitet nach der Philosophie der „ethischen Ökologie“ und schafft ein Gleichgewicht zwischen Wissensentwicklung und nachhaltiger Entwicklung. Vision und Mission der Institution werden neu ausgerichtet und gehen stärker in globale Fragen ein. Ziel ist nun nicht nur die interne Effizienz, sondern auch die nachhaltige Verbindung mit der Gemeinschaft, der Umwelt und der Welt.
Generell verläuft die Entwicklung der Hochschulbildung vom zentripetalen Modell (im Dienste der Lernenden und Lehrenden) über das adaptive Modell (Innovation und soziale Verantwortung) bis hin zum nachhaltigen ökologischen Modell (tiefe Integration in die Gesellschaft und die Welt). Auf diesem Entwicklungspfad können Hochschulen nicht nur die Qualität von Ausbildung und Forschung verbessern, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen.

Einige Probleme, die in der kommenden Zeit auftreten werden
Das Drei-Phasen-Modell von gemeinschaftsorientierter Führung über Innovation bis hin zum universitären Ökosystem ist nicht nur ein Modell der Organisationsentwicklung, sondern auch die Herausbildung einer neuen Philosophie gemeinschaftsorientierter Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung der Hochschulbildung. Angesichts des zunehmenden Drucks auf Hochschulen durch Globalisierung, Kommerzialisierung und Digitalisierung ist eine Neugestaltung der philosophischen Grundlagen dringend erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bildung Humanismus und eine liberale Mission fördert. Ausgehend von gemeinschaftsorientierter Führung trägt dieses Modell dazu bei, die humanistischen Werte der Hochschulbildung zu fördern, Innovationen innerhalb der Organisation voranzutreiben und so eine umfassende, humane und nachhaltige Vision zu entwickeln, die die Hochschule zu einem Bindeglied im globalen Ökosystem macht.
Der Prozess der Hochschulautonomie eröffnet Hochschulen neue Möglichkeiten zur Umstrukturierung ihrer Organisationsmodelle. Trotz anfänglicher Erfolge ist die Hochschulautonomie jedoch noch immer auf den Aspekt der reinen Verwaltungs- und Finanzverwaltung ausgerichtet, während die Philosophie der nachhaltigen Entwicklung und gemeinschaftsorientierter Innovation keine zentrale Rolle spielt. Dieses vorgeschlagene Modell zur Anpassung der Hochschulphilosophie kann als Orientierungsrahmen für den Prozess der Hochschulautonomie in der Tiefe dienen, nicht nur für die finanzielle oder personelle Autonomie. Um die Hochschulphilosophie schrittweise auf eine gemeinschaftsorientierte Führung auszurichten, entwickeln sich einige Länder zu einem Modell der Unterstützung, Begleitung und Entwicklung der Autonomiefähigkeit von Lernenden und Bildungseinrichtungen. Viele Hochschulen entwickeln ihre Identität und ihr Modell der nachhaltigen Entwicklung. Diesem Ansatz zufolge orientiert sich das Denken von Generationen von Führungskräften im Bildungssektor zunehmend am Gemeinwesen, an den Werten des Dienens, Teilens und der Verbundenheit.
Die Anpassung der Hochschulphilosophie ist jedoch auch mit Herausforderungen verbunden. So arbeiten viele Bildungseinrichtungen nicht wirklich innovativ; der politische Rahmen für die Förderung ist unklar; ethische Aspekte, gemeinnützige Arbeit und ökologische Verantwortung werden nicht ausreichend berücksichtigt und tauchen häufig in den Akkreditierungs- und Rankingkriterien auf. Die Führungskompetenzen, die die Hochschulphilosophie widerspiegeln, sind nach wie vor unzureichend. Die meisten Führungskräfte im Bildungsbereich sind eher auf Verwaltungsmanagement ausgerichtet und verfügen nicht über das nötige Führungsdenken, um der Gemeinschaft zu dienen.
Die Hochschulbildung des 21. Jahrhunderts steht vor komplexen und vielschichtigen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung der Hochschulphilosophie an Innovation und Gemeinschaftsorientierung der richtige Weg.
Dieses Modell ist im Kontext der Förderung der Hochschulautonomie in Deutschland wichtig, da es neben administrativen Faktoren wie Finanzen, Personal oder Ausbildungsprogrammen auch einen Zugang zur Philosophie der Hochschulbildung eröffnet – Autonomie in Vision, Werten, Organisation und gesellschaftlicher Mission. Um dieses Modell zu verwirklichen, kann sich die Hochschulbildung jedoch nicht allein auf die Rolle der Leitung und des Managementteams verlassen, sondern erfordert eine synchrone Entwicklung der Organisationskultur, der Mechanismen, der Richtlinien und der Umsetzungskapazitäten auf vielen Ebenen.
Um die Philosophie der Hochschulbildung auf eine nachhaltige Entwicklung auszurichten, sollten die folgenden Lösungen in Betracht gezogen werden:
Erstens: Entwicklung der Führungskompetenz für Dienst und Wandel: Es ist notwendig, Schulungs- und Entwicklungsprogramme für die Führungs- und Managementteams der Hochschulen in Richtung Dienst – Wandel – mit ökologischer Vision zu entwickeln. Förderung der Forschung zur Anwendung humaner, kreativer und nachhaltiger Führungsmodelle, die den nationalen Bedingungen entsprechen.
Zweitens: Schaffung eines Umfelds zur Förderung verantwortungsvoller Innovationen: Um dieses Modell umzusetzen, ist es notwendig, das Team der Bildungsleiter und -manager auf Service- und Ökosystemdenken umzuschulen, einen kontrollierten Test-, Evaluierungs- und Verbesserungsmechanismus aufzubauen, um innovative Ideen zu entwickeln und ökologisch-soziale Werte in den Rahmen der Bildungsqualitätsbewertung zu integrieren. Schaffung eines kontrollierten Testraums (Sandbox) an Hochschulen, um die Umsetzung von Bildungsinitiativen, Lehre und interdisziplinärer Forschung zum Wohle der Gemeinschaft und der Umwelt zu ermöglichen. Anwendung eines Feedback-, Evaluierungs- und kontinuierlichen Verbesserungsmechanismus, um eine Kultur verantwortungsvoller Innovation zu fördern.
Drittens: Integration ökologischen Denkens in die Entwicklungsstrategien der Universitäten: Gestaltung von Schulentwicklungsstrategien, Lehrplänen und Forschung auf der Grundlage ökologischen Denkens, einschließlich akademischer Ökologie (Wissen), sozialer Ökologie (Gemeinschaft) und Umweltökologie (Nachhaltigkeit).
Viertens: Reform der Politik und der Bewertungssysteme: Integration sozialer, ökologischer und wissenschaftlich-ökologischer Kriterien in das System der Akkreditierung, des Rankings und der Qualitätsbewertung von Universitäten. Die Forschung zur Gestaltung eines politischen Rahmens für die Autonomie der Universitäten geht in die Tiefe und beschränkt sich nicht nur auf administrative und finanzielle Aspekte.
Fünftens: Förderung der Ökosystemkooperation: Förderung der Kooperationsbeziehungen zwischen Hochschulen und Kommunen, Unternehmen, sozialen Organisationen, Umweltorganisationen und Forschungsinstituten zur Bildung eines ökologischen Aktionsnetzwerks./.
-------------------
(1) Hochschulanalytiker, Honorarprofessor für Hochschulbildung am Institute of Education, University College London
(2) (1904 - 1990), Forscher für Management, Entwicklung und Bildung, Gründer der modernen Servant Leadership-Bewegung und des Greenleaf Center for Servant Leadership in den USA
(3) Siehe: Robert K. Greenleaf: Was ist Servant Leadership ?, https://greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
(4) Siehe: Nguyen Huu Duc, Nguyen Huu Thanh Chung, Nghiem Xuan Huy, Mai Thi Quynh Lan, Tran Thi Bich Lieu, Ha Quang Thuy, Nguyen Loc: „Approaching higher education 4.0 - Characteristics and evaluation criteria“, Journal of Science : Policy and Management Research, Hanoi National University , Bd. 34, Nr. 4 (2018), S. 1 - 28
(5) Siehe: Ronald Barnett: The Ecological University - A Feasible Utopia , Routledge, London und New York. 2018, https://doi.org/10.4324/9781315194899
(6) Siehe: Nguyen Huu Thanh Chung, Tran Van Hai, Luu Quoc Dat, Nancy W Gleason, Nguyen Huu Duc: „Measuring 4IR Responsiveness in Vietnam's Higher Education“, Journal of Institutional Research South East Asia, 20 (2), September/Oktober 2022; http://www.seairweb.info/journal/articles/JIRSEA_v20_n02/JIRSEA_v20_n02_Article01.pdf
Quelle: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/1125003/giao-duc-dai-hoc-vi-su-phat-trien-ben-vung---nhung-van-de-dat-ra.aspx





![[Foto] Preisverleihung des politischen Wettbewerbs zum Schutz der ideologischen Grundlagen der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761151665557_giaia-jpg.webp)
![[Foto] Da Nang: Schockkräfte schützen Leben und Eigentum der Menschen vor Naturkatastrophen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761145662726_ndo_tr_z7144555003331-7912dd3d47479764c3df11043a705f22-3095-jpg.webp)
![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet Sitzung zum Bau von Kernkraftwerken](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761137852450_dsc-9299-jpg.webp)




















































































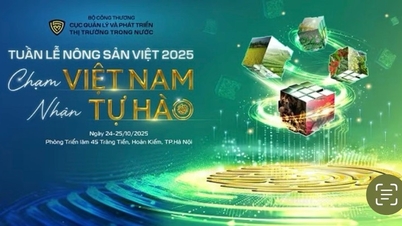











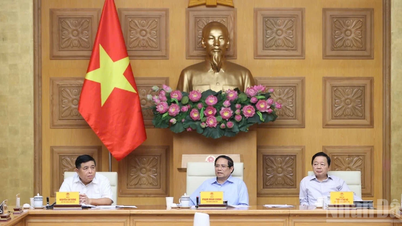






Kommentar (0)